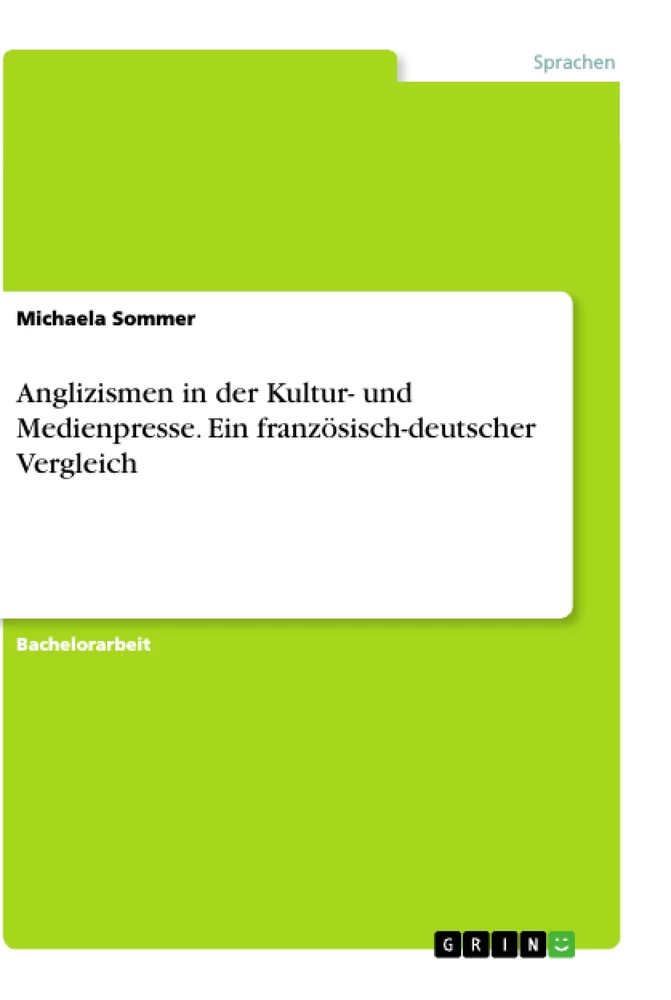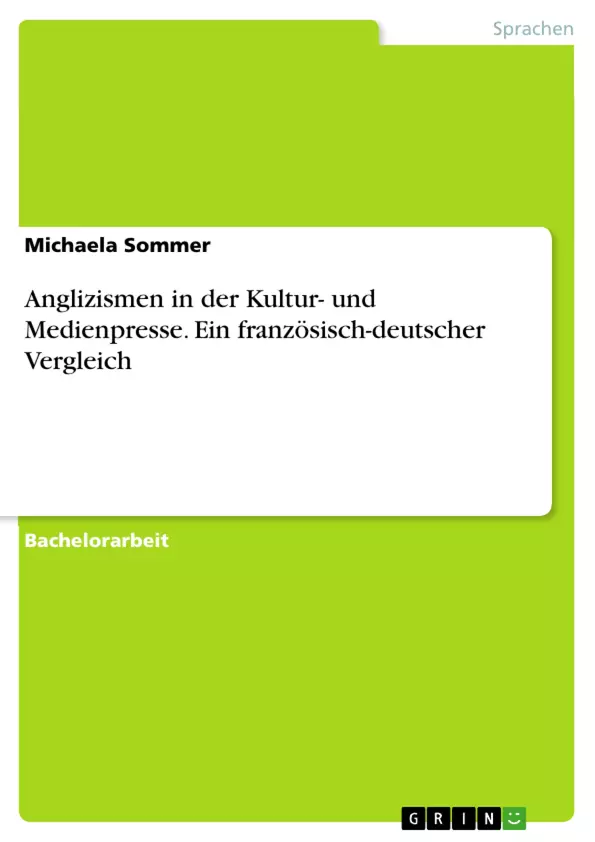In der heutigen globalisierten Welt nähern sich Kulturen intensiv einander an und Sprachkontakt scheint allgegenwärtig. Prinzipiell lässt sich sagen, dass fremdsprachlicher Einfluss in allen Kultursprachen vorzufinden ist. Vor allem Medien wie das Internet tragen zur rasanten Verbreitung fremdsprachlichen Wortguts bei. Heute ist es besonders das Englische, das andere Nationalsprachen aufgrund Technologien oder Kulturimporten wie amerikanischer Musik beziehungsweise amerikanischem Lebensstil beeinflusst. Der stetige wirtschaftliche und politische Aufschwung Amerikas verhalf dem Englischen zu dessen heutiger Sonderstellung in der Welt und das Französische wurde in seiner Funktion als Weltverkehrssprache abgelöst.
Wie gegenwärtige Sprachpolitik und Sprachpflege erkennen lassen, steht die französische Gesetzgebung fremdsprachlichem Wortgut (vor allem Anglizismen) kritisch gegenüber. Die deutsche Sprache hingegen, gibt sich bezüglich englischen Entlehnungen sehr empfänglich und scheut sich mit Begriffen wie public viewing, besonders im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, auch nicht vor Scheinentlehnungen. Daraus ergibt sich die, der Arbeit zugrunde liegenden Annahme, dass in der französischen Presse weniger Anglizismen verwendet werden, als in der Deutschen. Folglich besteht das Ziel in der Verifikation der Annahme mittels einer empirischen Untersuchung. Die Gründe für die Hypothese werden von Aspekten wie beispielsweise der unterschiedlichen Sprachpolitik der beiden Nachbarländer gestützt.
Die Begriffe Kultur- und Medienpresse sind hinsichtlich der Berichterstattung der jeweiligen Bereiche Kultur und Medien zu verstehen. An dieser Stelle scheint es besonders interessant Fokus auf die Themenfelder Musik und Internet zu setzen, da diesen Gebieten bislang wenig bis keine Beachtung auf Forschungsebene geschenkt wurde. Von den Sparten Sport, Werbung oder Wirtschaft wurde abgesehen, da es diesbezüglich schon einige Untersuchungen gibt.
Wie sich im weiteren Verlauf der Arbeit zeigen wird, eignet sich Mediensprache, insbesondere Pressesprache sehr gut als Verstärker neuer Wörter und für deren Verbreitung unter den Sprechergemeinschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entlehnung
- Sprachkontakt als Basis für Entlehnungsprozesse
- Konzeptuelle Darstellung von Entlehnung nach Winter-Froemel (2011)
- Lehnwort vs. Fremdwort
- Strukturelle und etymologische Fremdheit hinsichtlich der Neufestsetzung des Begriffs Lehnwortintegration
- Der Begriff Code Switching in Abgrenzung zum Terminus Entlehnung
- Luxus- und Bedürfnislehnwörter
- Entlehnungen aus dem Englischen
- Zum Begriff Anglizismus
- Das Phänomen Scheinentlehnung
- Zum Begriff Scheinentlehnung
- Pseudoanglizismen
- Anglizismen im Französischen
- Anglizismen im Deutschen
- Gründe für Entlehnungen aus dem Englischen
- Zur Sprachpolitik und Sprachpflege Frankreichs mit Ausblick auf die Situation in Deutschland
- Französische Sprachpolitik
- Loi Bas-Lauriol (Loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française)
- Loi Toubon (Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)
- Der Beginn französischer Sprachpflege: Die Académie française
- Situation in Deutschland
- Französische Sprachpolitik
- Überlegungen zur Mediensprache
- Erläuterungen und Begründung
- Französische vs. deutsche Pressesprache
- Eine empirische Untersuchung zu Anglizismen in der Kultur- und Medienpresse im französisch-deutschen Vergleich
- Die Quellen
- Le Figaro
- Le Monde
- Die Welt
- Die Süddeutsche Zeitung
- Die Erstellung des Korpus
- Methode der Korpus Analyse
- Ziele und Vorgehensweise
- Kriterien
- Analyse und Auswertung der Ergebnisse
- Zur Quantität und Qualität der identifizierten Anglizismen
- Formen
- Wortarten
- Innersprachlicher Vergleich: Konservative vs. liberale Presse
- Die Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Präsenz von Anglizismen in der französischen und deutschen Kultur- und Medienpresse. Ziel ist ein vergleichender Ansatz, der die Häufigkeit, die Formen und die Wortarten der Anglizismen in beiden Sprachräumen analysiert und die sprachpolitischen und sprachpflegerischen Hintergründe beleuchtet. Die Untersuchung berücksichtigt auch die Unterschiede zwischen konservativer und liberaler Presse.
- Häufigkeit und Verbreitung von Anglizismen in der französischen und deutschen Presse
- Formen und Wortarten der verwendeten Anglizismen
- Sprachpolitische und sprachpflegerische Maßnahmen in Frankreich und Deutschland
- Unterschiede im Umgang mit Anglizismen zwischen konservativer und liberaler Presse
- Einflussfaktoren auf die Integration von Anglizismen in die französische und deutsche Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Anglizismen in der Kultur- und Medienpresse ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, einen französisch-deutschen Vergleich durchzuführen. Es werden die zentralen Forschungsfragen formuliert und die Methodik kurz skizziert. Die Einleitung begründet die Relevanz des Themas im Kontext von Sprachwandel und Globalisierung und liefert einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
Die Entlehnung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es wird der Sprachkontakt als Basis für Entlehnungsprozesse erläutert, die Konzeptualisierung von Entlehnung nach Winter-Froemel (2011) vorgestellt (inkl. Unterscheidung von Lehn- und Fremdwörtern sowie der Lehnwortintegration) und der Begriff "Code-Switching" im Vergleich zur Entlehnung abgegrenzt. Schließlich werden Luxus- und Bedürfnislehnwörter definiert und in den Kontext der Untersuchung eingeordnet.
Entlehnungen aus dem Englischen: Dieses Kapitel befasst sich mit Anglizismen im Speziellen. Es definiert den Begriff "Anglizismus", erläutert das Phänomen der Scheinentlehnung und Pseudoanglizismen. Es folgt eine Beschreibung von Anglizismen im Französischen und im Deutschen, bevor die Arbeit abschließend die Gründe für die Entlehnung englischer Wörter untersucht, die mit den sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Einflüssen des Englischen in Verbindung gebracht werden.
Zur Sprachpolitik und Sprachpflege Frankreichs mit Ausblick auf die Situation in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die sprachpolitischen und -pflegerischen Bemühungen in Frankreich und Deutschland. Es werden die Loi Bas-Lauriol und die Loi Toubon als zentrale sprachpolitische Maßnahmen in Frankreich vorgestellt und deren Auswirkungen auf den Gebrauch von Anglizismen diskutiert. Der Einfluss der Académie française auf die französische Sprachpflege wird ebenso beleuchtet wie die Situation in Deutschland, die im Vergleich zu Frankreich eine weniger restriktive Sprachpolitik aufweist.
Überlegungen zur Mediensprache: Dieser Abschnitt erörtert die Besonderheiten der Mediensprache im Kontext der Anglizismen-Forschung. Es werden die Unterschiede zwischen der französischen und der deutschen Pressesprache im Hinblick auf die Integration und den Gebrauch von Anglizismen herausgearbeitet. Dieser Teil der Arbeit bildet den Brückenschlag zur empirischen Untersuchung.
Eine empirische Untersuchung zu Anglizismen in der Kultur- und Medienpresse im französisch-deutschen Vergleich: In diesem zentralen Kapitel wird die Methodik der empirischen Untersuchung detailliert beschrieben. Die Auswahl der Quellen (Le Figaro, Le Monde, Die Welt, Süddeutsche Zeitung), die Erstellung des Korpus, die Methode der Korpusanalyse (inkl. der Ziele und Kriterien) und die Auswertung der Ergebnisse werden ausführlich dargestellt. Die Analyse umfasst die Quantität und Qualität der identifizierten Anglizismen, deren Formen und Wortarten sowie einen Vergleich zwischen konservativer und liberaler Presse. Die Ergebnisse liefern konkrete Daten zur Häufigkeit und zum Gebrauch von Anglizismen in den untersuchten Medien.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Kultur- und Medienpresse, französisch-deutscher Vergleich, Sprachpolitik, Sprachpflege, Code-Switching, Lehnwörter, Fremdwörter, empirische Untersuchung, Korpusanalyse, Loi Toubon, Loi Bas-Lauriol, Académie française, konservative Presse, liberale Presse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anglizismen in der französisch-deutschen Kultur- und Medienpresse
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht vergleichend die Präsenz von Anglizismen in der französischen und deutschen Kultur- und Medienpresse. Sie analysiert Häufigkeit, Formen und Wortarten der Anglizismen und beleuchtet die sprachpolitischen und sprachpflegerischen Hintergründe. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Unterschieden zwischen konservativer und liberaler Presse.
Welche Quellen wurden für die empirische Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf einem Korpus, der aus Artikeln folgender Zeitungen zusammengestellt wurde: Le Figaro, Le Monde (Frankreich) und Die Welt, Süddeutsche Zeitung (Deutschland).
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine quantitative und qualitative Methode der Korpusanalyse. Es werden die Häufigkeit, die Formen und die Wortarten der Anglizismen analysiert. Ein Vergleich zwischen konservativer und liberaler Presse wird ebenfalls durchgeführt.
Welche sprachpolitischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die französische Sprachpolitik und -pflege, insbesondere die Loi Bas-Lauriol (1975) und die Loi Toubon (1994). Sie vergleicht diese mit der Situation in Deutschland und beleuchtet den Einfluss der Académie française.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der Sprachkontakte und der Wortentlehnung, insbesondere die Konzeptualisierung von Entlehnung nach Winter-Froemel (2011). Der Unterschied zwischen Lehn- und Fremdwörtern sowie der Begriff des Code-Switching werden erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Entlehnung, Entlehnungen aus dem Englischen, Zur Sprachpolitik und Sprachpflege Frankreichs mit Ausblick auf die Situation in Deutschland, Überlegungen zur Mediensprache und Eine empirische Untersuchung zu Anglizismen in der Kultur- und Medienpresse im französisch-deutschen Vergleich.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die empirische Untersuchung liefert konkrete Daten zur Häufigkeit und zum Gebrauch von Anglizismen in den untersuchten Medien, unterteilt nach Formen, Wortarten und Unterschiede zwischen konservativer und liberaler Presse. Die Ergebnisse zeigen die Quantität und Qualität der identifizierten Anglizismen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anglizismen, Kultur- und Medienpresse, französisch-deutscher Vergleich, Sprachpolitik, Sprachpflege, Code-Switching, Lehnwörter, Fremdwörter, empirische Untersuchung, Korpusanalyse, Loi Toubon, Loi Bas-Lauriol, Académie française, konservative Presse, liberale Presse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf einen vergleichenden Ansatz, der die Häufigkeit, die Formen und die Wortarten der Anglizismen in beiden Sprachräumen analysiert und die sprachpolitischen und sprachpflegerischen Hintergründe beleuchtet. Die Untersuchung berücksichtigt auch die Unterschiede zwischen konservativer und liberaler Presse.
- Arbeit zitieren
- Michaela Sommer (Autor:in), 2016, Anglizismen in der Kultur- und Medienpresse. Ein französisch-deutscher Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/882695