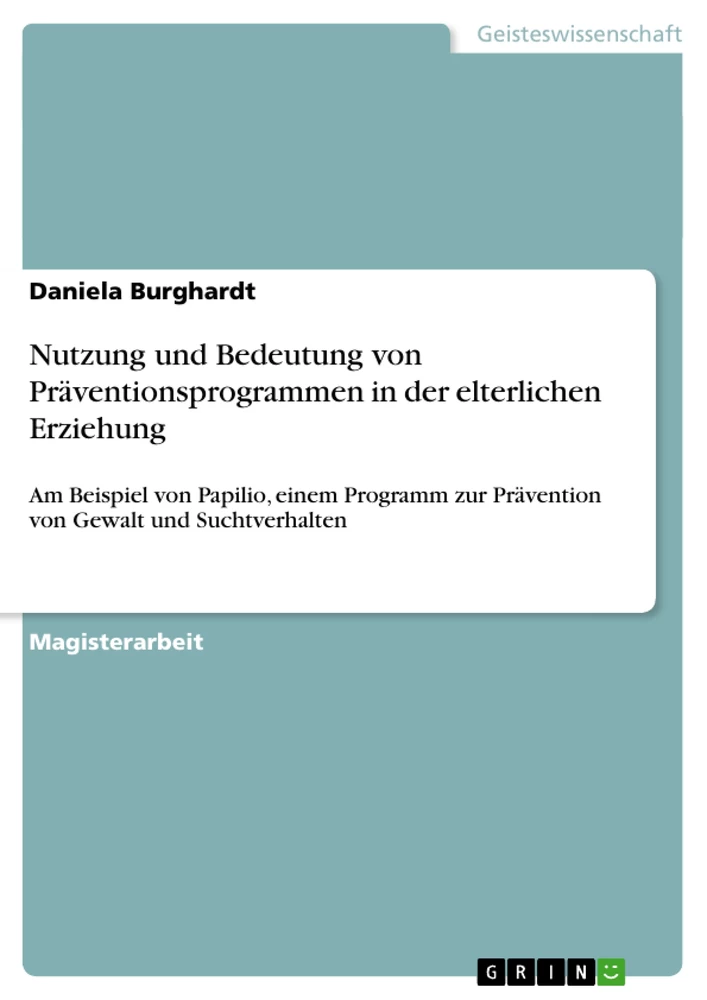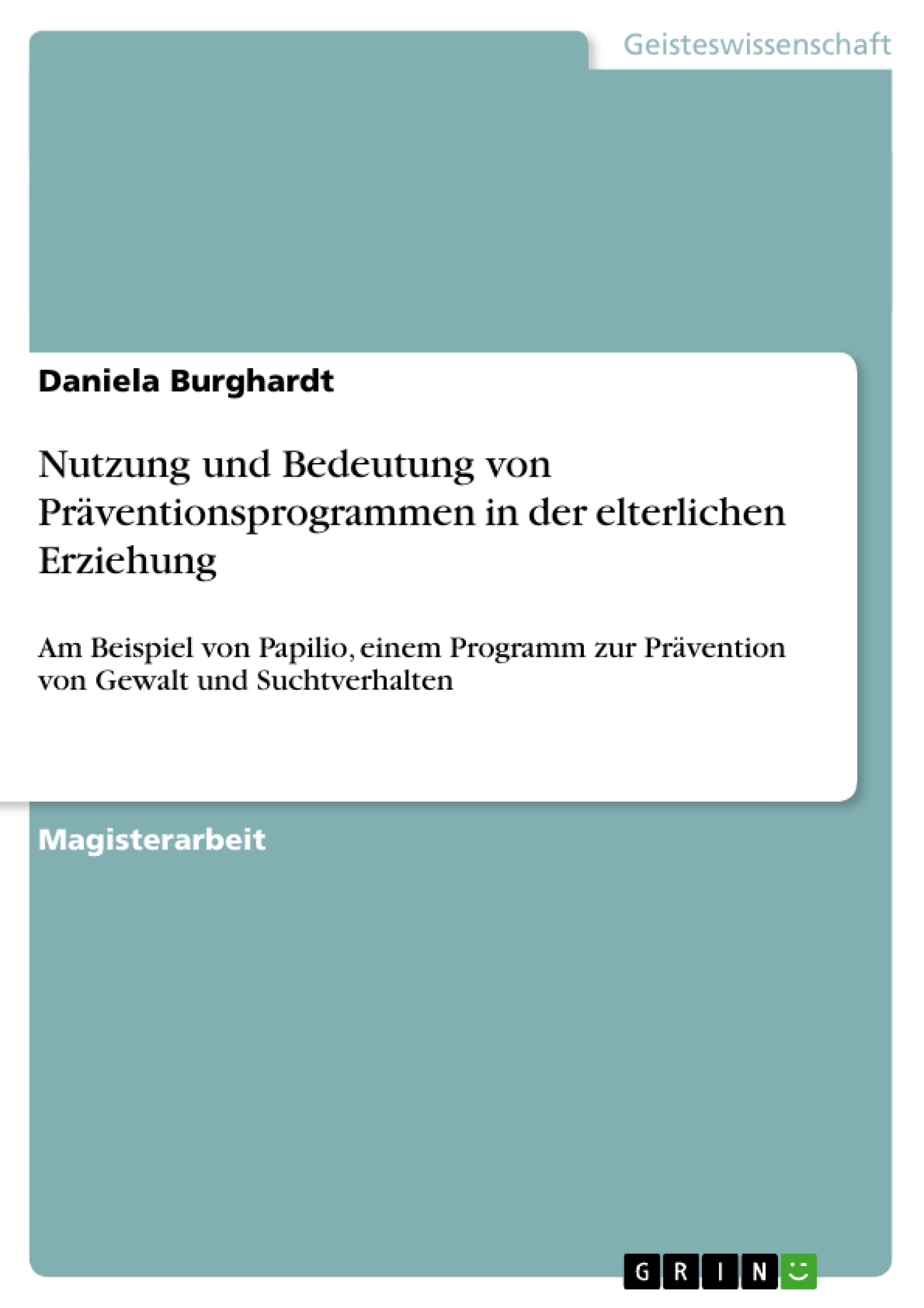Das Thema Frühförderung hat in den letzten Jahren immer mehr an Aktualität gewonnen, denn aufgrund des Geburtenrückgangs und des demographischen Wandels ist man sich der Bedeutung der Kinder für die Gesellschaft bewusst geworden. Aber nicht allein die wirtschaftlichen Aspekte machen uns deutlich, wie wichtig Kinder für den erfolgreichen Fortbestand unserer Gesellschaft sind, sondern auch die spartenübergreifende Diskussion in Bildungspolitik, Familienpolitik, Innenpolitik und Sozialpolitik. All diese Diskussionsbereiche zeigen, dass man sich mittlerweile intensiv mit dem Nachwuchs befasst. Oftmals ist die Auseinandersetzung mit diesen und anderen Themen eher pauschal und wird einseitig problematisiert. Allerdings sollten uns all diese Ansätze trotzdem dazu anregen, uns umfassender damit zu beschäftigen, wie Kinder in unserer Gesellschaft aufwachsen, denn die soziale und mentale Stärke unseres Landes hängt einerseits natürlich von den quantitativen, aber auch in besonderem Maße von der qualitativen Disposition der nachfolgenden Generationen ab. Die Frühförderung durch frühkindliche Bildung und Präventionsprogramme ist eine Möglichkeit, die Kinder von heute auf die gesellschaftlichen Anforderungen von morgen vorzubereiten.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Präventionsprogramme genutzt werden und welche Bedeutung sie für ihre Nutzer (in diesem Fall Eltern) haben. Gleichzeitig sollen Schwachstellen und Erweiterungsbedarf von Präventiven Maßnahmen aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- INHALTSVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG: SOZIALISATION UND PRÄVENTION IM KINDERGARTENALTER
- 1.1 Zum Begriff der Sozialisation
- 1.2 Zur Bedeutung der Prävention
- 1.3 Die Kindergartenzeit als Präventionsphase
- 1.3.1 Externalisierende Probleme
- 1.3.2 Internalisierende Probleme
- 1.3.3 Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten im Kindergartenalter
- 1.4 Die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen
- 1.4.1 Entwicklungsbedingungen prosozialer Responsivität in der Kindheit
- 1.4.2 Wie sich das Verständnis für die anderen Menschen entwickelt
- 1.5 Kinder mit besonderem Präventionsbedarf
- 1.5.1 Ergebnisse der Kinder- und Jugendstudie KiGGS
- 1.5.2 Kinder aus Risikofamilien haben Frühprävention besonders nötig
- 1.6 Frühprävention als Aufgabe der heutigen Gesellschaft
- 2 PROGRAMME ZUR PRÄVENTION IM KONDERGARTEN UND ZUHAUSE
- 2.1 „Kindergarten plus“
- 2.2 ,,Verhaltenstraining im Kindergarten“
- 2.2.1 Inhalte des Programms „Verhaltenstraining im Kindergarten“
- 2.2.2 Forschungsergebnisse und Effektivität von ,,Verhaltenstraining im Kindergarten“
- 2.3 Faustlos
- 2.3.1 Inhalte des Programms „Faustlos“
- 2.3.2 Forschungsergebnisse und Effektivität von „Faustlos“
- 2.4 STEP
- 2.4.1 Inhalte des Elterntrainingsprogramms „STEP“
- 2.4.2 Forschungsergebnisse und Effektivität von „STEP“
- 2.5 Große Vielfalt an Präventionsmaßnahmen
- 3 PAPILIO®: Ein Programm für Kindergärten zur Primärprävention von Verhaltensproblemen und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz
- 3.1 Überblick über die Inhalte des Programms
- 3.2 Ein Programm auf Drei Ebenen
- 3.2.1 Erzieherinnen-Ebene
- 3.2.2 Kinder-Ebene
- 3.2.2.1 Der „Spielzeug-macht-Ferien-Tag“
- 3.2.2.2 Paula und die Kistenkobolde“
- 3.2.2.3 Das „Meins-deins-deins-unser-Spiel“
- 3.2.3 Eltern-Ebene
- 3.3 Evaluation
- 3.3.1 Forschungsdesign
- 3.3.2 Ergebnisse
- 4 PAPILIO ELTERNBEFRAGUNG
- 4.1 Zugrunde liegende Fragestellung
- 4.2 Ergebnisse der Befragung
- 4.2.1 Personendaten der Teilnehmer
- 4.2.2 Schulabschluss, Berufe und Einkommen
- 4.2.3 Familienstatus
- 4.2.4 Wie nutzen Eltern das Material von Papilio zuhause?
- 4.2.5 Wie bewerten Eltern die einzelnen Komponenten des Programms?
- 4.2.6 „Brainstorming“ zum Thema Papilio
- 4.2.7 Angaben über den „ersten Eindruck“
- 4.2.8 Weitere Kommentare
- 4.2.9 Kritik der Eltern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Nutzung und Bedeutung von Präventionsprogrammen in der elterlichen Erziehung am Beispiel des Programms Papilio. Das Ziel ist es, die Effektivität und Relevanz von Präventionsmaßnahmen für Kinder im Kindergartenalter zu beleuchten und dabei die spezifischen Herausforderungen und Chancen von Papilio zu analysieren.
- Die Bedeutung von Sozialisationsprozessen im Kindergartenalter
- Die Notwendigkeit und Relevanz von Präventionsmaßnahmen in der elterlichen Erziehung
- Die Wirksamkeit von Präventionsprogrammen, insbesondere von Papilio, für die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen
- Die Perspektive der Eltern auf Präventionsprogramme und ihre praktische Anwendung im Familienalltag
- Die Rolle von Bildungseinrichtungen und Familien in der Unterstützung von Kindern mit besonderem Präventionsbedarf
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 liefert eine Einführung in den Zusammenhang von Sozialisation und Prävention im Kindergartenalter. Hier wird auf die Bedeutung von Präventionsprogrammen für die Entwicklung von Kindern hingewiesen und die Herausforderungen der Frühprävention in einer komplexen Gesellschaft beleuchtet. Kapitel 2 widmet sich einer Auswahl von Programmen zur Prävention im Kindergarten und zu Hause. Dabei werden verschiedene Ansätze und Inhalte vorgestellt, sowie die empirische Forschung zu deren Effektivität beleuchtet. Kapitel 3 konzentriert sich auf das Programm Papilio, das sich an Kindergärten richtet und auf die Primärprävention von Verhaltensproblemen sowie die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen fokussiert. Die Inhalte des Programms werden in allen drei Ebenen (Erzieherinnen, Kinder und Eltern) detailliert dargestellt, und die Evaluation des Programms wird analysiert. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse einer Elternbefragung zu Papilio. Die Studie untersucht die Nutzung des Programms im Familienalltag, die Bewertung einzelner Komponenten und die allgemeine Meinung der Eltern zu Papilio.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Frühprävention, Sozialisation, Kinderentwicklung, Verhaltensprobleme, sozial-emotionale Kompetenz, elterliche Erziehung, Präventionsprogramme, Papilio, Evaluation, Elternbefragung, und der Förderung von Kindern in ihrer Entwicklung. Die Arbeit stellt die Bedeutung von präventiven Maßnahmen für die Gestaltung einer positiven Entwicklung bei Kindern dar, mit dem Fokus auf die praktische Anwendung im Familienalltag.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Frühprävention im Kindergartenalter so wichtig?
Die Kindergartenzeit ist eine entscheidende Phase für die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen. Frühprävention hilft, Verhaltensauffälligkeiten frühzeitig entgegenzuwirken.
Was ist das Programm „Papilio“?
Papilio ist ein Primärpräventionsprogramm für Kindergärten, das auf drei Ebenen (Erzieher, Kinder, Eltern) ansetzt, um soziale Kompetenzen zu fördern und Verhaltensproblemen vorzubeugen.
Welche Rolle spielen die Eltern bei Präventionsprogrammen?
Eltern sind zentrale Partner. Programme wie Papilio oder STEP bieten Materialien und Trainings für zu Hause an, um die Erziehungskompetenz zu stärken und die Nachhaltigkeit der Förderung zu sichern.
Was sind externalisierende und internalisierende Probleme?
Externalisierende Probleme äußern sich nach außen (z.B. Aggressivität), während internalisierende Probleme nach innen gerichtet sind (z.B. Ängstlichkeit oder Rückzug).
Wie bewerten Eltern die Nutzung von Programmen wie Papilio?
Eine Befragung zeigt, dass Eltern die Materialien (wie „Paula und die Kistenkobolde“) schätzen, aber auch Kritikpunkte hinsichtlich der praktischen Umsetzung im Alltag äußern.
- Citar trabajo
- Daniela Burghardt (Autor), 2008, Nutzung und Bedeutung von Präventionsprogrammen in der elterlichen Erziehung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88273