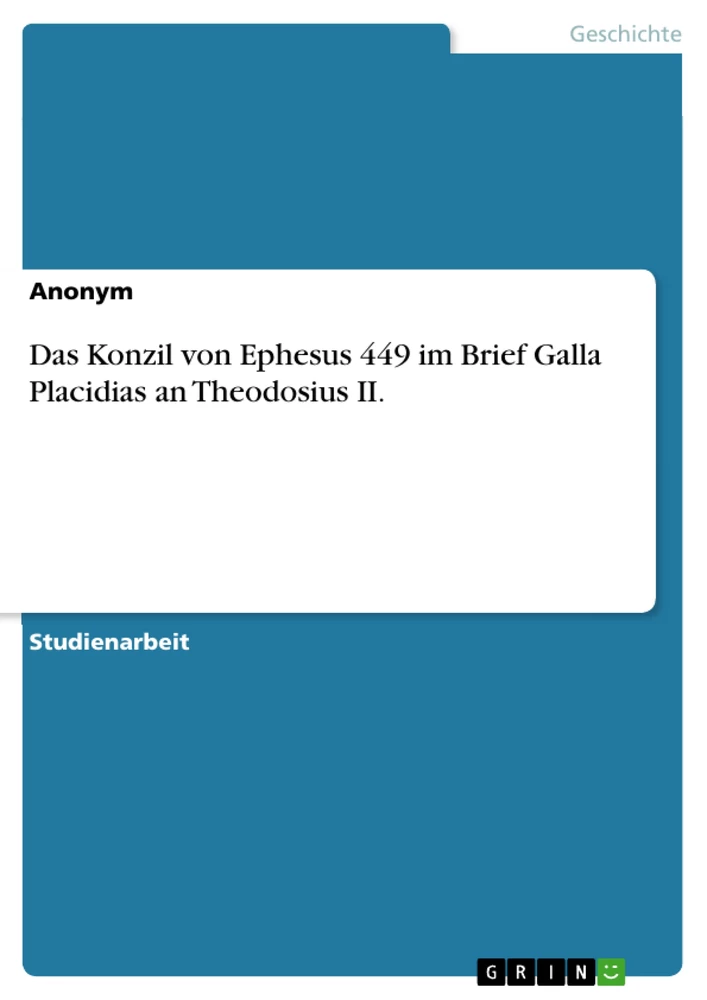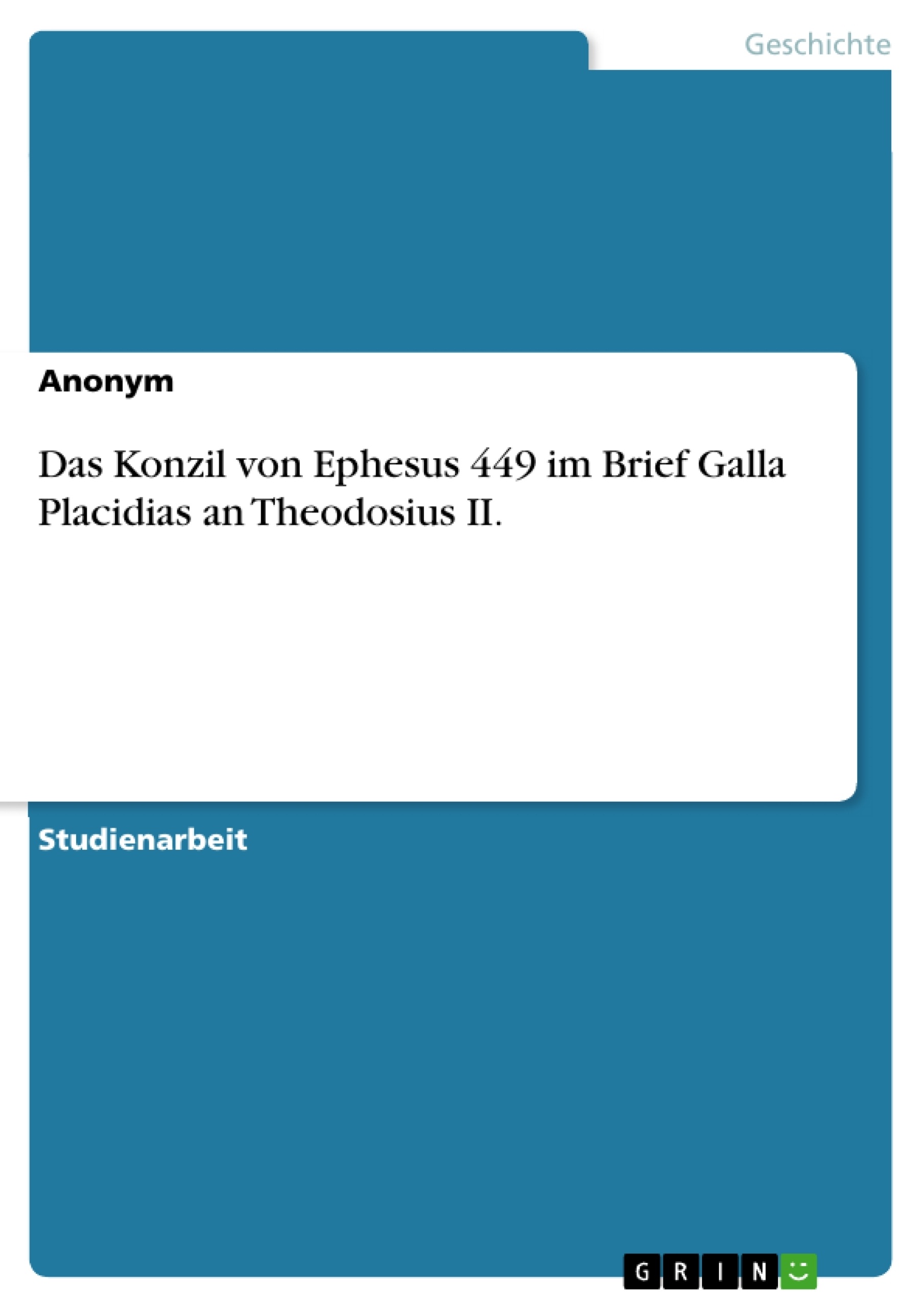Nachdem das Christentum im Jahr 324 durch den Kaiser Konstantin I. akzeptiert wurde, verlangte dieser das Praktizieren eines einheitlichen Glaubens. So wurde gegen alle Christen, die abweichende dogmatische Positionen vertraten, rigoros vorgegangen. Die weltumfassende Verfolgung der Christen selbst war zwar beendet. Dennoch wurden nun, im vierten und fünften Jahrhundert auch innerhalb des Christentums vehement Ketzerei-Vorwürfe getätigt, wenn interne Spaltungen über theologische Fragen entstanden. Was mit den Auseinandersetzungen einiger weniger Kleriker begann, konnte rasch mehr kaiserliches Interesse auf sich ziehen und Ausschreitungen entzünden, als irgendeine andere kulturelle Auseinandersetzung dieser Zeit. Im Zeitraum von 325-600 war es vorrangiges Ziel des Christentums, eine Definition für Orthodoxie zu finden. Doch die Uneinigkeit der Parteien über die Grundpfeiler des christlichen Glaubens machte die Frage nach dem „richtigen Glauben“ zu einem fortwährenden Gegenstand der Debatte. Aus dieser Zeit stammt ein Brief der weströmischen Augusta und der Tochter des Kaisers Theodosius I. namens Galla Placidia an den oströmischen Kaiser Theodosius II. .
Den Anlass für diese Korrespondenz gaben die Beschlüsse, die im Jahr 449 auf dem zweiten Konzil von Ephesus gefällt wurden und die auf Initiative des Papstes Leo I. widerlegt werden sollten. Diesen Brief werde ich in meiner Arbeit chronologisch eingerahmt analysieren. Anschließend werde ich, beispielhaft an Galla Placidia, kurz auf ihre Rolle als kaiserliche Frau und die an sie gestellten Erwartungen diskutieren. Der Gegenstand des Briefes, das zweite Konzil von Ephesus, ist nur teilweise überliefert. Die erste Session des Konzils wurde im sogenannten Konzil von Chalkedon nochmals verlesen. Damit konnte es in den griechischen Akten dieses 18 Jahre später stattgefundenen Konzils überliefert werden. Spannend ist, dass die Akte des ephesinsichen Konzils selbst nachträglich korrigiert wurde, wie spätere Zeugenaussagen auf dem Konzil von Chalkedon belegen. Der Vorsitzende des Konzils, Dioscorus, damaliger Patriarch von Alexandria, habe bewusst andersdenkende Stimmen ausgelassen und sogar Gewalt angewendet, um zu verhindern, dass unabhängige Schriften verfasst werden konnten. Unter diesem Gesichtspunkt rückt vielleicht gerade auch die Wichtigkeit externer Quellen, in diesem Fall in Form der Briefe des Papstes Leo I., in den Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Historischer Kontext
- a. Der Weg nach Ephesus
- b. Das Konzil von Ephesus 449
- III. Quelle
- a. Quellenkontext
- b. Quellenanalyse
- c. Bewertung und Rollendiskussion
- d. Nach Ephesus
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert einen Brief von Galla Placidia an Theodosius II. über das zweite Konzil von Ephesus (449). Die Zielsetzung ist die chronologische Einordnung und Analyse des Briefes im Kontext der damaligen kirchenpolitischen Auseinandersetzungen. Zusätzlich wird die Rolle Galla Placidias als kaiserliche Frau beleuchtet.
- Das zweite Konzil von Ephesus und seine Beschlüsse
- Die Rolle Galla Placidias und der weströmischen Politik
- Die christologischen Streitfragen des 5. Jahrhunderts
- Der Einfluss der Patriarchen auf die kirchlichen Entscheidungen
- Die Bedeutung externer Quellen für die Rekonstruktion der Ereignisse
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext des Briefes von Galla Placidia. Sie erläutert die Herausforderungen der frühen Kirche im Umgang mit abweichenden dogmatischen Positionen und die zunehmende Bedeutung der Konzilien zur Klärung christologischer Streitfragen. Die Arbeit fokussiert sich auf den Brief als Quelle zur Rekonstruktion der Ereignisse um das zweite Konzil von Ephesus, und stellt die Bedeutung dieser Quelle in Relation zu anderen Quellen, wie z.B. den Akten des Konzils von Chalkedon. Die Rolle Galla Placidias als kaiserliche Frau wird als weiterer Aspekt des Briefes angekündigt.
II. Historischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den Weg zum zweiten Konzil von Ephesus. Es beginnt mit den ökumenischen Konzilien in Nicäa (325) und skizziert die Entwicklung der christologischen Debatten im 4. und 5. Jahrhundert. Die zentralen Streitpunkte zwischen Miaphysiten und Dyophysiten werden detailliert dargestellt, ebenso die Rolle der Patriarchen von Alexandria und Konstantinopel. Besondere Aufmerksamkeit wird der Auseinandersetzung zwischen Eutyches und Nestorius gewidmet und deren Konsequenzen für das erste Konzil von Ephesus (431) und die darauf folgenden Ereignisse erläutert, die schließlich zum zweiten Konzil von Ephesus führten. Der Abschnitt zeigt die Komplexität der kirchenpolitischen und theologischen Verwicklungen, die zum Konzil führten.
Schlüsselwörter
Konzil von Ephesus, Galla Placidia, Theodosius II., Christologie, Miaphysitismus, Dyophysitismus, Nestorius, Eutyches, Kirchenpolitik, Kaiserreich, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse eines Briefes von Galla Placidia an Theodosius II. über das zweite Konzil von Ephesus (449)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert einen Brief von Galla Placidia an Theodosius II. Der Brief behandelt das zweite Konzil von Ephesus (449) und wird im Kontext der damaligen kirchenpolitischen Auseinandersetzungen eingeordnet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle Galla Placidias als kaiserliche Frau.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das zweite Konzil von Ephesus und seine Beschlüsse, die Rolle Galla Placidias und der weströmischen Politik, die christologischen Streitfragen des 5. Jahrhunderts, den Einfluss der Patriarchen auf kirchliche Entscheidungen und die Bedeutung externer Quellen für die Rekonstruktion der Ereignisse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Kontext (inkl. des Weges nach Ephesus und dem Konzil von Ephesus 449), ein Kapitel zur Quelle (inkl. Quellenkontext, -analyse, Bewertung und Rollendiskussion, sowie der Zeit nach Ephesus) und ein Fazit.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext des Briefes und erläutert die Herausforderungen der frühen Kirche im Umgang mit abweichenden dogmatischen Positionen und die Bedeutung der Konzilien. Sie fokussiert sich auf den Brief als Quelle zur Rekonstruktion der Ereignisse um das zweite Konzil von Ephesus und stellt dessen Bedeutung im Vergleich zu anderen Quellen (z.B. Akten des Konzils von Chalkedon) dar. Die Rolle Galla Placidias wird ebenfalls angekündigt.
Was wird im Kapitel zum historischen Kontext behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Weg zum zweiten Konzil von Ephesus, beginnend mit den Konzilien in Nicäa (325). Es skizziert die Entwicklung christologischer Debatten im 4. und 5. Jahrhundert, die Streitpunkte zwischen Miaphysiten und Dyophysiten, die Rolle der Patriarchen von Alexandria und Konstantinopel, sowie die Auseinandersetzung zwischen Eutyches und Nestorius und deren Folgen für das erste Konzil von Ephesus (431).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Konzil von Ephesus, Galla Placidia, Theodosius II., Christologie, Miaphysitismus, Dyophysitismus, Nestorius, Eutyches, Kirchenpolitik, Kaiserreich, Quellenkritik.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet den Brief von Galla Placidia an Theodosius II. als primäre Quelle. Zusätzlich werden weitere Quellen, wie z.B. die Akten des Konzils von Chalkedon, zur Einordnung und Kontextualisierung herangezogen. Die Arbeit beinhaltet eine Quellenkritik und -analyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist die chronologische Einordnung und Analyse des Briefes im Kontext der damaligen kirchenpolitischen Auseinandersetzungen. Zusätzlich wird die Rolle Galla Placidias als kaiserliche Frau beleuchtet.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit der Kirchengeschichte des 5. Jahrhunderts, der Rolle von Frauen im spätantiken Kaiserreich und der Quellenkritik auseinandersetzt.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Das Konzil von Ephesus 449 im Brief Galla Placidias an Theodosius II., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/882758