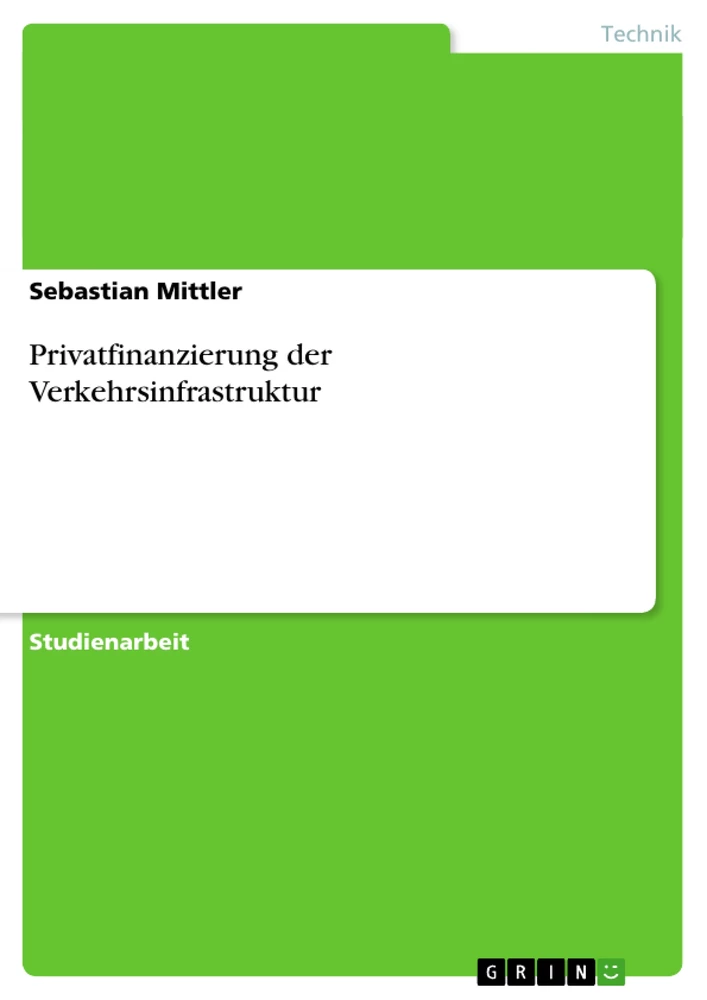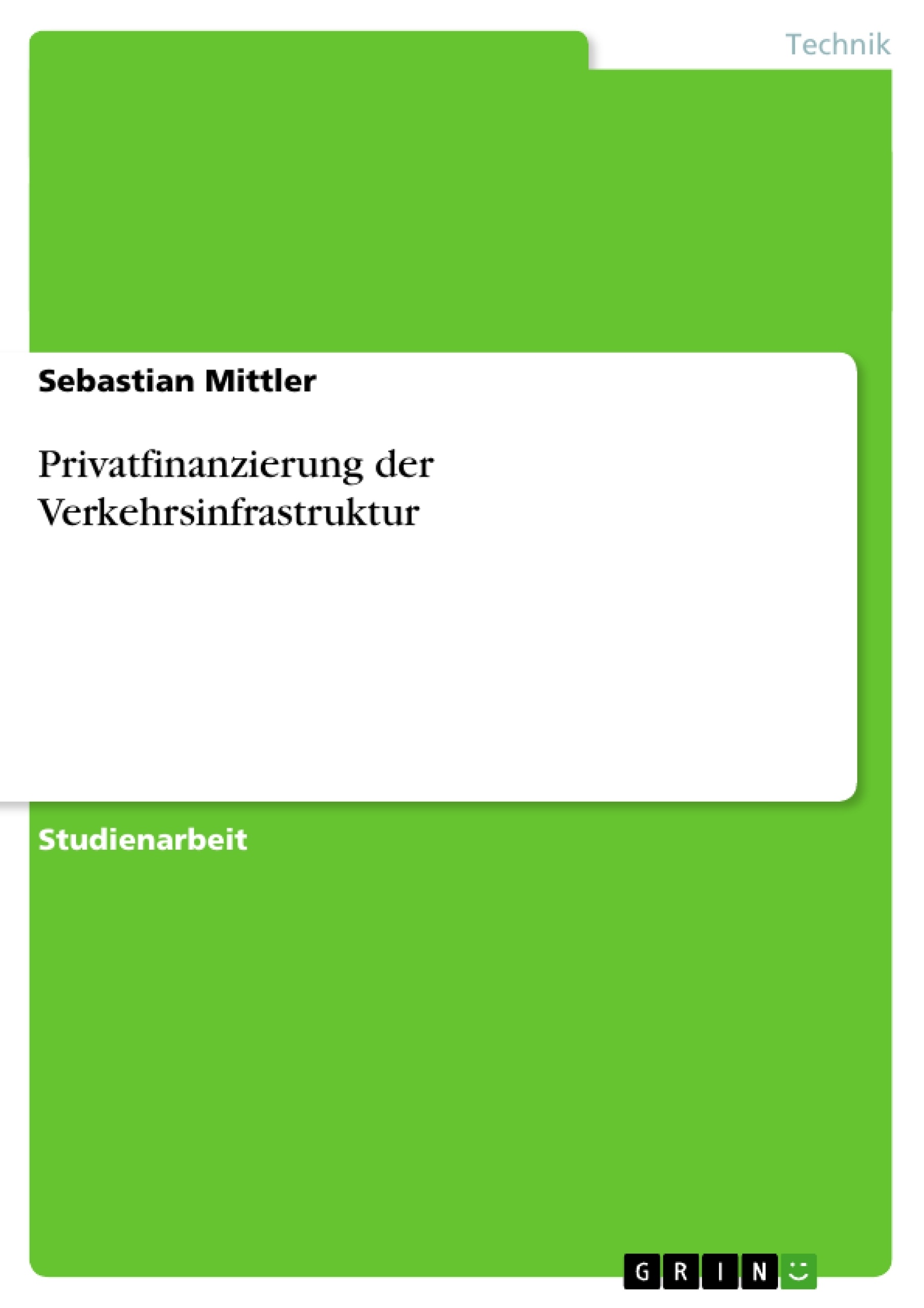Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist eine tragende Komponente
moderner Volkswirtschaften und die Grundlage wirtschaftlichen Wachstums.
Durch die Verkehrsinfrastruktur werden innerhalb eines Landes Ballungsräume
miteinander verbunden. Standorte, welche in unzureichendem Maße an eine
funktionierende und effiziente Verkehrsinfrastruktur angebunden sind, verlieren an
Attraktivität. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur bildet die Grundlage für
Arbeitsteilung, Standortdifferenzierung und den Handel.
Im Zuge knapper Haushalte stellt sich jedoch zunehmend die Frage, ob die
Verkehrsinfrastruktur wie bisher über staatliche Haushalte finanziert werden kann,
oder ob über neue privatwirtschaftliche Konzepte und deren Leistungsfähigkeit
nachgedacht werden muß.Je nach Art des benutzten Verkehrsweges läßt sich die Verkehrsinfrastruktur nach
den verschiedenen Verkehrsträgern unterscheiden. Diese werden abgegrenzt in:
- Straßenverkehr,
- Schienenverkehr,
- Luftverkehr,
- Binnenschiffahrt.
Die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur wird im Bundesverkehrswegeplan
festgelegt. Dem Luftverkehr kommt hier eine Sonderrolle zu, da sich die Flughäfen
grundsätzlich selber finanzieren. Sie sind keine Bundesverkehrswege und somit
kein Bestandteil der Bundesverkehrswegeplanung. Deshalb soll der Luftverkehr in
dieser Betrachtung vernachlässigt werden.
Ein weiteres Kriterium bildet das Transportobjekt, welches auf dem Verkehrsträger
transportiert wird. Man unterscheidet hierbei in:
- Güterverkehr,
- Personenverkehr,
- Nachrichtenverkehr.
Als Argument für die staatliche Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur wird
angeführt, daß es sich um ein öffentliches Gut handelt, welches die staatliche
Bereitstellung erforderlich macht. Die Marktregulierung - also die staatliche
Intervention in das Marktgeschehen - wird als Instrument gegen Marktversagen
angeführt.
Gemäß der Theorie der öffentlichen Güter dienen als Unterscheidungskriterien
externe Effekte, Ausschlußprinzip und Nichtrivalität der Nachfrager. Im
Verkehrssektor wird mit der besonderen Bedeutung externer Effekte in der
Transportwirtschaft, der den Verkehrsmärkten anwohnenden Tendenz zu
ruinösem Wettbewerb und der Existenz von natürlichen Monopolen argumentiert.
Allerdings treffen die Kriterien des öffentlichen Gutes weder für die
Verkehrsinfrastrukturleistungen, noch für die Verkehrsträger zu.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Verkehrsinfrastruktur
- 3. Argumente für eine staatliche Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur
- 4. Bisherige Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland
- 4.1 Haushaltsfinanzierung über Mineralölsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ökosteuer und Solidaritätsbeitrag
- 4.2 Öffentliche Kreditfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur
- 4.3 Gebührenfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur
- 4.4 Finanzierung der einzelnen Verkehrsträger
- 4.4.1 Binnenschiffahrt
- 4.4.2 Schienenverkehr
- 4.4.3 Straßenverkehr
- 5. Gründe für einen Wandel von der staatlichen Verkehrsinfrastrukturfinanzierung hin zur Privatfinanzierung
- 6. Privatfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland
- 6.1 Konzessionsmodelle
- 6.2 Betreibermodelle
- 6.3 Private Public Partnership-Modelle
- 6.4 Privatfinanzierung der einzelnen Verkehrsträger
- 6.4.1 Binnenschiffahrt
- 6.4.2 Schienenverkehr
- 6.4.3 Straßenverkehr
- 6.4.3.1 Öffentliche Finanzierung durch zeitbezogene Gebühr
- 6.4.3.2 Private Vorfinanzierung
- 6.4.3.3 Betreibermodelle: A-Modell und F-Modell
- 6.4.3.4 Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in der Straßenverkehrsinfrastruktur
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Ziel ist es, die Argumente für eine staatliche Bereitstellung gegenüber privatwirtschaftlichen Finanzierungsmodellen abzuwägen und den aktuellen Stand der Privatfinanzierung im deutschen Kontext zu analysieren. Dabei werden verschiedene Finanzierungsmodelle und deren Anwendung auf unterschiedliche Verkehrsträger beleuchtet.
- Staatliche vs. private Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur
- Analyse verschiedener Finanzierungsmodelle (Konzessionsmodelle, Betreibermodelle, PPP)
- Bewertung der Anwendbarkeit der Modelle auf verschiedene Verkehrsträger (Straßen-, Schienen-, Wasserverkehr)
- Wirtschaftliche und politische Aspekte der Infrastrukturfinanzierung
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur ein und hebt deren Bedeutung für moderne Volkswirtschaften hervor. Sie stellt die zentrale Frage nach der zukünftigen Finanzierung angesichts knapper öffentlicher Haushalte und der Notwendigkeit, alternative privatwirtschaftliche Konzepte zu prüfen.
2. Grundlagen der Verkehrsinfrastruktur: Dieses Kapitel definiert die Verkehrsinfrastruktur anhand verschiedener Verkehrsträger (Straßen-, Schienen-, Luft- und Wasserverkehr) und Transportobjekte (Güter-, Personen- und Nachrichtenverkehr). Der Luftverkehr wird aufgrund seiner spezifischen Finanzierung aus der Betrachtung ausgeschlossen.
3. Argumente für eine staatliche Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur: Dieses Kapitel untersucht die Argumente für eine staatliche Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur, die auf dem Konzept öffentlicher Güter basieren. Es wird kritisch hinterfragt, inwieweit die Verkehrsinfrastruktur tatsächlich als öffentliches Gut einzustufen ist und ob die Argumente für Marktversagen, wie externe Effekte und natürliche Monopole, die staatliche Regulierung tatsächlich rechtfertigen. Es kommt zu dem Schluss, dass die Argumente für eine umfassende staatliche Regulierung oftmals nicht stichhaltig sind und häufig ein "Staatsversagen" vorliegt. Ausnahmen werden allerdings genannt, z.B. das natürliche Monopol der Bahninfrastruktur.
4. Bisherige Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die derzeitige Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Es beleuchtet verschiedene Finanzierungsmethoden, darunter Haushaltsfinanzierung (Mineralölsteuer, Kraftfahrzeugsteuer etc.), öffentliche Kreditfinanzierung und Gebührenfinanzierung, und untersucht die Finanzierung der einzelnen Verkehrsträger im Detail.
5. Gründe für einen Wandel von der staatlichen Verkehrsinfrastrukturfinanzierung hin zur Privatfinanzierung: Das Kapitel beleuchtet die Gründe, die einen Wandel von der staatlichen hin zu einer privaten Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur begünstigen. Hierbei werden die knappen öffentlichen Haushalte und die damit verbundene Notwendigkeit der Suche nach alternativen Finanzierungsquellen im Fokus stehen.
6. Privatfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Modelle der Privatfinanzierung von Verkehrsinfrastruktur in Deutschland, darunter Konzessionsmodelle, Betreibermodelle und Public-Private-Partnerships (PPP). Es untersucht die Anwendung dieser Modelle auf die verschiedenen Verkehrsträger und präsentiert detaillierte Beispiele, insbesondere für den Straßenverkehr (zeitbezogene Gebühren, private Vorfinanzierung, A- und F-Modelle). Der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Straßenverkehr wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Privatfinanzierung, Verkehrsinfrastruktur, Deutschland, staatliche Finanzierung, Konzessionsmodelle, Betreibermodelle, Public-Private-Partnerships (PPP), öffentliche Güter, externe Effekte, Marktversagen, Straßenverkehr, Schienenverkehr, Binnenschiffahrt, Haushaltsfinanzierung, Gebührenfinanzierung, ökonomische Effizienz, Nachhaltigkeit.
FAQ: Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument analysiert die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Es vergleicht staatliche und private Finanzierungsmodelle, untersucht verschiedene Finanzierungsmethoden und deren Anwendung auf unterschiedliche Verkehrsträger (Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr), und beleuchtet zukünftige Entwicklungen.
Welche Finanzierungsmodelle werden behandelt?
Das Dokument behandelt sowohl die staatliche Finanzierung (Haushaltsfinanzierung über Mineralölsteuer, Kraftfahrzeugsteuer etc., öffentliche Kreditfinanzierung, Gebührenfinanzierung) als auch verschiedene private Finanzierungsmodelle. Zu den privaten Modellen gehören Konzessionsmodelle, Betreibermodelle (A-Modell und F-Modell im Straßenverkehr) und Public-Private-Partnerships (PPP).
Welche Verkehrsträger werden betrachtet?
Der Fokus liegt auf Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr. Der Luftverkehr wird aufgrund seiner spezifischen Finanzierung aus der Betrachtung ausgeschlossen.
Welche Argumente für eine staatliche Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur werden diskutiert?
Das Dokument diskutiert Argumente, die auf dem Konzept öffentlicher Güter basieren, wie Marktversagen aufgrund externer Effekte und natürlicher Monopole. Es hinterfragt kritisch, inwieweit diese Argumente die staatliche Regulierung tatsächlich rechtfertigen und kommt zu dem Schluss, dass die Argumente für eine umfassende staatliche Regulierung oft nicht stichhaltig sind und häufig ein "Staatsversagen" vorliegt. Ausnahmen, wie z.B. das natürliche Monopol der Bahninfrastruktur, werden jedoch genannt.
Warum wird ein Wandel von staatlicher zu privater Finanzierung diskutiert?
Ein wichtiger Grund für die Diskussion um einen Wandel ist die Knappheit öffentlicher Haushalte und die Notwendigkeit, alternative Finanzierungsquellen zu finden.
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Grundlagen der Verkehrsinfrastruktur, Argumente für staatliche Bereitstellung, Bisherige Finanzierung in Deutschland, Gründe für einen Wandel, Privatfinanzierung in Deutschland, und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Privatfinanzierung, Verkehrsinfrastruktur, Deutschland, staatliche Finanzierung, Konzessionsmodelle, Betreibermodelle, Public-Private-Partnerships (PPP), öffentliche Güter, externe Effekte, Marktversagen, Straßenverkehr, Schienenverkehr, Binnenschiffahrt, Haushaltsfinanzierung, Gebührenfinanzierung, ökonomische Effizienz, Nachhaltigkeit.
Was ist das Ziel des Dokuments?
Das Ziel ist es, die Argumente für eine staatliche Bereitstellung gegenüber privatwirtschaftlichen Finanzierungsmodellen abzuwägen und den aktuellen Stand der Privatfinanzierung im deutschen Kontext zu analysieren. Es werden verschiedene Finanzierungsmodelle und deren Anwendung auf unterschiedliche Verkehrsträger beleuchtet.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Finanzierungsmodellen?
Kapitel 6 ("Privatfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland") analysiert detailliert verschiedene Modelle wie Konzessionsmodelle, Betreibermodelle und PPP, inklusive ihrer Anwendung auf die verschiedenen Verkehrsträger und Beispiele, insbesondere für den Straßenverkehr (zeitbezogene Gebühren, private Vorfinanzierung, A- und F-Modelle).
- Citar trabajo
- Sebastian Mittler (Autor), 2005, Privatfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88352