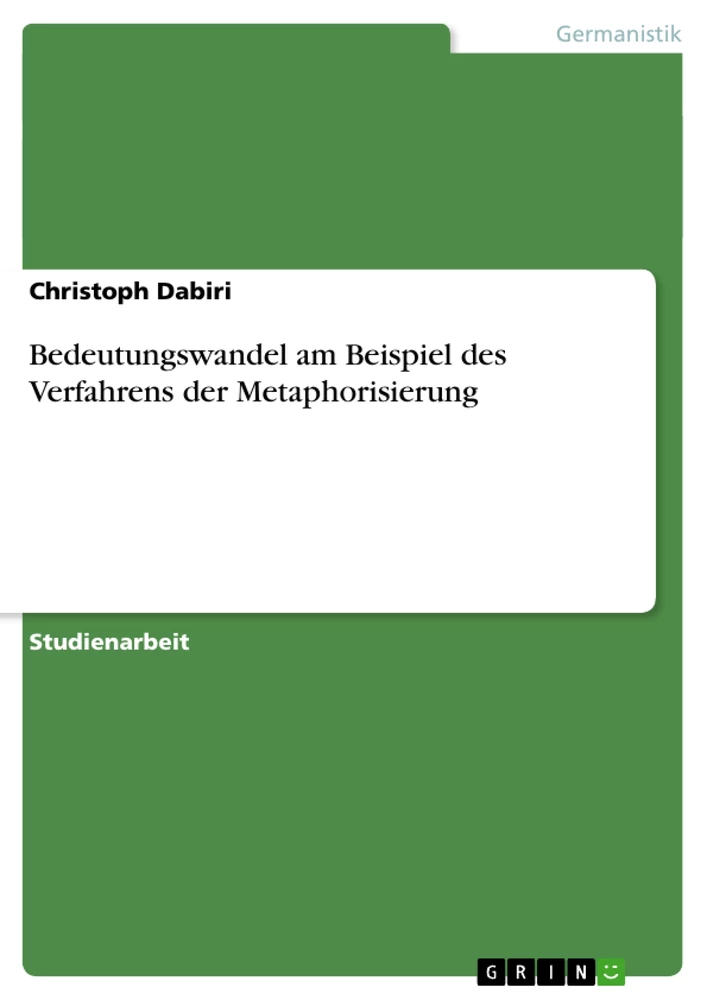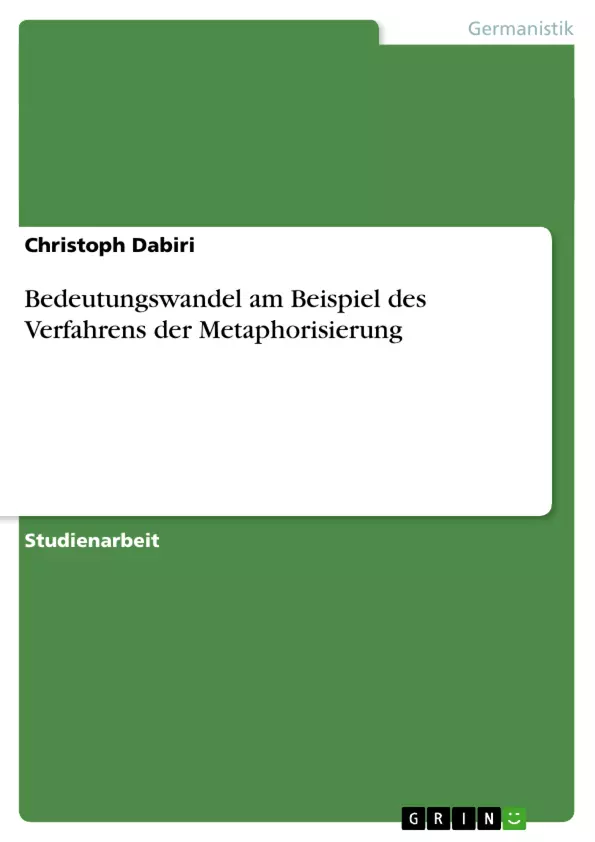Laut ist der Protest jeher, dass unsere Sprache zu verfallen droht. Schon antike Philosophen äußerten sich im Zuge der verbildlichten Sprechweise und taten ihren Unmut kund. In dieser Arbeit möchte ich mich jedoch nicht mit der Frage befassen, ob diese Vermutung falsch oder richtig sei, sondern den Fokus vielmehr auf die Fragestellung konzentrieren, warum diese Besorgnis seit jeher ein solch zeitloses Thema ist. Warum wandelt sich Sprache überhaupt und wie macht sich dies bemerkbar? Um sich mit dieser Frage auseinandersetzen zu können, soll zunächst der sprachliche Wandel im Allgemeinen mit seiner Herkunft definiert werden. Dazu werden verschiedene Interpretationen aus der Literatur von Keller und Kirschbaum, Löbner und Fritz miteinander verglichen und mit gegenwärtigen Beispielen zur Untermauerung der gelieferten Thesen aufgeführt. Im Folgenden sollen die gängigsten und alltäglichsten Formen der Bedeutungsveränderung und –verschiebung benannt und durch kurze Beispiele verdeutlicht werden, um sich anknüpfend daran mit erworbenem Vorwissen dem rhetorischen Mittel der Metapher und ihrer Metaphorisierung zuzuwenden, welches unter besonderem Augenmerk dieser Hausarbeit stehen soll. Unter aristotelischem Blickwinkel ist die philosophische Sichtweise der Metapher sehr kurz anzureißen, um sich mit historischem Hintergrundwissen dem Verfahren der Metaphorisierung in der Gegenwart zu nähern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bedeutungswandel
- 2.1 Wandel innerhalb einer Sprache
- 2.2 Entstehung semantischer Neuerungen
- 2.3 Effizienz von Neuerungssituationen
- 3. Verfahren des Bedeutungswandels
- 3.1 Metonymisches Verfahren
- 3.2 Differenziertes Verfahren
- 3.3 Euphemistisches Verfahren
- 3.4 Ironisches Verfahren
- 4. Metaphorisierung
- 4.1 Metaphertheorien
- 4.2 Metaphorischer Wandel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Bedeutungswandel in der deutschen Sprache. Sie beleuchtet die Ursachen und Prozesse des Wandels und analysiert verschiedene Verfahren, die zu Bedeutungsverschiebungen führen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Metaphorisierung als Methode des Bedeutungswandels.
- Sprachwandel als kontinuierlicher Prozess
- Entstehung semantischer Neuerungen und ihre Ursachen
- Verschiedene Verfahren des Bedeutungswandels (Metonymie, Euphemismus, Ironie)
- Metaphorisierung als bedeutendes Verfahren des Bedeutungswandels
- Effizienzprinzipien bei der sprachlichen Innovation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen und Erscheinungsformen des Sprachwandels. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Autor begründet die Relevanz der Fragestellung mit der seit jeher bestehenden Sorge um den vermeintlichen Verfall der Sprache und kündigt einen vergleichenden Ansatz verschiedener literaturwissenschaftlicher Positionen an, um die Thesen zu untermauern und mit aktuellen Beispielen zu belegen. Der Fokus auf Metaphorisierung als besonderes Verfahren des Bedeutungswandels wird hervorgehoben.
2. Bedeutungswandel: Dieses Kapitel erörtert den Sprachwandel als einen kontinuierlichen und unbewussten Prozess, der alle Aspekte der Sprache betrifft. Es werden Schwierigkeiten bei der Beschreibung aktueller Sprachwandelprozesse beschrieben, da diese unbewusst und ohne direkte Absicht des Sprechers geschehen. Der Autor analysiert die Entstehung semantischer Neuerungen durch fehlerhafte Sprachpraxis und verdeutlicht dies am Beispiel der Konjunktion „weil“. Die Diskussion beinhaltet den möglichen Verfall der Sprache durch systematisch auftretende Fehler und stellt dar, dass dies nicht als Verfall zu bezeichnen ist, da sich die Bedeutung lediglich auf eine andere Ausgangsfrage bezieht. Es werden verschiedene Intentionen des Sprechers hinsichtlich der Verwendung neuer Ausdrucksweisen untersucht. Schließlich wird das Prinzip der Effizienz und der kommunikative Nutzen bei Neuerungssituationen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bedeutungswandel, Sprachwandel, Metaphorisierung, Semantik, Metonymie, Euphemismus, Ironie, Kommunikationsstrategien, Sprachpraxis, Effizienzprinzipien.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Bedeutungswandel in der deutschen Sprache"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Bedeutungswandel in der deutschen Sprache. Sie beleuchtet die Ursachen und Prozesse des Wandels und analysiert verschiedene Verfahren, die zu Bedeutungsverschiebungen führen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Metaphorisierung als Methode des Bedeutungswandels.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt Sprachwandel als kontinuierlichen Prozess, die Entstehung semantischer Neuerungen und deren Ursachen, verschiedene Verfahren des Bedeutungswandels (Metonymie, Euphemismus, Ironie), die Metaphorisierung als bedeutendes Verfahren, und Effizienzprinzipien bei sprachlicher Innovation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Bedeutungswandel, ein Kapitel zu den Verfahren des Bedeutungswandels (inklusive Metonymie, Euphemismus und Ironie), ein Kapitel zur Metaphorisierung und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Das Kapitel zum Bedeutungswandel beschreibt Sprachwandel als kontinuierlichen Prozess und analysiert die Entstehung semantischer Neuerungen. Das Kapitel zu den Verfahren des Bedeutungswandels untersucht verschiedene Mechanismen der Bedeutungsverschiebung. Das Kapitel zur Metaphorisierung beleuchtet dieses Verfahren im Detail.
Welche Verfahren des Bedeutungswandels werden analysiert?
Die Arbeit analysiert metonymische, differenzierte, euphemistische und ironische Verfahren des Bedeutungswandels. Besonderes Augenmerk liegt auf der Metaphorisierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bedeutungswandel, Sprachwandel, Metaphorisierung, Semantik, Metonymie, Euphemismus, Ironie, Kommunikationsstrategien, Sprachpraxis und Effizienzprinzipien.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Aufbau erläutert. Es folgen Kapitel zu Bedeutungswandel, den Verfahren des Bedeutungswandels und der Metaphorisierung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab. Ein Inhaltsverzeichnis ist enthalten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit wird im vorliegenden Auszug nicht explizit genannt, jedoch werden im Kapitel "Zusammenfassung der Kapitel" bereits einige Kernpunkte angedeutet, welche die Hauptargumente der Arbeit zusammenfassen. Weitere Schlussfolgerungen lassen sich aus der Analyse der einzelnen Kapitel ableiten.
- Citar trabajo
- Christoph Dabiri (Autor), 2007, Bedeutungswandel am Beispiel des Verfahrens der Metaphorisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88400