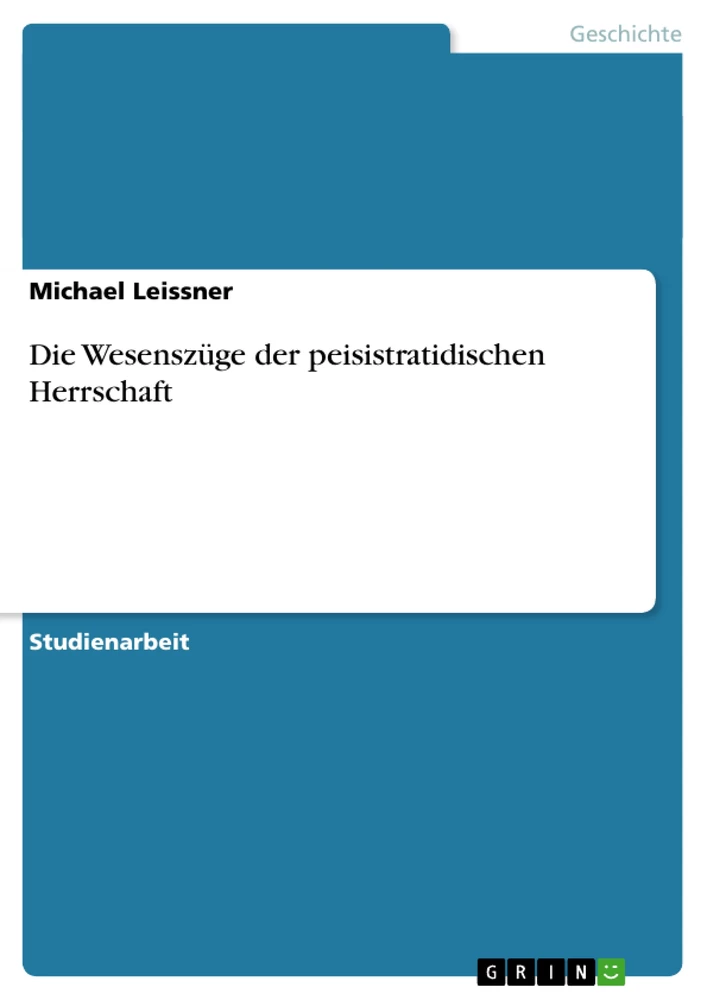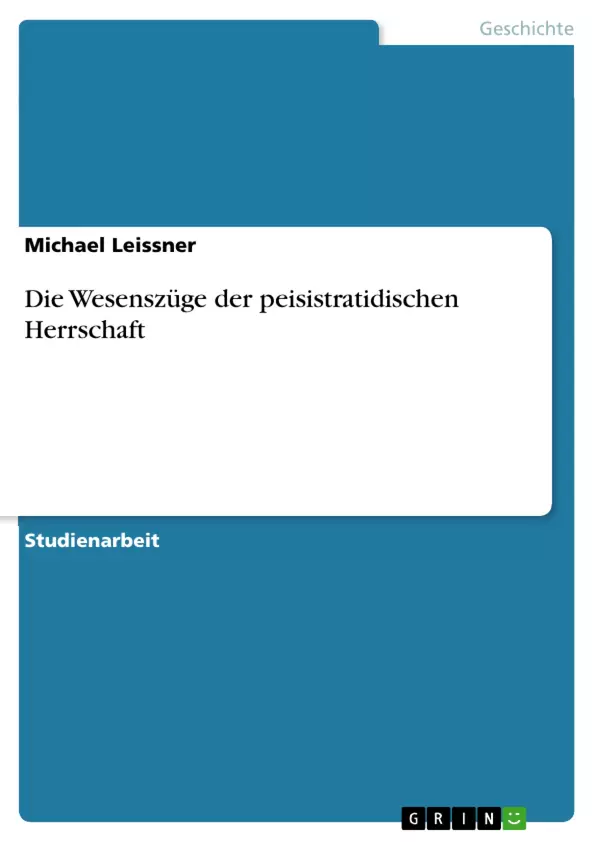In einer Hauptseminararbeit allein auf die Wesenszüge der peisistratidischen Herrschaft in Athen einzugehen, ohne zumindest einige kurze Bemerkungen auf die Quellenlage einzubringen, erschiene dem Verfasser fragwürdig. Denn hier liegen die Grundlagen für jegliche Diskussion der Problematik. So wird zunächst auf die Quellensituation, darauf folgend auf die politische Ausgangssituation des Peisistratos einzugehen sein. Ohne die ist ein Verständnis der Wesenszüge seiner Herrschaft recht schwierig.
Im auffallenden Gegensatz zur Zeit der persischen Kriege und der nachfolgenden Ereignisse der athenischen Geschichte sind für die Zeit des sechsten Jahrhunderts schriftliche Zeugnisse kaum überliefert. Es gibt keinen einzigen Augenzeugenbericht bis zur Zeit des Aischylos und seiner Werke ein gutes Jahrhundert später, abgesehen von ein paar autobiographischen Fragmenten Solons.
Zusammenfassend wird nun auf diese wenigen, aber umso wichtigeren Quellen eingegangen.
Solon ist der erste Athener, dessen Persönlichkeit für die Forschung greifbar ist, vor allem dank seiner überlieferten Gedichte, aber auch der von Plutarch verfassten Biographie. Letztere stützt sich allerdings eindeutig auf frühere Quellen.
Für die zwei Jahrzehnte nach Solons Rückzug aus der Politik - ca. 580 bis 560 v. Chr. - weiß man wenig über die athenische Geschichte. Und für die nachfolgenden fünfzig Jahre, die von Peisistratos und seinen Söhnen (abgesehen von zwei Perioden im Exil) dominiert wurden, ist die originäre Quellensituation nicht viel besser.
Die früheste Quelle, die sich en détail mit den Tyrannen beschäftigt hat, ist das Werk des Herodotos von Harlikarnassos, der ungefähr 150 Jahre später als Solon schrieb. Herodots Abhandlung ist leider keine zusammenhängende Darstellung. Die längste geschlossene Passage, die sich mit Peisistratos auseinandersetzt (1.59-1.64), endet mit dem erfolgreichen dritten Versuch der Errichtung einer Tyrannis im Jahr 546 v. Chr.. anschließend erfolgen nur noch vereinzelte Erwähnungen von Peisistratos und seinen Söhnen.
Inhaltsverzeichnis
- Eine Einleitung: Die Tyrannis der Peisistratiden im Spiegelbild antiker Quellen
- Die Ausgangssituation
- Der Weg zur Macht
- Der Machterhalt
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wesenszüge der Herrschaft der Peisistratiden in Athen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Quellenlage, der politischen Ausgangslage, des Weges zur Macht, des Machterhalts und der wichtigsten Aspekte der Tyrannis selbst. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Peisistratiden für die Entwicklung Athens.
- Analyse der Quellenlage zur peisistratidischen Herrschaft
- Untersuchung der politischen Ausgangslage in Athen vor der Machtübernahme der Peisistratiden
- Analyse des Weges der Peisistratiden zur Macht
- Beurteilung der Methoden des Machterhalts und der Machtausübung durch die Peisistratiden
- Darstellung der wesentlichen Merkmale und Auswirkungen der peisistratidischen Herrschaft auf Athen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Eine Einleitung: Die Tyrannis der Peisistratiden im Spiegelbild antiker Quellen Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, die Wesenszüge der peisistratidischen Herrschaft zu analysieren, ohne die Quellenlage zu betrachten. Es wird die spärliche schriftliche Überlieferung aus der Zeit des sechsten Jahrhunderts vor Christus diskutiert, wobei vor allem die Bedeutung der Werke von Solon, Herodot, Thukydides und Aristoteles hervorgehoben wird.
- Kapitel 2: Die Ausgangssituation Dieses Kapitel untersucht die politische Situation in Athen vor der Machtübernahme der Peisistratiden. Es befasst sich mit dem Zustand der Stadt nach den Reformen des Solon und der Spannungen, die zu der Instabilität führten, die der Herrschaft der Peisistratiden den Weg ebnete.
- Kapitel 3: Der Weg zur Macht Dieses Kapitel beleuchtet den Aufstieg der Peisistratiden zur Macht. Es analysiert die Strategien, die Peisistratos für seine Machtübernahme einsetzte, und die Rolle seiner Gegner und Verbündeten.
- Kapitel 4: Der Machterhalt Dieses Kapitel untersucht die Methoden, mit denen die Peisistratiden ihre Herrschaft festigten und sicherstellten, dass sie die Kontrolle über Athen behielten. Es analysiert die politischen und sozialen Strategien, die sie einsetzten, um die Macht zu sichern und die Opposition zu kontrollieren.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Begriffe und Themen dieser Arbeit sind die peisistratidische Herrschaft, Athen, Tyrannis, Quellenlage, politische Ausgangslage, Machterwerb, Machterhalt, soziale und politische Reformen, politische Stabilität, politische Opposition. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Wesenszüge der peisistratidischen Herrschaft und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung Athens.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Peisistratiden?
Die Peisistratiden waren eine Herrscherfamilie im antiken Athen, begründet durch Peisistratos, der im 6. Jahrhundert v. Chr. die Tyrannis errichtete und sie an seine Söhne weitergab.
Wie erlangte Peisistratos die Macht in Athen?
Peisistratos benötigte drei Anläufe. Er nutzte soziale Spannungen nach den solonischen Reformen aus und stützte sich auf die Landbevölkerung sowie eine persönliche Leibwache, um seine Herrschaft zu etablieren.
Welche Quellen berichten über die peisistratidische Herrschaft?
Die wichtigsten Quellen sind Herodot, Thukydides und Aristoteles. Da sie jedoch erst Jahrzehnte oder Jahrhunderte später schrieben, ist die Quellenlage kritisch zu bewerten.
Wie sicherte Peisistratos seinen Machterhalt?
Er verfolgte eine Politik des inneren Friedens, förderte die Landwirtschaft und den Handel und hielt sich formal an die bestehenden Gesetze Solons, während er die Schlüsselpositionen mit Vertrauten besetzte.
Welche Bedeutung hatte die Tyrannis für die Entwicklung Athens?
Trotz des negativen Beigeschmacks der „Tyrannis“ brachte die Zeit der Peisistratiden Athen wirtschaftliche Stabilität und kulturelle Blüte, was den späteren Aufstieg zur Demokratie und Großmacht vorbereitete.
- Quote paper
- Michael Leissner (Author), 2002, Die Wesenszüge der peisistratidischen Herrschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8847