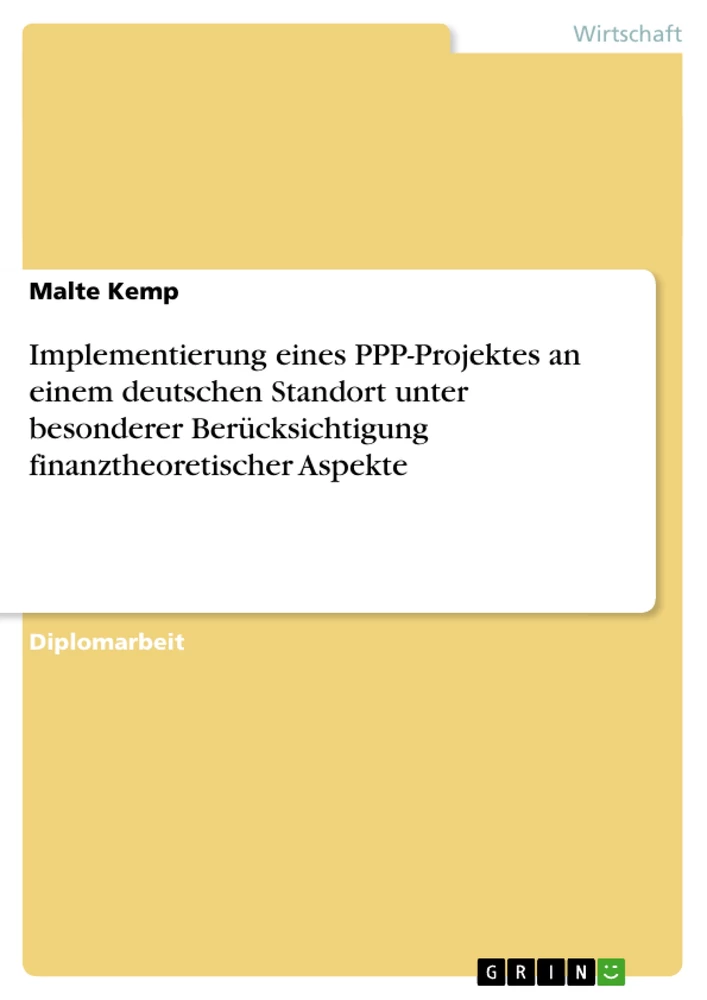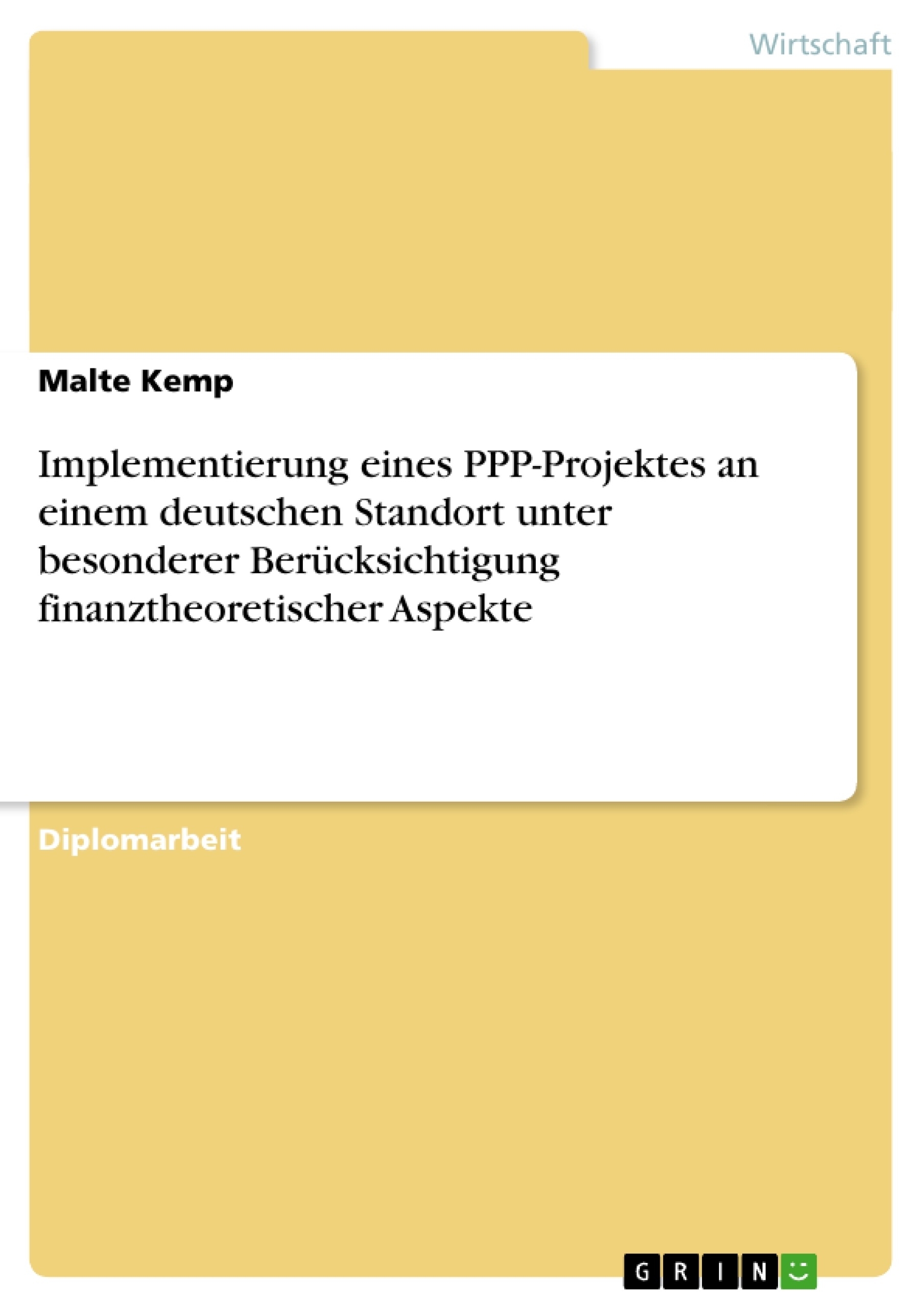Im Rahmen dieser Arbeit wird ausschließlich PPP im öffentlichen Hochbau betrachtet. Besonders in der jüngeren Vergangenheit hat dieser Teilbereich auf bundes- und landespolitischer Ebene sehr viel Unterstützung gefunden. So wurden in den Finanzministerien Kompetenzteams eingerichtet und eine Vielzahl von unterstützendem und begleitendem Material zur Verfügung gestellt. Dies liegt vor allem an dem erheblichen Potential, welches in diesem Bereich vermutet wird. Bestätigt wird diese Tendenz durch das beim Hauptverband der deutschen Bauindustrie erwartetem Investitionsvolumen von 6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2009 – seit 2002 sind schon 800 Millionen Euro in den öffentlichen Hochbau mittels PPP investiert worden (Stand August 2006). Vor dem Hintergrund eines derart zunehmenden Marktes sind viele Beteiligte vor Euphorie kaum noch zu bremsen. Gleichwohl gibt es kritische und mahnende Stimmen, die zur Vorsicht und Zurückhaltung aufrufen. Sind diese Leute bloß Pessimisten, die sich vor dem Fortschritt fürchten und neue Entwicklungen scheuen oder sind es die Einzigen, die bei dem ganzen Enthusiasmus einen kühlen Kopf bewahren? Eine Beantwortung dieser Frage ist zurzeit schwer möglich, aber eine Analyse der finanztheoretischen Aspekte bei der Implementierung von PPP an einem deutschen Standort (Projekt Bismarckschule in Leverkusen) kann dazu dienen, der Antwort ein Stück näher zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltliche Einführung
- Gang der Untersuchung
- Problemstellung und Relevanz
- Problemdefinition
- Definition von Public Private Partnership
- Historischer Hintergrund von Public Private Partnership
- Ansprüche an Public Private Partnership
- Relevanz und Motivation von Public Private Partnership in der heutigen Gesellschaft
- Methodologien
- Angewandte Sekundärquellen
- Angewandte Literatur
- Untersuchte und Entwickelte Daten
- Entwickelte Primärquellen
- Geführte Interviews
- Statistische Erhebung
- Theorien
- Relevante Theorien
- Neoinstitutionelle Theorien
- Hintergrund zu den Neoinstitutionellen Theorien
- Die Transaktionskostentheorie
- Prinzipal-Agenten-Theorie
- Property Rights-Theorie
- Projektfinanzierungsmodelle
- Allgemeine Beschreibung von Projektrisiken
- Ausgewählte Theorieelemente
- Ausprägungen der Prinzipal-Agenten-Theorie
- Relevante Projektfinanzierungsmodelle
- Relevante Projektrisiken
- Das Public Private Partnership – Projekt Bismarckschule
- Darstellung des Projektes Bismarckschule
- Anwendung der Theorieelemente
- Elemente der Prinzipal-Agenten-Theorie
- Elemente der Projektfinanzierungsmodelle
- Elemente der Risikobetrachtung
- Interpretation der Methodologie
- Falllösung des Public Private Partnership – Projektes Bismarckschule
- Fazit, Kritische Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Implementierung eines Public Private Partnership (PPP)-Projektes an einem deutschen Standort. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der finanziellen Aspekte des PPP-Modells. Die Arbeit soll einen umfassenden Überblick über die Theorie und Praxis von PPP-Projekten im deutschen Kontext bieten und die Herausforderungen und Chancen dieses Modells beleuchten.
- Definition und Historische Entwicklung von Public Private Partnership
- Relevanz und Motivation von PPP-Projekten in der heutigen Gesellschaft
- Anwendung von relevanten Theorien, wie den Neoinstitutionellen Theorien, der Prinzipal-Agenten-Theorie und der Property Rights-Theorie
- Analyse von Projektrisiken und relevanten Projektfinanzierungsmodellen
- Fallstudie: Implementierung eines PPP-Projektes an der Bismarckschule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema PPP-Projekte ein und skizziert die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Die Problemstellung und Relevanz beleuchtet die Definition und den historischen Hintergrund von PPP-Projekten, sowie deren Relevanz in der heutigen Gesellschaft. Im Kapitel "Theorien" werden wichtige Theorieelemente, wie die Neoinstitutionellen Theorien, die Prinzipal-Agenten-Theorie und die Property Rights-Theorie vorgestellt. Die Arbeit untersucht außerdem ausgewählte Projektfinanzierungsmodelle und wichtige Projektrisiken. Das Kapitel "Das Public Private Partnership – Projekt Bismarckschule" befasst sich mit der Fallstudie der Bismarckschule und analysiert die Anwendung der zuvor vorgestellten Theorieelemente. Abschließend werden in einem Fazit die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
Schlüsselwörter
Public Private Partnership, Projektfinanzierung, Neoinstitutionelle Theorien, Prinzipal-Agenten-Theorie, Property Rights-Theorie, Projektrisiken, Fallstudie, Bismarckschule
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit über PPP-Projekte?
Die Arbeit analysiert die Implementierung von Public Private Partnership (PPP)-Projekten in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung finanztheoretischer Aspekte.
Welche Fallstudie wird in der Untersuchung herangezogen?
Als praktisches Beispiel dient die Implementierung des PPP-Projektes an der Bismarckschule in Leverkusen.
Welche Theorien werden zur Analyse der PPP-Projekte genutzt?
Es werden neoinstitutionelle Theorien angewendet, insbesondere die Transaktionskostentheorie, die Prinzipal-Agenten-Theorie und die Property-Rights-Theorie.
Warum ist der öffentliche Hochbau für PPP-Modelle besonders relevant?
Der Bereich weist ein erhebliches Investitionspotenzial auf, wobei bis 2009 ein Volumen von 6 Milliarden Euro im deutschen Markt erwartet wurde.
Welche methodischen Quellen wurden für die Arbeit erschlossen?
Die Arbeit nutzt sowohl Sekundärquellen (Literatur, Daten) als auch Primärquellen in Form von geführten Interviews und statistischen Erhebungen.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Kaufmann (FH) Malte Kemp (Autor:in), 2006, Implementierung eines PPP-Projektes an einem deutschen Standort unter besonderer Berücksichtigung finanztheoretischer Aspekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88545