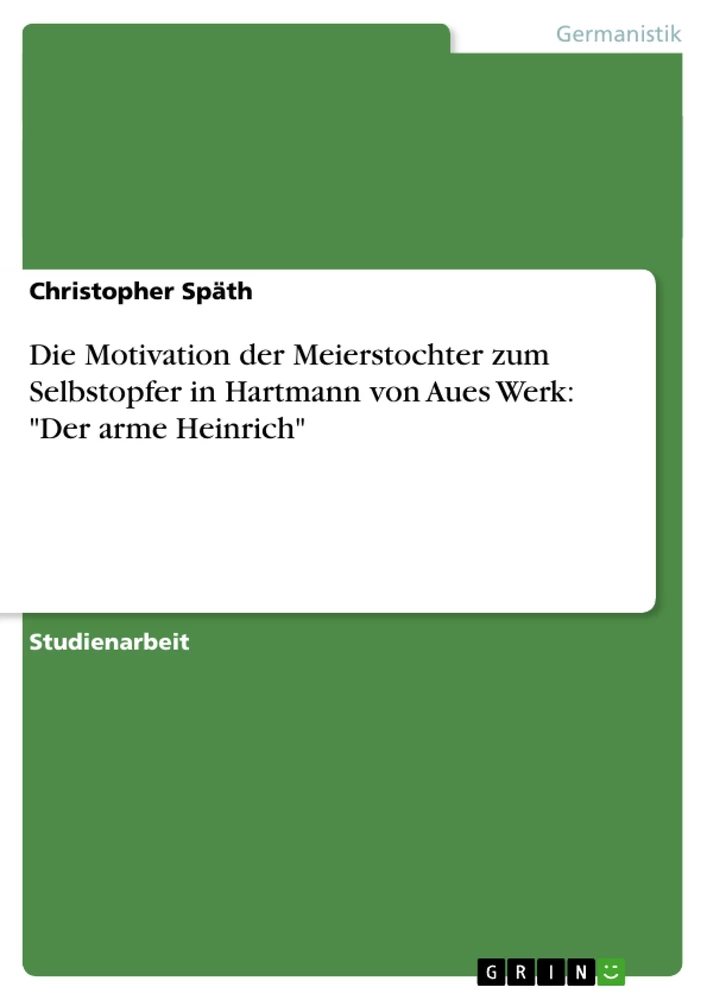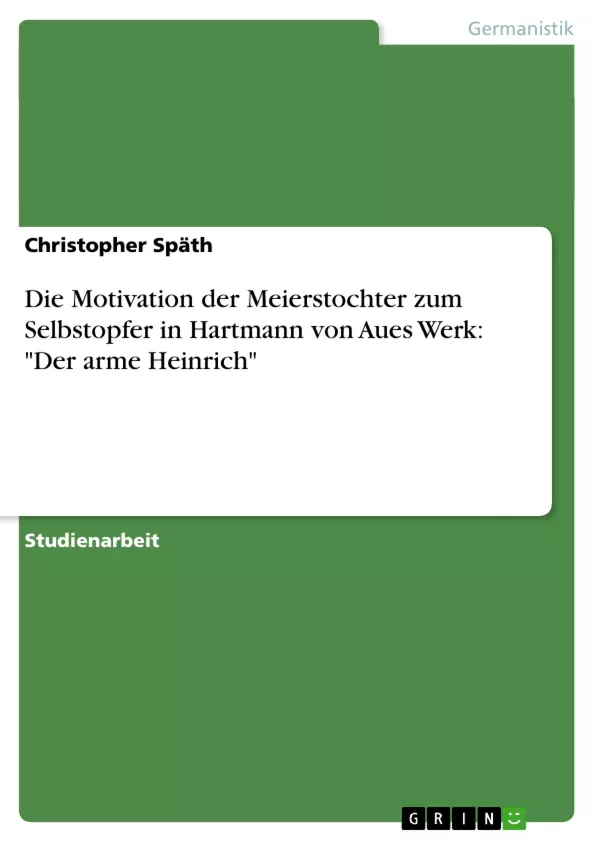Das „Werden des Mannes“ steht in den Epen Hartmann von Aues im Mittelpunkt. Trotzdem sind weibliche Charaktere ein fester Bestandteil in Hartmanns Werken und spielen auch eine tragende Rolle.
Die Epen Hartmanns verlaufen immer nach einem ähnlichen Muster. Der Held fällt durch sein schuldhaftes Leben von der erlangten Scheinhöhe auf einen Tiefpunkt. An diesem muss er durch Umorientierung und Selbstfindung zu einer neuen Lebenseinstellung gelangen, um der ihm von Gott vorgesehene Position gerecht zu werden. Hartmann verdeutlicht, dass die erfolgreiche Suche nach sich selbst „nur in der Selbstaufgabe, in der Beziehung möglich ist.“ Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist für den Reifeprozess des Helden daher von zentraler Bedeutung.
In den Artusromanen und im „Gregorius“ stellt eine Frau die „Initialzündung“ für die weitere Handlung dar. Die Scheinhöhe ist erreicht, wenn erstmals erfolgreich um die Frau geworben wurde. Der „Arme Heinrich“ fällt aus diesem Schema heraus, denn der Held trifft erst nach seinem Fall, der Erkrankung am Aussatz, auf die Meierstochter. Erst durch das aufopferungsvolle Verhalten der Heldin ist es Heinrich möglich, die Erkrankung zu überwinden und sich als neu legitimierter Herrscher zu installieren. Im Vergleich zu den Frauengestalten in den anderen Werken Hartmanns ist die Meierstochter der Figur der Enite aus dem „Erec“ am ähnlichsten. Beide sind zu Beginn Jungfrauen, „noch unter dem Schutz des Vaters stehend“ und greifen erst in der Mitte der Handlung aktiv in das Geschehen ein. Am erneuten Aufstieg des Helden sind sie unmittelbar beteiligt, hat dieser seine höchste Daseinsstufe erreicht, treten sie wieder in den Hintergrund.
Im Folgenden soll nun der Charakter der Meierstochter im „Armen Heinrich“ betrachtet, ihre Rolle in Heinrichs Leben veranschaulicht und auf die Motive ihres Selbstopferungswillens näher eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Figur der Meierstochter und ihre Funktion im „Armen Heinrich“
- 1. Charakterisierung des Mädchens
- 2. Die Rolle der Meierstochter in Heinrichs Leben.
- III. Die Motive der Meierstochter zum Selbstopfer
- 1. Die Existenzsicherung der Familie
- 2. Die Sehnsucht nach der uneingeschränkten Seligkeit
- 3. Ihr Erbarmen für Heinrich und die wahre Liebe zu ihrem Herrn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Motivation der Meierstochter zum Selbstopfer in Hartmann von Aues Werk „Der arme Heinrich“. Der Fokus liegt auf der Analyse der Figur der Meierstochter, ihrer Rolle im Leben des aussätzigen Heinrichs sowie ihren Beweggründen für ihre aufopfernde Handlung.
- Charakterisierung der Meierstochter
- Die Rolle der Meierstochter in Heinrichs Leben
- Die Motive des Selbstopfers
- Die Beziehung zwischen Heinrich und der Meierstochter
- Der Einfluss der Meierstochter auf Heinrichs Genesung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Rolle von Frauengestalten in Hartmanns Werken dar und führt in die Besonderheiten der Figur der Meierstochter im „Armen Heinrich“ ein.
Kapitel II beleuchtet die Figur der Meierstochter und ihre Funktion im Epos. Hier wird die Charakterisierung des Mädchens anhand von Textstellen beschrieben und die Beziehung zwischen ihr und Heinrich analysiert.
Kapitel III befasst sich mit den Motiven der Meierstochter zum Selbstopfer. Es werden verschiedene Faktoren wie die Existenzsicherung der Familie, die Sehnsucht nach Seligkeit und die Liebe zu Heinrich analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der mittelalterlichen Literatur, der höfischen Minne, der Figurenanalyse, des christlichen Glaubens, des Selbstopfers, der sozialen Verhältnisse und der Rolle von Frauengestalten in mittelalterlichen Epen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Hartmann von Aues „Der arme Heinrich“?
Das Werk erzählt die Geschichte des Ritters Heinrich, der an Aussatz erkrankt und nur durch das freiwillige Herzblut einer Jungfrau geheilt werden kann.
Was motiviert die Meierstochter zu ihrem Selbstopfer?
Ihre Motive sind vielfältig: die Existenzsicherung ihrer Familie, die Sehnsucht nach ewiger Seligkeit im Jenseits sowie ihr tiefes Erbarmen und die Liebe zu ihrem Herrn.
Wie unterscheidet sich die Meierstochter von anderen Frauenfiguren Hartmanns?
Im Gegensatz zu anderen Figuren trifft sie den Helden erst nach seinem tiefen Fall und spielt eine aktive, rettende Rolle in seinem Reifeprozess.
Welche Rolle spielt die Selbstaufgabe in Hartmanns Epen?
Hartmann verdeutlicht, dass die erfolgreiche Suche nach sich selbst oft nur durch Selbstaufgabe und die Beziehung zu anderen Menschen möglich ist.
Warum wird die Meierstochter mit Enite aus „Erec“ verglichen?
Beide Figuren beginnen als unschuldige Jungfrauen und greifen erst in der Mitte der Handlung entscheidend ein, um den Aufstieg des Helden zu ermöglichen.
- Quote paper
- Christopher Späth (Author), 2006, Die Motivation der Meierstochter zum Selbstopfer in Hartmann von Aues Werk: "Der arme Heinrich", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88581