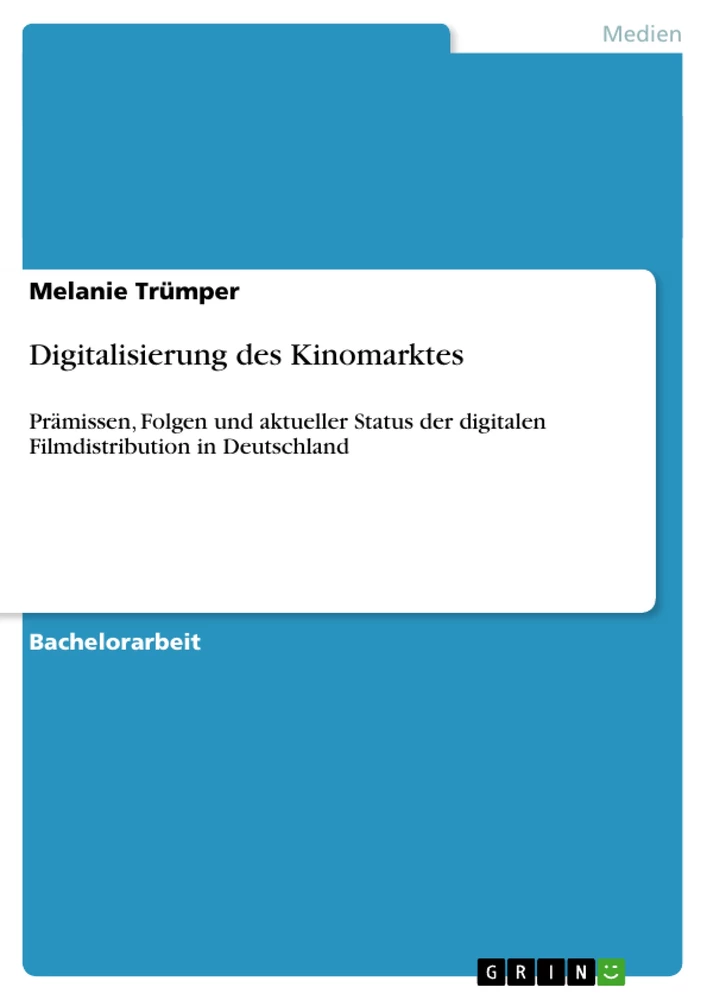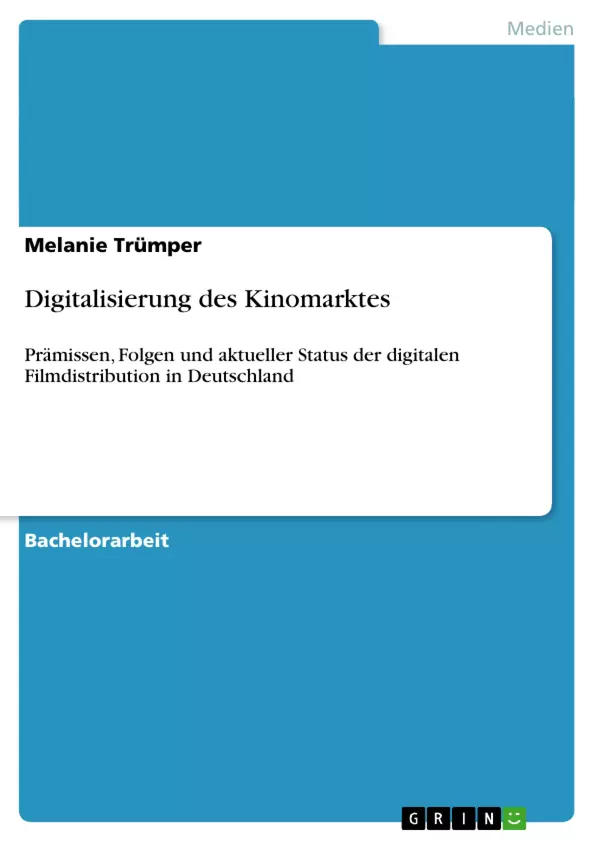Das Kino ist eines der letzten weitestgehend analog funktionierenden Medien im 21. Jahrhundert. Doch auch das soll sich ändern: Die komplette Digitalisierung der Wertschöpfungskette Kinofilm von der Produktion und Postproduktion über die Distribution bis hin zur Projektion verspricht zu einer Revolution des Kinos seit der Erfindung des Tonfilms zu werden, da er die Abkehr vom analogen, seit über 100 Jahren bewährten 35mm-Film bedeutet.
In Zukunft sollen Kinofilme nur noch als Bits und Bytes per Satellit, Breitbandkabelverbindung oder auf Datenträgern statt als schwere und teure Filmrollen durch die Lande geschickt werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und mehr Flexibilität für Produzenten, Filmverleihe und Kinos führen soll. Durch die digitale Distribution einschließlich der Projektion eröffnen sich für Kinobetreiber, Werbemittler und -kunden neue Einnahmequellen dank der möglichen Programm- und Angebotserweiterung um alternative Inhalte und Nutzungsmodelle sowie flexiblere Werbemöglichkeiten.
Letztlich wird sich das digitale Kino durch eine verbesserte Vorführqualität und vielfältigere Programmgestaltung auch beim Publikum bemerkbar machen. Theoretisch könnten also alle Marktteilnehmer und Kinobesucher vom digitalen Kinoerlebnis nur profitieren, wenn es nicht mindestens genauso viele Nachteile wie Vorteile bei der Umstellung auf die neue Technologie gäbe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Prinzip und Technologie des digitalen Kinos
- Begriffsbestimmung D- und E-Cinema
- Funktionsweise des digitalen Kinos
- Filmproduktion und -distribution
- IT-Infrastruktur und Projektion im Kino
- Chancen und Risiken der Markteinführung
- Chancen
- Kostenersparnis und Flexibilitätssteigerung
- Alternative Inhalte und Nutzungsformen
- Aufwertung des Kinos als Werbeträger
- Qualität der Projektion
- Neue Schutzmechanismen vor Filmpiraterie
- Etablierung neuer Marktteilnehmer und Berufsfelder
- Risiken
- Hohe Investitionen
- Fehlende Finanzierungs- und Geschäftsmodelle
- Fragliche Technologiestandards
- Verfügbarkeit des Contents
- Verkürzung des Kinofensters
- Subjektive Risiken einzelner Marktteilnehmer
- Aktueller Status der Digitalisierung
- Marktsituation in Deutschland
- Geschäftsmodelle für E- und D-Cinema: CinemaNet Europe und XDC
- Internationale Entwicklung digitaler Leinwände und Kinostarts
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Digitalisierung des Kinomarktes, insbesondere mit den Prämissen, Folgen und dem aktuellen Status der digitalen Filmdistribution in Deutschland. Ziel ist es, die Chancen und Risiken der Digitalisierung für alle beteiligten Akteure zu beleuchten und die aktuelle Marktsituation in Deutschland sowie die internationale Entwicklung zu analysieren.
- Prinzip und Technologie des digitalen Kinos
- Chancen und Risiken der Digitalisierung
- Aktuelle Entwicklung und Marktsituation
- Finanzierungs- und Geschäftsmodelle
- Stand der Digitalisierung in Deutschland und international
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Digitalisierung des Kinomarktes ein und skizziert die Bedeutung der digitalen Filmdistribution für die Zukunft des Kinos. Kapitel 2 bietet eine Einführung in das Prinzip und die Technologie des digitalen Kinos, einschließlich der Begriffsbestimmung von D- und E-Cinema, der Funktionsweise des digitalen Kinos und der Rolle der IT-Infrastruktur. In Kapitel 3 werden die Chancen und Risiken der Markteinführung des digitalen Kinos für alle beteiligten Marktteilnehmer wie Produzenten, Verleiher, Kinobetreiber, Werbevermarkter und Intermediäre analysiert. Kapitel 4 beleuchtet den aktuellen Status der Digitalisierung auf nationaler und internationaler Ebene, beschreibt die deutsche Marktsituation, bereits existierende Geschäftsmodelle und die internationale Entwicklung digitaler Leinwände und Kinostarts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Digitalisierung des Kinomarktes, der digitalen Filmdistribution, den Chancen und Risiken der Digitalisierung, der IT-Infrastruktur, den Geschäftsmodellen, der Marktsituation in Deutschland und der internationalen Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen D-Cinema und E-Cinema?
D-Cinema (Digital Cinema) entspricht den hohen Industriestandards für Kinoprojektionen, während E-Cinema (Electronic Cinema) oft für alternative Inhalte oder weniger anspruchsvolle digitale Vorführungen genutzt wird.
Welche Vorteile bietet die digitale Filmdistribution?
Sie ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen, da teure Filmrollen entfallen. Zudem bietet sie mehr Flexibilität bei der Programmgestaltung und neue Einnahmequellen durch alternative Inhalte wie Live-Übertragungen.
Welche Risiken birgt die Umstellung auf digitales Kino?
Zu den Hauptrisiken gehören die sehr hohen Investitionskosten für Kinobetreiber, das Fehlen einheitlicher Finanzierungsmodelle und die schnelle Veraltung technologischer Standards.
Wie verändert die Digitalisierung den Schutz vor Filmpiraterie?
Die digitale Technik ermöglicht neue, integrierte Schutzmechanismen und Verschlüsselungen, die den unbefugten Zugriff auf Filmdaten während der Distribution und Projektion erschweren.
Wie ist der aktuelle Stand der Digitalisierung in Deutschland?
Die Arbeit analysiert die Marktsituation in Deutschland und stellt Geschäftsmodelle wie CinemaNet Europe vor, die den Übergang von analogen zu digitalen Leinwänden begleiten.
- Quote paper
- Melanie Trümper (Author), 2006, Digitalisierung des Kinomarktes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88606