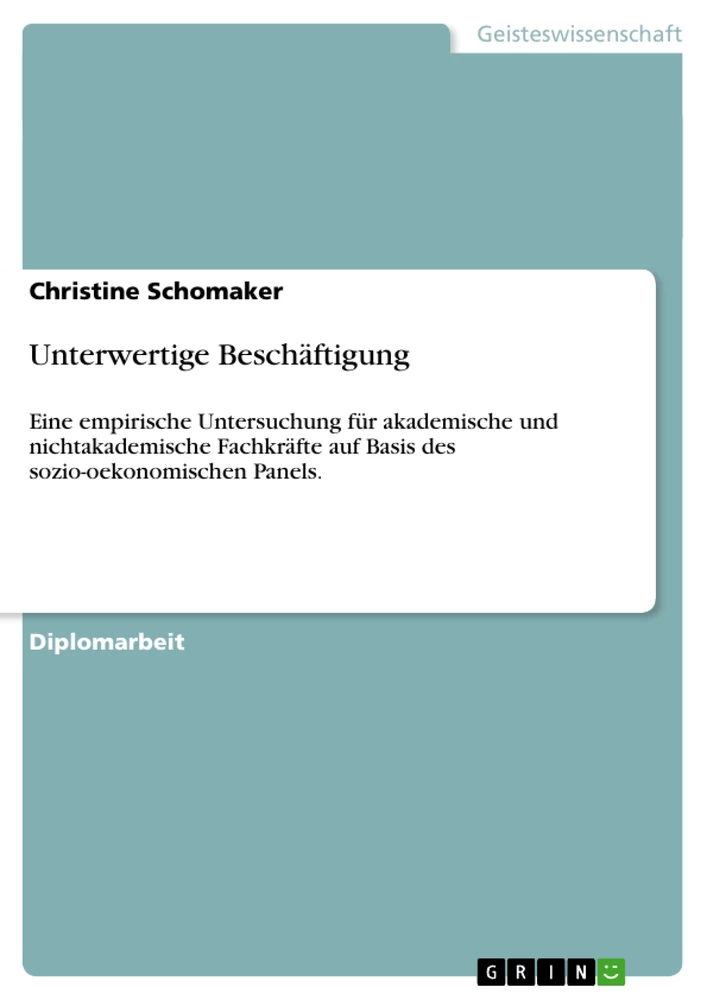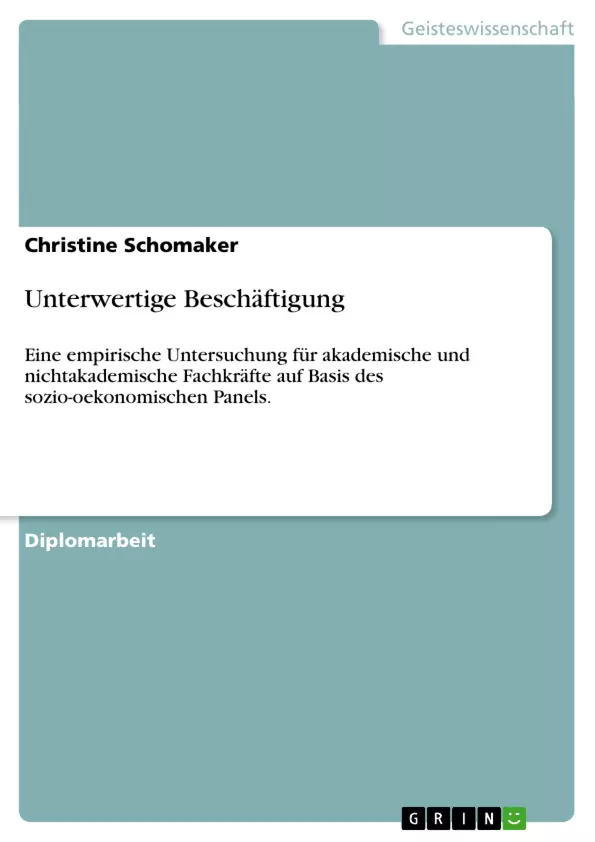Mit dem Phänomen der unterwertigen Erwerbstätigkeit wird in dieser Diplomarbeit eine Problemstellung aus dem Bereich der soziologischen Arbeitsmarkt- und Berufsforschung analysiert. Bei dem auch als Ausbildungsinadäquanz bezeichneten Beschäftigungszustand liegt das Qualifikationsniveau einer Person über dem für die Tätigkeit erforderlichen. Klischeehaft wird dafür in der öffentlichen Diskussion immer wieder die Vorstellung des taxifahrenden Philosophen, Soziologen, etc. bemüht. Mit Hilfe der Daten des Sozio-oekonomischen Panels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung von 2004 erfolgt eine aktuelle Analyse des Phänomens der Ausbildungsinadäquanz.
Neben der Frage, auf welche Ursachen unterwertige Beschäftigung zurückgeführt werden kann, widmet sich diese Arbeit schwerpunktmäßig verschiedenen Qualifikationsgruppen und Risikogruppen. Angesichts großer Veränderungen in der Bildungs- und Ausbildungsstruktur in den letzten Jahren sowie den gravierenden Folgen der Bildungsexpansion wie zum Beispiel der Höherqualifizierung der Bevölkerung stellt sich die Frage nach den Beschäftigungsaussichten von Akademikern und Nichtakademikern bezogen auf unterwertige Erwerbstätigkeit. Sind Unterschiede zwischen akademischen und nichtakademischen Fachkräften in Bezug auf ausbildungsinadäquate Beschäftigung vorhanden und in welchem Ausmaß und unter welchen Umständen kommen diese zum Tragen? Welche Risikogruppen sind in höherem Maße unterwertig beschäftigt und welche Gründe lassen sich dafür anführen? Als besonders sensibel im Hinblick auf Abstimmungsprobleme und damit auch auf Fehlqualifikationen gilt die Berufseinstiegsphase. Des Weiteren werden die Frauen als Risikogruppe auf dem Arbeitsmarkt in den Blick genommen. Lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf unterwertige Erwerbstätigkeit feststellen und welche Ursachen können als Erklärung dienen?
Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich den theoretischen Grundlagen des Phänomens der inadäquaten Beschäftigung unter Berücksichtigung der Humankapitaltheorie, des Job-Competition-Modells, der Job-Matching-Theorie und der Karrieremobilitätstheorie. Aufbauend auf einer deskriptiven Analyse erfolgt eine multivariate Analyse mit Hilfe des Verfahrens der logistischen Regression. Der dritte Teil stellt schließlich die zentralen empirischen Ergebnisse der Arbeit vor. Das vierte Kapitel beinhaltet eine kurze Zusammenfassung und zieht forschungsrelevante sowie bildungspolitische Schlussfolgerungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Theoretische Grundlagen
- 1.1 Definition und zentrale Begriffsbestimmungen
- 1.2 Die Bedeutung von unterwertiger Beschäftigung
- 1.3 Wandlungsprozesse der Qualifikations- und Berufsstruktur als Ursache unterwertiger Beschäftigung
- 1.4 Erklärungsansätze zur Existenz von unterwertiger Beschäftigung
- 1.4.1 Humankapitaltheorie
- 1.4.2 Job-Matching-Theorie
- 1.4.3 Karrieremobilitätstheorie
- 1.4.4 Job-Competition-Modell
- 1.5 Unterwertige Beschäftigung im Kontext des deutschen Bildungs- und Ausbildungssystems - die Erklärung von Unterschieden zwischen verschiedenen Qualifikationsgruppen und Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt
- 1.5.1 Chancen- und Risikomuster verschiedener Qualifikationsgruppen in der theoretischen Betrachtung
- 1.5.1.1 Grundstruktur der Berufsausbildung in Deutschland
- 1.5.1.2 Charakteristiken des deutschen Bildungs- und Ausbildungswesens
- 1.5.1.3 Ausbildungsinhalte und Verwertbarkeit der Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt
- 1.5.2 Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt in der theoretischen Betrachtung
- 1.5.2.1 Unterwertige Beschäftigung in der Berufseinstiegsphase
- 1.5.2.2 Unterwertige Beschäftigung und geschlechtsspezifische Unterschiede
- 1.5.1 Chancen- und Risikomuster verschiedener Qualifikationsgruppen in der theoretischen Betrachtung
- 2. Untersuchungskonzept
- 2.1 Datenbasis
- 2.2 Zur Messung von unterwertiger Beschäftigung
- 2.2.1 Objektive und subjektive Messkonzepte
- 2.2.2 Eigenes Messkonzept - Operationalisierung der abhängigen Variable Ausbildungsadäquanz
- 2.2.3 Operationalisierung der unabhängigen Variablen
- 2.3 Allgemeine Fallselektionen
- 2.4 Auswertungsschritte und statistische Verfahren
- 3. Empirische Ergebnisse.
- 3.1 Unterwertige Erwerbstätigkeit im Jahre 2004 - Eine aktuelle Darstellung des Phänomens
- 3.1.1 Deskriptive Ergebnisse
- 3.1.2 Binäre logistische Regression - Determinanten einer unterwertigen Beschäftigung.
- 3.2 Chancen- und Risikomuster verschiedener Qualifikationsgruppen
- 3.2.1 Akademische Fachkräfte
- 3.2.2 Nichtakademische Fachkräfte
- 3.2.3 Zusammenfassung
- 3.3 Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt
- 3.3.1 Unterwertige Beschäftigung in der Berufseinstiegsphase
- 3.3.2 Unterwertige Beschäftigung und geschlechtsspezifische Unterschiede
- 3.4 Mittelfristige Entwicklungstendenzen
- 3.1 Unterwertige Erwerbstätigkeit im Jahre 2004 - Eine aktuelle Darstellung des Phänomens
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen der unterwertigen Erwerbstätigkeit, auch als Ausbildungsinadäquanz bezeichnet, und untersucht die Beschäftigungssituation von Akademikern und Nichtakademikern im Kontext des deutschen Bildungs- und Ausbildungssystems.
- Analyse der Ursachen und Erklärungsansätze für unterwertige Beschäftigung
- Untersuchung der Unterschiede zwischen akademischen und nichtakademischen Fachkräften in Bezug auf ausbildungsinadäquate Beschäftigung
- Identifizierung von Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt, die ein höheres Risiko für unterwertige Beschäftigung aufweisen
- Beurteilung der Auswirkungen des deutschen Bildungssystems auf die Beschäftigungsaussichten von Akademikern und Nichtakademikern
- Analyse der Entwicklungstendenzen der unterwertigen Beschäftigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der unterwertigen Beschäftigung vor und erläutert die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit. Kapitel 1 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen des Themas, definiert den Begriff der unterwertigen Beschäftigung, diskutiert die Bedeutung des Phänomens und beleuchtet die Wandlungsprozesse in der Qualifikations- und Berufsstruktur. Außerdem werden verschiedene Erklärungsansätze vorgestellt, darunter die Humankapitaltheorie, die Job-Matching-Theorie, die Karrieremobilitätstheorie und das Job-Competition-Modell. Abschließend wird die Bedeutung des deutschen Bildungs- und Ausbildungssystems für die Entstehung von unterwertiger Beschäftigung betrachtet. Kapitel 2 präsentiert das Untersuchungskonzept, die Datenbasis, die Operationalisierung der Variablen und die statistischen Verfahren. Kapitel 3 stellt die empirischen Ergebnisse der Untersuchung dar, einschließlich deskriptiver Ergebnisse, Regressionsanalysen und einer Analyse von Chancen- und Risikomustern verschiedener Qualifikationsgruppen. Kapitel 4 bietet ein Fazit der Ergebnisse und diskutiert die Implikationen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Unterwertige Beschäftigung, Ausbildungsinadäquanz, Qualifikationsniveau, Berufsausbildung, Arbeitsmarkt, Akademiker, Nichtakademiker, Risikogruppen, Bildungsexpansion, Sozio-oekonomisches Panel, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter unterwertiger Beschäftigung?
Unterwertige Beschäftigung (Ausbildungsinadäquanz) liegt vor, wenn das Qualifikationsniveau einer Person höher ist als das für die ausgeübte Tätigkeit erforderliche Niveau.
Welche theoretischen Erklärungsansätze gibt es für dieses Phänomen?
Die Arbeit nutzt die Humankapitaltheorie, die Job-Matching-Theorie, die Karrieremobilitätstheorie und das Job-Competition-Modell zur Erklärung.
Werden Akademiker häufiger unterwertig beschäftigt als Nichtakademiker?
Die Arbeit analysiert genau diesen Unterschied und untersucht, in welchem Ausmaß akademische Fachkräfte im Vergleich zu nichtakademischen Kräften von Inadäquanz betroffen sind.
Warum ist die Berufseinstiegsphase besonders risikoreich?
Beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf treten häufig Abstimmungsprobleme auf, die zunächst zu einer Beschäftigung unterhalb des eigentlichen Qualifikationsniveaus führen können.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Fehlqualifikation?
Ja, Frauen werden in der Arbeit als spezifische Risikogruppe untersucht, wobei Ursachen für eine höhere Rate an unterwertiger Beschäftigung bei Frauen erörtert werden.
- Arbeit zitieren
- Christine Schomaker (Autor:in), 2007, Unterwertige Beschäftigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88610