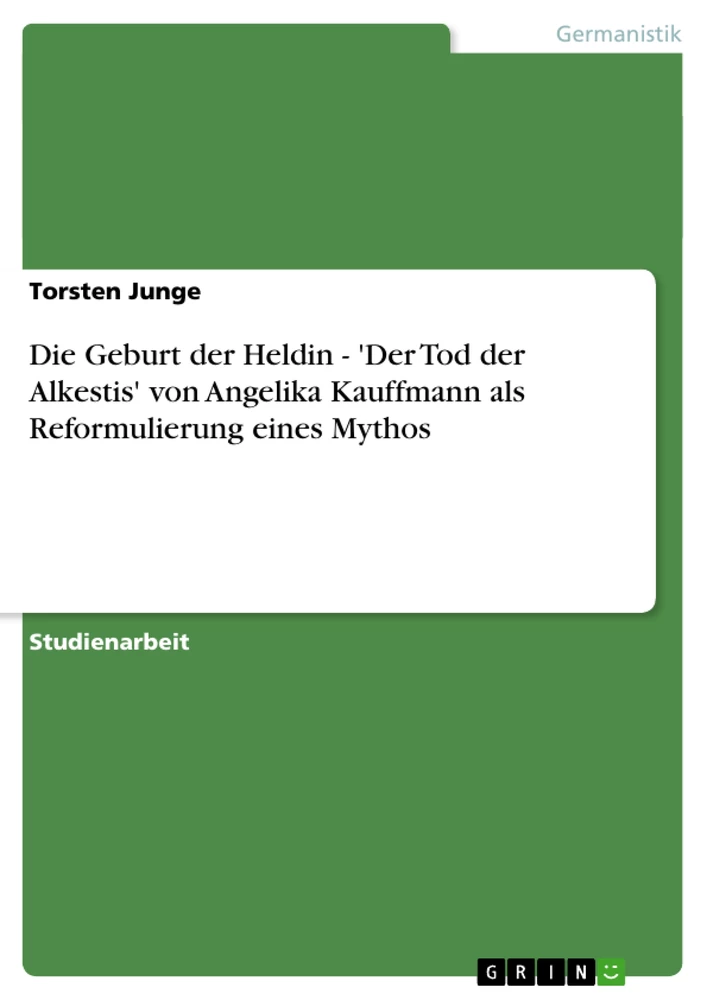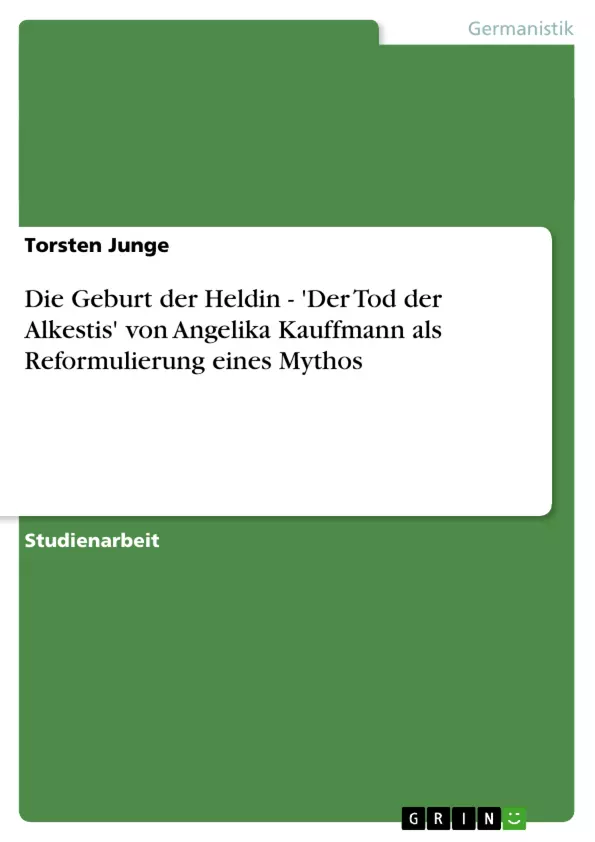„Vom Eros ergriffen übertraf sie diese so sehr an Liebe, dass man glauben musste, sie [die Eltern, TJ] ständen ihrem Sohne fremd gegenüber und seien ihm nur dem Namen nach verwandt; und nach Vollführung dieser Tat schien sie nicht nur in den Augen der Menschen, sondern auch der Götter ein so herrliches Werk vollbracht zu haben. Dass sie – die Götter – in Bewunderung ihrer Tat ihre Seele aus dem Hades zurückkehren ließen, während sie sonst, angesichts zahlreicher herrlicher Tat mancher anderer, doch nur ganz wenige Auserwählte der Auszeichnung würdigten, ihre Seele aus dem Hades wieder freizugeben. So ehren die Götter den tugendhaften Eifer für die Liebe.“ (Platon 1922: Bd.3, Das Gastmahl S.12)
Der hier in Platons Gastmahl angesprochene Mythos des Opfertodes der Alkestis erzählt die Geschichte einer Frau, die für ihren Ehemann in den Tod geht. Das Motiv für jemanden aus Liebe zu sterben, ist für den Menschen der Antike ebenso wenig unbekannt wie für die Gegenwart. In Platons Gastmahl wird sie in der Reflexion über die Bedeutung der Liebe, des Eros erwähnt, als Liebende, die bereit ist, für ihren Mann Admetos in den Tod zu gehen. Der Gehalt der Mythe liegt auf der Hand: Sich als Mensch für den anderen zu opfern, ist eine Tat, die sogar die Götter beeindruckt und zu ihren Respekt herausfordert. In der Antike ist dies keine Selbstverständlichkeit, die griechische Antike kennt in ihrer Konzeption des Überirdischen und Jenseitigen keine Götter, die als Heilsbringer oder als Hirten wie im Christentum fungieren. Die Götter sind bestimmend über Territorien und können schicksalsbeeinflussend sein. Sie sind jedoch keinesfalls um das Wohlergehen des einzelnen Menschen und um sein Seelenheil bemüht. Der christlichen Auffassung von der Heilserwartung, die in der Befolgung der göttlichen Gebote und in der Sorge des Pastors um die Gemeinde sich ausdrückte, ist dem griechischen Menschen völlig unbekannt: „Der griechische Gott gründet die Stadt, er zeigt ihren Standort, er hilft beim Bau der Mauern, er gewährleistet ihre Solidarität, er gibt der Stadt seinen Namen, er erteilt Orakel und verkündet dadurch seinen Rat. Man konsultiert den Gott, er beschützt, er interveniert, es geschieht, daß er zornig wird und daß er sich wieder versöhnt, doch niemals leitet der Gott die Menschen der Stadt, wie ein Hirte seine Schafe leiten würde.“ (Foucault 2004: 187)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodisches Vorgehen
- 2.1. Bilder als Gegenstand der Literaturwissenschaft
- 2.2. Die Methode der Bildinterpretation nach Erwin Panofsky
- 2.3. Zum Begriff des Mythos
- 3. Liebe im 18. und 19. Jahrhundert
- 3.1. Die sozialintegrierende Funktion von Liebe
- 3.2. Das Frauenbild im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert
- 4. Das Bild als Affirmation und Revolte
- 4.1. Zur Geschichte eines Bildmotives
- 4.2. Angelika Kauffmann - Der Tod der Alkestis
- 4.3. Darstellungstraditionen
- 4.3.1. Der klassische Heldentod
- 4.3.2. Der Marientod
- 5. Fazit
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Angelika Kauffmanns Gemälde "Der Tod der Alkestis" (1790) als Neuinterpretation des antiken Mythos. Ziel ist es, die Transformation des Mythos im Kontext der politischen und sozialen Verhältnisse des 18. und 19. Jahrhunderts zu analysieren und aufzuzeigen, wie das Bild sowohl bestehende als auch neue Bedeutungshorizonte aufwirft.
- Die sozialhistorische und soziologische Einordnung des Frauenbildes im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert.
- Die Analyse der Darstellungstraditionen des Alkestis-Mythos (Heldentod und Marientod).
- Die Interpretation von Kauffmanns Gemälde als Affirmation und Revolte gegen das vorherrschende Frauenbild.
- Die Untersuchung der methodologischen Ansätze der Bildinterpretation im Kontext der Literaturwissenschaft.
- Die Rolle des Mythos als Modell der Weltdeutung und seine Transformationsfähigkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung vor: Wie wird der Mythos der Alkestis in Angelika Kauffmanns Gemälde neu formuliert, und welche Sinn- und Bedeutungshorizonte werden dadurch in Frage gestellt oder bestätigt? Der Mythos der sich für ihren Mann opfernden Alkestis wird als Ausgangspunkt vorgestellt, wobei seine Vieldeutigkeit und sein Potential zur Transformation hervorgehoben werden. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz und den Aufbau der Untersuchung.
2. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel befasst sich mit der methodischen Grundlage der Arbeit, insbesondere mit der Frage, wie Bilder als Gegenstand der Literaturwissenschaft untersucht werden können. Es werden die methodischen Ansätze der Bildinterpretation nach Erwin Panofsky vorgestellt und der Begriff des Mythos im Kontext der Arbeit definiert. Die Kapitel erläutern die Notwendigkeit einer interdisziplinären Herangehensweise, die Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte verbindet.
3. Liebe im 18. und 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftliche Bedeutung von Liebe im 18. und 19. Jahrhundert, insbesondere deren sozialintegrative Funktion und das damit verbundene Frauenbild. Es beleuchtet den Wandel des Frauenbildes im Übergang zwischen diesen beiden Jahrhunderten und bildet den soziokulturellen Kontext für die Interpretation von Kauffmanns Gemälde. Der Abschnitt analysiert die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und deren Rolle in der Liebe und Ehe.
4. Das Bild als Affirmation und Revolte: Dieses Kapitel analysiert Angelika Kauffmanns Gemälde "Der Tod der Alkestis" im Detail. Es untersucht die Darstellungstraditionen, auf die Kauffmann zurückgreift (klassischer Heldentod und Marientod), und zeigt auf, wie diese Traditionen im Gemälde neu kombiniert und interpretiert werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Alkestis als Heldin und die mögliche Revolte gegen das damalige Frauenbild.
Schlüsselwörter
Angelika Kauffmann, Alkestis-Mythos, Bildinterpretation, Frauenbild, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Mythos-Transformation, Heldentod, Marientod, Liebe, Patriarchat, Revolte, Affirmation.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Angelika Kauffmanns "Der Tod der Alkestis"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert Angelika Kauffmanns Gemälde "Der Tod der Alkestis" (1790) als Neuinterpretation des antiken Mythos. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Transformation des Mythos im Kontext der politischen und sozialen Verhältnisse des 18. und 19. Jahrhunderts und die Frage, wie das Bild bestehende und neue Bedeutungshorizonte aufwirft.
Welche Methoden werden in der Analyse angewendet?
Die Arbeit verwendet eine interdisziplinäre Herangehensweise, die Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte verbindet. Die methodischen Ansätze der Bildinterpretation nach Erwin Panofsky werden angewendet, um das Gemälde zu analysieren. Der Begriff des Mythos wird im Kontext der Arbeit definiert und seine Transformationsfähigkeit untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die sozialhistorische und soziologische Einordnung des Frauenbildes im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert; die Analyse der Darstellungstraditionen des Alkestis-Mythos (Heldentod und Marientod); die Interpretation von Kauffmanns Gemälde als Affirmation und Revolte gegen das vorherrschende Frauenbild; die Untersuchung der methodologischen Ansätze der Bildinterpretation im Kontext der Literaturwissenschaft; und die Rolle des Mythos als Modell der Weltdeutung und seine Transformationsfähigkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Methodisches Vorgehen, Liebe im 18. und 19. Jahrhundert, Das Bild als Affirmation und Revolte, Fazit und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Analyse, beginnend mit der Einführung in die Thematik und der Methodik, gefolgt von der Kontextualisierung im 18. und 19. Jahrhundert und der detaillierten Bildanalyse, die schließlich im Fazit zusammengefasst wird.
Welche Bedeutung hat der Alkestis-Mythos in dieser Arbeit?
Der Alkestis-Mythos dient als Ausgangspunkt der Analyse. Seine Vieldeutigkeit und sein Potential zur Transformation werden hervorgehoben. Die Arbeit untersucht, wie Kauffmann den Mythos neu formuliert und welche Sinn- und Bedeutungshorizonte dadurch in Frage gestellt oder bestätigt werden. Die Analyse betrachtet die Darstellungstraditionen des Alkestis-Mythos, insbesondere den klassischen Heldentod und den Marientod, und deren Neuinterpretation in Kauffmanns Gemälde.
Wie wird das Frauenbild im 18. und 19. Jahrhundert dargestellt?
Die Arbeit untersucht die gesellschaftliche Bedeutung von Liebe im 18. und 19. Jahrhundert, insbesondere deren sozialintegrative Funktion und das damit verbundene Frauenbild. Sie beleuchtet den Wandel des Frauenbildes im Übergang zwischen diesen beiden Jahrhunderten und analysiert die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und deren Rolle in der Liebe und Ehe. Das Gemälde wird im Kontext dieser gesellschaftlichen Erwartungen interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die zentrale Forschungsfrage nach der Neuformulierung des Alkestis-Mythos in Kauffmanns Gemälde und den damit verbundenen Sinn- und Bedeutungshorizonten. Es wird die Interpretation des Gemäldes als sowohl Affirmation als auch Revolte gegen das vorherrschende Frauenbild diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter: Angelika Kauffmann, Alkestis-Mythos, Bildinterpretation, Frauenbild, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Mythos-Transformation, Heldentod, Marientod, Liebe, Patriarchat, Revolte, Affirmation.
- Quote paper
- MA Torsten Junge (Author), 2006, Die Geburt der Heldin - 'Der Tod der Alkestis' von Angelika Kauffmann als Reformulierung eines Mythos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88628