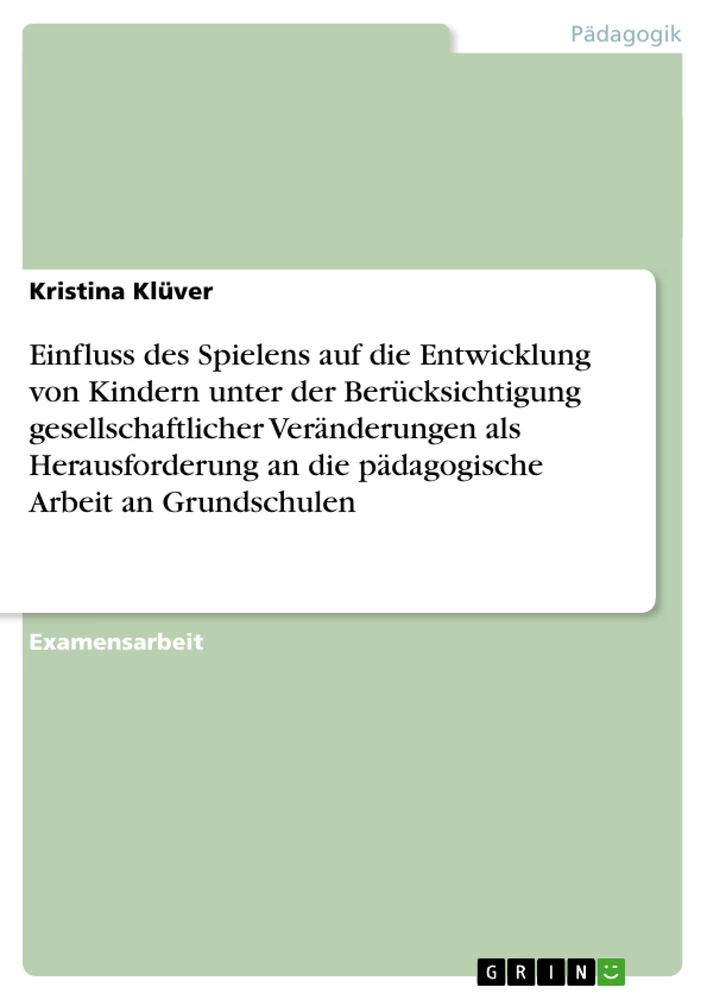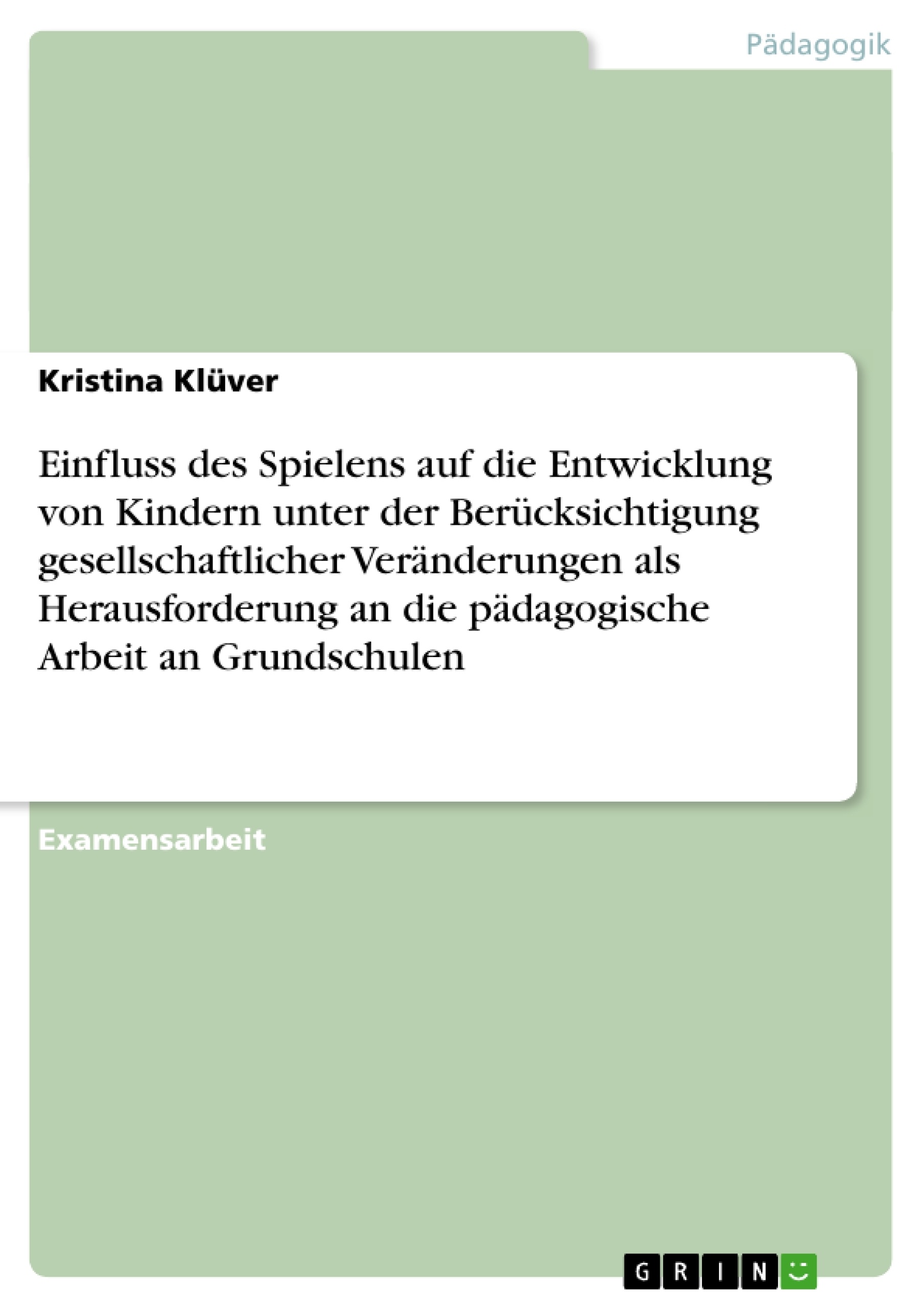Spielen ist bedeutend für die Entwicklung der Kinder. Beim Eintritt in die Grundschule hat ein normal entwickeltes Kind schon eine beachtliche Spielvergangenheit hinter sich. Das Meiste, was es bisher gelernt hat, hat es durch das Spielen erfahren.
Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, ob und wenn inwiefern ausgewählte Aspekte gesellschaftlicher Veränderungen Einfluss auf das Spielverhalten und damit auf die kindliche Entwicklung nehmen.
Die Verhältnisse, in denen Kinder heute aufwachsen, haben sich verändert. Viele Kinder wohnen in Städten und haben nur wenige Möglichkeiten, direkte Erfahrungen mit der Natur zu machen. Die Städte sind an den Bedürfnissen der Erwachsenen ausgerichtet. Autos beherrschen die Straßen, das Spielen ist aus dem Netz der Lebensbezüge herausgelöst und in die dafür vorgesehenen Institutionen verdrängt worden.
Das Leben scheint insgesamt schneller geworden zu sein. Durch eine Vielfalt von Freizeitangeboten (z.B. Musik oder Sport,…) sowie die Erziehungs- und Bildungsvorstellungen der Eltern wird der Terminkalender der Kinder immer voller. Dies dient nicht zuletzt als Vorbereitung um in einer leistungsorientierten Gesellschaft zu bestehen. Viele Eltern wollen, dass die Freizeit ihrer Kinder vielseitig und vor allem „sinnvoll“ und aktiv gestaltet wird. So wird Kindheit schnell zu einer „verplanten Kindheit“.
Bleibt dann noch genügend Zeit zum eigentätigen Spielen?
Ziel dieser Arbeit ist nicht, der Gesamtheit der vielfältigen, komplexen Formen, Funktionen und Aspekte des kindlichen Spielens gerecht zu werden. Im Mittelpunkt meiner Betrachtungen steht vielmehr das eigentätige Spielen der Kinder als kreativ schöpferische Tätigkeit, hervorgehend aus einer inneren Motivation.
Mittels Gegenüberstellung verschiedener Ansätze sollen mögliche Auswirkungen der „veränderten Gesellschaft“ auf die Entwicklung diskutiert werden, um abschließend daraus entstehende Herausforderungen für die pädagogische Arbeit der Lehrer/innen an Grundschulen zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Das kindliche Spielen
- 2.1 Theorien des kindlichen Spiels
- 2.1.1 Erste Theorien zum Spiel der Kinder
- 2.1.2 Interesse der Pädagogik am Spiel
- 2.1.3 Jean Piaget und Sigmund Freud
- 2.2 Drei Merkmale des Spiels
- 2.2.1 Spielen um des Spielens willen
- 2.2.2 Abtauchen in eine andere Realität
- 2.2.3 Wiederholung und Ritualisierung
- 2.3 Formen des kindlichen Spiels
- 2.4 Der Einfluss des Spielens auf die vier Kompetenzbereiche
- 2.5 Zusammenfassende Betrachtung
- 3 Gegenüberstellung von gesellschaftlichen Veränderungen und deren mögli�chen Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern
- 3.1 Veränderte Kindheit – gefährdete Kindheit?
- 3.1.1 Das Spielen heute
- 3.1.2 Die neuen Medien
- 3.1.3 Verhäuslichung und Verinselung
- 3.1.4 Keine Zeit zum Spielen?
- 3.1.5 Diskussion
- 3.2 Mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung
- 3.2.1 Der Verlust von Eigentätigkeit
- 3.2.2 Mögliche Folgen für die vier Kompetenzbereiche
- 3.2.2.1 Die emotionale und soziale Entwicklung
- 3.2.2.2 Die motorische Entwicklung
- 3.2.2.3 Die kognitive Entwicklung
- 3.2.3 Wird dann das Spielen zum Termin? Die Spieltherapie
- 3.3 Zusammenfassende Betrachtung
- 4 Herausforderungen für die pädagogische Arbeit an Grundschulen
- 4.1 Die Herausforderungen in den einzelnen Bereichen
- 4.1.1 Die Bedeutung der Naturerfahrungen
- 4.1.2 Gleichberechtigung für Homo ludens und Homo faber
- 4.1.3 Partizipation der Kinder
- 4.2 Rahmenbedingungen
- 4.3 Fazit
- 5 Schlusswort
- Literaturverzeichnis und Internetquellen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss des Spielens auf die Entwicklung von Kindern im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und die damit verbundenen Her�ausforderungen für die pädagogische Arbeit an Grundschulen. Die Arbeit analysiert verschiedene The�orien des Spiels und beleuchtet dessen Bedeutung für die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von Kindern. Sie setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern gesellschaftliche Verände�rungen, wie z.B. der zunehmende Einfluss von Medien, die Verhäuslichung von Lebenswelten und der Zeit�druck im Alltag, den Spielraum von Kindern einschränken und negative Auswirkungen auf ihre Entwicklung haben können. Ziel ist es, Herausforderungen für die pädagogische Arbeit zu identifizieren und Lösungsansätze zu diskutieren.
- Bedeutung des Spiels für die Entwicklung von Kindern
- Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf das Spielverhalten
- Verlust von Eigentätigkeit und die Folgen für die Entwicklung
- Herausforderungen für die pädagogische Arbeit an Grundschulen
- Möglichkeiten zur Förderung des Spielens und der kindlichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem kindlichen Spielen und analysiert verschiedene Theorien, die die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung hervorheben. Es werden die drei Merkmale des Spiels nach ROLF OERTER erläutert, die eine klare Abgrenzung zu den Begriffen Arbeit und Ernsthandlungen ermöglichen. Darüber hinaus werden verschiedene Formen des kindlichen Spiels in ihrer Entwicklungsreihenfolge dargestellt und der Einfluss des Spielens auf die vier Kompetenzbereiche - emotionale, soziale, motorische und kognitive Entwicklung - beschrieben. Das dritte Kapitel befasst sich mit der „veränderten Kindheit“ und analysiert verschiedene Aspekte, die den Spielraum von Kindern einschränken können. Es werden die Auswirkungen von neuen Medien, Verhäuslichung und Zeitdruck auf das Spielverhalten von Kindern untersucht und kritisch diskutiert. Mögliche Folgen für die kindliche Entwicklung werden dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf dem Verlust der Eigentätigkeit und den damit verbundenen Entwicklungsstörungen liegt. Das vierte Kapitel widmet sich den Herausforderungen für die pädagogische Arbeit an Grundschulen, die sich aus den beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen ergeben. Es werden verschiedene Ansätze zur Förderung des Spielens in der Schule vorgestellt, wie z.B. die Bedeutung von Naturerfahrungen, die Gleichberechtigung von Homo ludens und Homo faber im Unterricht und die Partizipation der Kinder in Planungsprozessen. Die Ganztagsschule als ein möglicher Rahmen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, wird abschließend vorgestellt.
Schlüsselwörter
Kindheit, Spiel, Entwicklung, Gesellschaftliche Veränderungen, Medien, Verhäuslichung, Eigentätigkeit, Ganztagsschule, Pädagogische Arbeit, Homo ludens, Homo faber, Partizipation, Naturerfahrungen
- Citar trabajo
- Kristina Klüver (Autor), 2007, Einfluss des Spielens auf die Entwicklung von Kindern unter der Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen als Herausforderung an die pädagogische Arbeit an Grundschulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88664