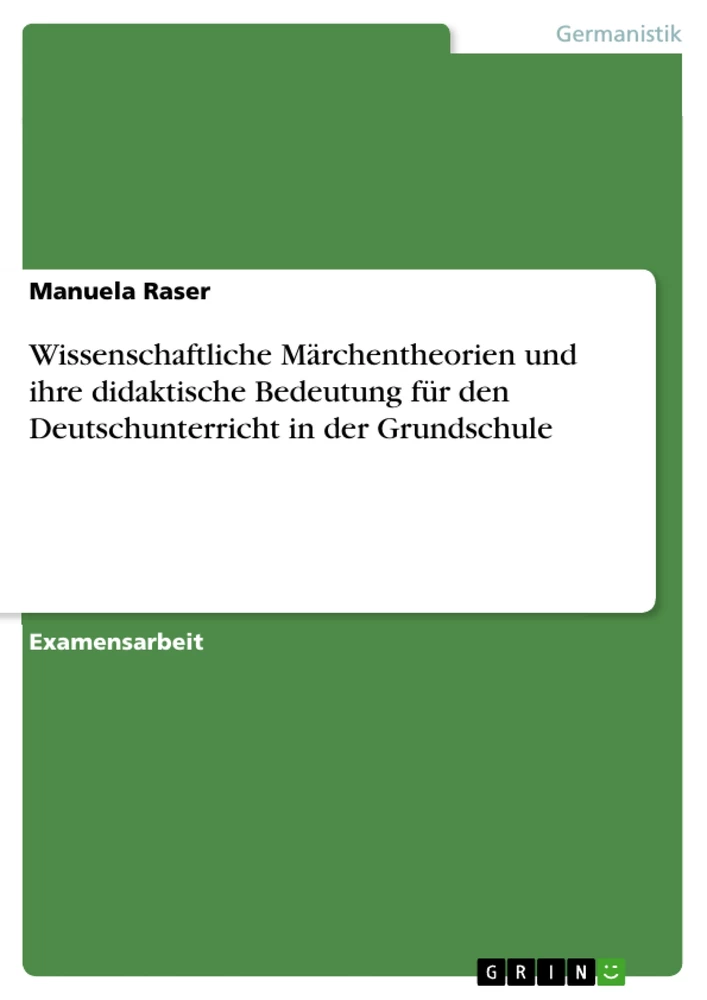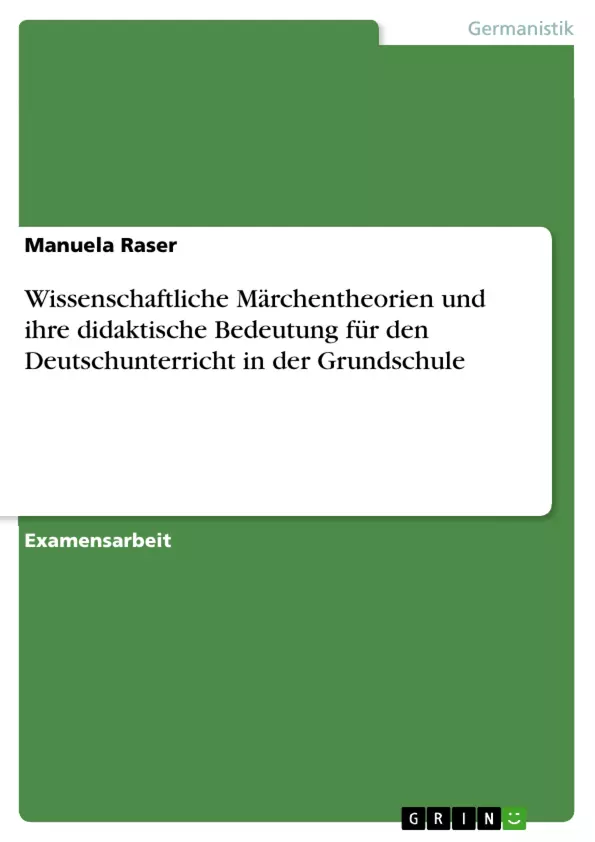Die Arbeit befasst sich sowohl mit den Theorien, die Wissenschaftler der verschiedenen Forschungsgebiete zur Gattung der Volksmärchen aufgestellt haben, als auch mit der Anwendbarkeit dieser Märchentheorien im Grundschulunterricht.
Als Märchenbeispiele werden hauptsächlich die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm verwendet, denn diese Märchen sind weitgehend bekannt und daher beispielgebend.
In den verschiedenen Wissenschaften wie der Literatur, der Volkskunde, der Ethnologie, der Politologie, der Soziologie, der Psychologie gab und gibt es Forschungsbemühungen um das Literaturgenre Märchen. In den unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten wurden verschiedene Analyse- und Interpretationsmodelle entwickelt, die dem Märchen zugrunde gelegt werden.
In dieser Arbeit werden drei Märchentheorien untersucht und dargestellt: Die Literaturwissenschaft, die Volkskunde und die Psychologie.
Diese Arbeit hat eine zentrale Leitfrage: Welche Bedeutung haben die verschiedenen Märchentheorien und wie kann man sie sinnvoll in den Deutschunterricht der Grundschule einbringen? Für die Beantwortung dieser Frage werden vier Unterfragen beantwortet: 1. Wie ist der Begriff des Märchens zu erklären?
Dabei stehen grundlegende definitorische Erläuterungen im Mittelpunkt.
Außerdem wird in diesem Abschnitt die Tätigkeit der Märchensammler dargestellt. 2. Wie stellen sich die drei ausgewählten Märchentheorien dar? Dafür werden die drei Theorien, ihre Interpretations- bzw. Analysemodelle dargestellt und miteinander verglichen. 3. Welche Konsequenzen werden aus den dargestellten Märchentheorien in didaktischer und methodischer Hinsicht gezogen bzw. welche Bedeutung haben die drei Märchentheorien für den Einsatz im Deutschunterricht der Grundschule? 4. Wie können die Lernziele und die didaktischen und methodischen Konsequenzen aus den Märchentheorien praktisch umgesetzt werden? Hier ist ein progressives Unterrichtskonzept für den Einsatz von Märchen im Deutschunterricht in den Klassen 1 bis 4 dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Begriff des Märchens
- Ethymologische Begriffsbestimmung
- Die Arbeit der Märchensammler
- Deutsche Märchensammler: Grimm und Bechstein
- Internationale Märchensammler
- Märchentheorien / Analyse- und Interpretationsmodelle
- Literaturwissenschaftliche Theorie
- Märchen als „Einfache Form“ nach André Jolles
- Stilanalyse der Märchen nach Max Lüthi
- Strukturalistische Analyse nach Vladimir Propp
- Volkskundliche Theorie
- Theorien zur Entstehung der Volksmärchen
- Volkskundliche Analyse nach Lutz Röhrich
- Psychologische Theorie
- Tiefenpsychologische Analyse
- Sigmund Freud und seine „Traumtheorie“
- Carl Gustav Jung und seine „Archetypen“-Theorie
- Entwicklungspsychologische Analyse
- Entwicklungsphasen nach Charlotte Bühler
- Der Kinderpsychologe Bruno Bettelheim
- Aktueller Ausblick zu den verschiedenen Märchentheorien
- Didaktische und methodische Umsetzung der Märchentheorien im Deutschunterricht der Grundschule
- Lernziele im Deutschunterricht für den Umgang mit Märchen
- Verschiedenen Rezeptionsformen von Märchen
- Sprachlichen Rezeptionsform Vorlesen
- Sprachlichen Rezeptionsform Erzählen
- Sprachlichen Rezeptionsform Besprechen
- Sprachlichen Rezeptionsform Textbearbeitung
- Außersprachlichen Rezeptionsform Gestalten
- Außersprachlichen Rezeptionsform Spielen
- Didaktische und methodische Konsequenzen aus den Märchentheorien
- Literaturwissenschaftliche Theorie
- Volkskundliche Theorie
- Psychologische Theorie
- Fazit zu den verschiedenen Theorien
- Unterrichtsentwürfe unter Beachtung der Märchentheorien
- Unterrichtsentwurf Klasse 1
- Unterrichtsentwurf Klasse 2
- Unterrichtsentwurf Klasse 3
- Unterrichtsentwurf Klasse 4
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen wissenschaftlichen Theorien zur Gattung der Märchen darzustellen und ihre Anwendbarkeit im Deutschunterricht der Grundschule zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf Volksmärchen, insbesondere den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Märchen“
- Darstellung von Märchentheorien aus der Literaturwissenschaft, Volkskunde und Psychologie
- Analyse von Interpretations- und Analysemodellen der verschiedenen Theorien
- Anwendung der Märchentheorien im Deutschunterricht der Grundschule
- Entwicklung von Unterrichtsentwürfen unter Berücksichtigung der Märchentheorien
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden der Begriff „Märchen“ und die Arbeit der Märchensammler, insbesondere der Brüder Grimm, beleuchtet. Das zweite Kapitel befasst sich mit drei ausgewählten Märchentheorien: der Literaturwissenschaft, der Volkskunde und der Psychologie. Hier werden die jeweiligen Theorien, ihre Interpretations- und Analysemodelle vorgestellt und miteinander verglichen.
Das dritte Kapitel widmet sich der didaktischen und methodischen Umsetzung der Märchentheorien im Deutschunterricht der Grundschule. Es werden Lernziele, verschiedene Rezeptionsformen von Märchen und die didaktischen und methodischen Konsequenzen aus den verschiedenen Theorien diskutiert.
Im vierten Kapitel werden konkrete Unterrichtsentwürfe für die Klassenstufen 1 bis 4 unter Berücksichtigung der Märchentheorien vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Volksmärchen, Märchentheorien, Literaturwissenschaft, Volkskunde, Psychologie, Deutschunterricht, Grundschule, Rezeptionsformen, Didaktik, Methodik, Unterrichtsentwürfe.
- Quote paper
- Manuela Raser (Author), 2004, Wissenschaftliche Märchentheorien und ihre didaktische Bedeutung für den Deutschunterricht in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88718