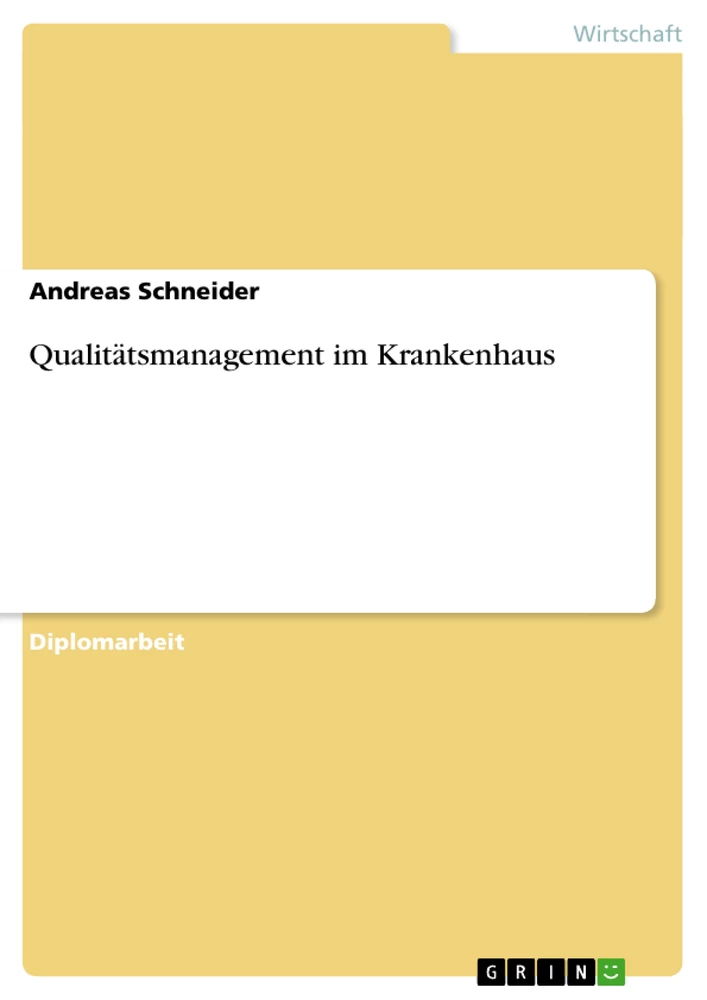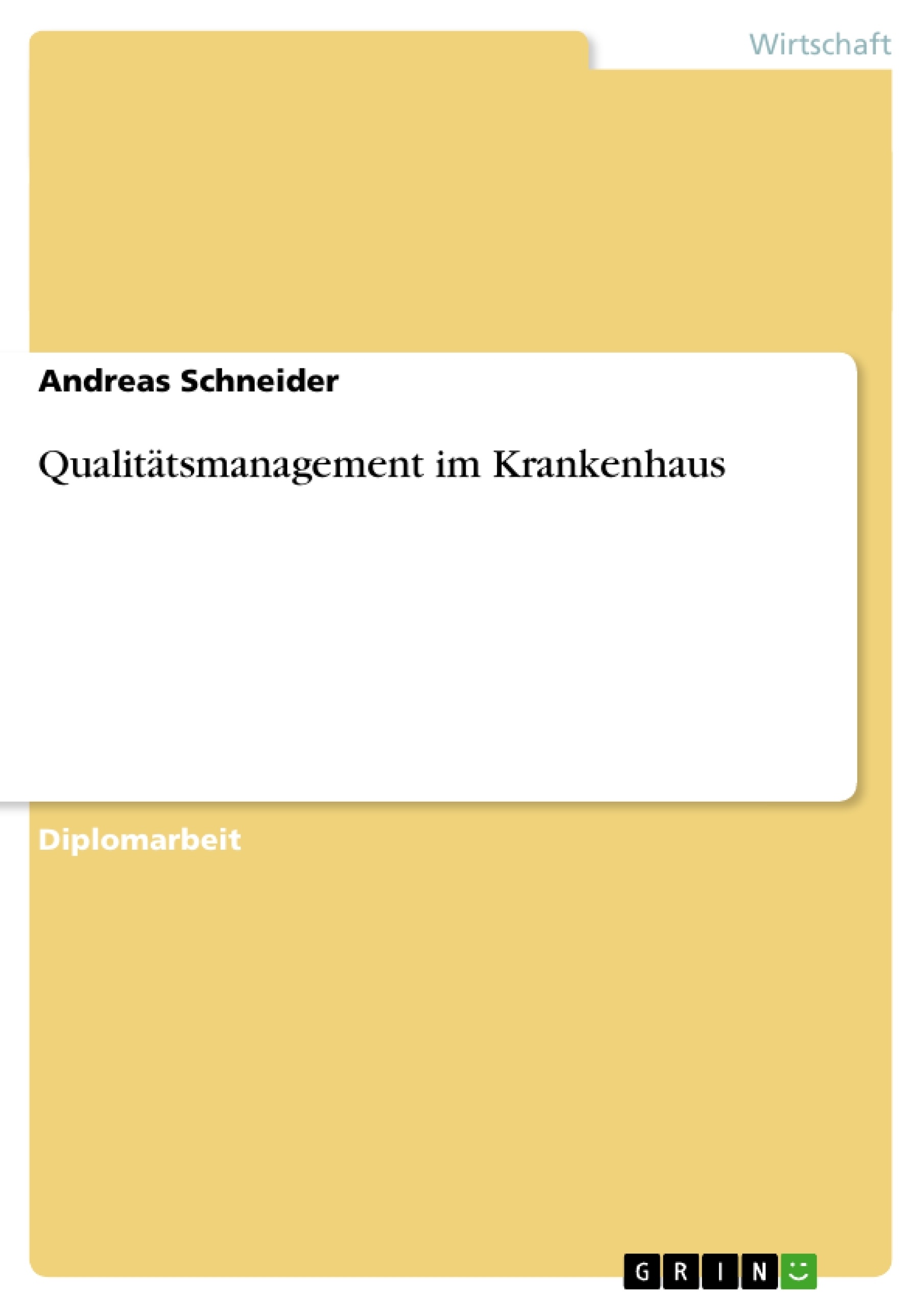Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Krankenhaussektor, da dieser mit zirka einem Viertel an den Gesamtausgaben und Arbeitsplätzen im Gesundheitswesen den größten Bereich darstellt. Dieser präsentiert sich als ein komplexes Gebilde mit fünf Akteuren. Der erste, der Patient, benötigt die Leistung, während der zweite, der Arzt/das Krankenhaus (KH), sie erbringt. Der dritte, die Kassen, bezahlen mit dem Geld der vierten, der Versicherten, unter Aufsicht des fünften, dem Staat, als Überwacher und Mitfinanzier. Dazu kommt, dass die Ziele und die Qualität vom Anbieter festgelegt werden, vom Nachfrager vorausgesetzt und abhängig sind und durch Dritte (Gesetzgeber, Kassen, Mitversicherte) modelliert werden). Dabei lässt sich Qualität nicht so einfach mit objektiven Werten beschreiben, wie Abmaße oder Stromverbrauch z. B. in der Sachgüterindustrie. Mit Dauer der Behandlung, Behandlungsergebnis, Kosten usw. seien nur einige Kriterien im Krankenhaus genannt, von denen jeder Akteur zusätzlich eine andere Auffassung hat.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung
2 Charakterisierung der Krankenhausdienstleistung
2.1 Merkmale des stationären Sektors
2.2 Grundlagen der Dienstleistungsproduktion
2.3 Gesundheitsproduktion
3 Qualität
3.1 Definition und Begriffsabgrenzung
3.2 Qualitätsdimensionen - Ansätze zur Messung und Steuerung
3.3 Qualität in der Medizin und im Krankenhaus
3.3.1 Anforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitäten
3.3.2 Schlüsselergebnisse
3.3.2.1 Klinische Qualität - Medizinisches und pflegerisches Ergebnis
3.3.2.2 Qualität aus Kundensicht - Patientenzufriedenheit
3.3.2.3 Finanzielle und nicht finanzielle Erfolgsgrößen
3.3.3 Gute medizinische Versorgung (Good clinical care)
4 Qualitätsmanagement im Krankenhaus
4.1 Einführungsgründe von Qualitätsmanagement
4.1.1 Aus moralischer Sicht
4.1.2 Aus wirtschaftlicher Sicht
4.1.3 Aus rechtlicher Sicht
4.2 Historische Entwicklung der Qualitätssicherung
4.3 Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem
4.3.1 Umfassendes Qualitätsmanagement und Total Quality Management
4.3.2 Zentrale Prinzipien des Total Quality Management
4.4 Aufgaben und Elemente von Qualitätsmanagement
4.4.1 Qualitätsplanung
4.4.2 Qualitätslenkung und -steuerung
4.4.3 Qualitätsprüfung
4.4.4 Qualitätssicherung und -managementdarlegung
4.5 Qualitätsmanagementsysteme und deren Überprüfung
4.5.1 Interne und externe Qualitätssicherung
4.5.2 Bewertung-, Zertifizierung- und Akkreditierungsverfahren
4.5.2.1 Zertifizierung nach DIN EN IS0 9000:2000 ff.
4.5.2.2 Bewertung nach EFQM
4.5.2.3 Zertifizierung nach KTQ
4.5.2.4 Akkreditierung nach JCAHO und andere Verfahren
4.6 Kritische Würdigung
5 Schlußbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Aufbau der Arbeit
Abb. 2: Der stationäre Sektor
Abb. 3: Systematisierung von Dienstleistungen
Abb. 4: Sach- und Dienstleistungsanteil
Abb. 5: Gesundheitsproduktion
Abb. 6: Prozess-Logogramm in einem Krankenhaus
Abb. 7: Qualitätsmanagement-bezogene Begriffe
Abb. 8: Phasenansatzmodell der Dienstleistungsqualität
Abb. 9: Evaluierbarkeit von Leistungen
Abb. 10: GAP-Modell der Dienstleistungsqualität
Abb. 11: Funktionaler Zusammenhang im Drei-Dimensionen-Modell
Abb. 12: Bestimmung der Dienstleistungsqualität
Abb. 13: Hauptakteure und Beziehungen im Gesundheitswesen
Abb. 14: Beziehung zwischen Kosten, Zeit und Qualität und Quantität
Abb. 15: Qualitätsmanagementpyramide
Abb. 16: Prinzipien des TQM
Abb. 17: PTCA-Zyklus nach Deming
Abb. 18: Phasen und Instrumente eines QM
Abb. 19: House of Quality
Abb. 20: Ausgewählte Abbildungsverfahren mit Beispielen
Abb. 21: Übersicht intere und externe Qualitätssicherung sowie QM
Abb. 22: Prozessmodell der DIN ISO 9000 ff.
Abb. 23: Das EFQM-Modell
Abb. 24: Mögliche Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen
Abb. 25: Allgemeiner Ablauf einer DIN-Zertifizierung
Abb. 26: Qualität und Kostenwirkungen
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: 5-D-Modell
Tab. 2: Prinzipien von Qualitätsmanagementsystemen
Tab. 3: Übersicht Bewertungssysteme
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung
Themenstellung
Die stationäre Krankenversorgung muss sich in den nächsten Jahren folgenden Herausforderungen stellen:[1]
- demografische Entwicklung mit zunehmend älteren und kranken und damit teuren Patienten[2]
- medizinischer Fortschritt mit kostspieliger Erweiterung des Diagnose- und Be- handlungsspektrums[3]
- Wettbewerb, durch marktwirtschaftliche Elemente und Öffnung des Marktes, Kampf um den Patienten
- sektorenübergreifende Kooperationen mit vor- und nachgelagerten Stufen (Ambulanz und Reha)
- zunehmende Europäisierung und Globalisierung führt zu Medizintourismus und Multinationalität
- Wertewandel macht aus Patienten Kunden und erhöht die Anforderungen an die Qualität
- gesetzliche Rahmenbedingungen führen zu Kostendämpfung und neuen Versorgungsformen.
Dazu ist es zweckmäßig, die betriebliche Leistung nicht mehr nur quantitativ sondern auch qualitativ und ökonomisch zu betrachten. Qualität und Wirtschaftlichkeit stellen daher auch im Krankenhaus mittlerweile zentrale Begriffe dar,[4] um den steigenden Anforderungen der Kostenträger und der Patienten gerecht zu werden. So wird vermehrt über vermeintliche Qualitätsmängel und Behandlungsfehler berichtet und Begriffe wie Qualitätsmanagement (QM), Total Quality Management (TQM) oder Zertifizierung als Allheilmittel gepriesen. Ärzte, Pfleger und Verwaltung sollen mehr über Qualität lernen. Es werden dazu allerorts unterschiedlichste Seminare angeboten und Qualitätssysteme aufgebaut.[5] Ziele sind eine bessere Versorgung und eine Ausgabensenkung im Gesundheitswesen durch die Schaffung von mehr Transparenz in der Leistungs- und Kostenentstehung. Für eine bessere Versorgung wird es nötig werden, näher am Patienten zu sein und über seine Bedürfnisse sowie Beschwerden mehr zu wissen.
Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Krankenhaussektor, da dieser mit zirka einem Viertel an den Gesamtausgaben und Arbeitsplätzen[6] im Gesundheitswesen den größten Bereich darstellt. Dieser präsentiert sich als ein komplexes Gebilde mit fünf Akteuren. Der erste, der Patient, benötigt die Leistung, während der zweite, der Arzt/das Krankenhaus (KH), sie erbringt. Der dritte, die Kassen, bezahlen mit dem Geld der vierten, der Versicherten, unter Aufsicht des fünften, dem Staat, als Überwacher und Mitfinanzier. Dazu kommt, dass die Ziele[7] und die Qualität vom Anbieter festgelegt werden, vom Nachfrager vorausgesetzt und abhängig sind und durch Dritte (Gesetzgeber, Kassen, Mitversicherte) modelliert werden (siehe Kap. 4.1.1).[8] Dabei lässt sich Qualität nicht so einfach mit objektiven Werten beschreiben, wie Abmaße oder Stromverbrauch z. B. in der Sachgüterindustrie. Mit Dauer der Behandlung, Behandlungsergebnis, Kosten[9] usw. seien nur einige Kriterien im Krankenhaus genannt, von denen jeder Akteur zusätzlich eine andere Auffassung hat.
Vorgehensweise
Auf Basis einer Literaturanalyse wird versucht, einen umfassenden Einblick in die Qualität und das Qualitätsmanagement im Krankenhaus (KH) zu geben. Es wird weniger um die Frage gehen, ob Qualitätsmanagement (QM) im Krankenhaus eingeführt werden sollte, sondern vielmehr darum, welches in der Indus-trie entwickelte System sich für deutsche Krankenhäusen empfiehlt und wohin die Entwicklung führt.[10]
In Kapitel 2 wird zunächst ein kurzer Überblick über den stationären Sektor, speziell den Krankenhausbereich, gegeben. Dazu wird neben dem Dienstleistungscharakter auf Trägerschaft, Finanzierung, Gesundheitsproduktion und Zusammenarbeit der Krankenhausbereiche eingegangen.
Thema von Kapitel 3 ist die Qualität im allgemeinen sowie krankenhausbezogen, um Ansätze zur Messung und Steuerung besser zu verstehen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Bedeutung der Kundenzufriedenheit näher eingegangen.
Kapitel 4 widmet sich der Zusammenführung von Krankenhausleistung und Qualität. Von Einführungsgründen des Qualitätsmanagements ausgehend, wird die historische Entwicklung nachgezeichnet, die in der Forderung nach inte-griertem und umfassendem Qualitätsmanagementment (UQM) bzw. Total Quality Management mündet. Auf deren Inhalte und Anforderungen soll dann ebenso eingegangen werden wie auf mögliche Qualitätstechniken zur Erreichung der Ziele. Darauf aufbauend werden die in Deutschland eingesetzten, z. T. aus der Industrie stammenden Qualitätsmanagementsysteme (QMS) untersucht, ob sie den Forderungen nach umfassender Qualität gerecht werden und auf das Krankenhaus übertragbar sind. Dazu werden die jeweiligen Systeme mit ihren Bewertungsverfahren vorgestellt, welche die Qualitätsmanagementsysteme überprüfen. Abschließend werden die Modelle einer kritischen Würdigung unterzogen.
Das Schlusskapitel 5 fasst die Erkenntnisse zusammen und geht im Anschluss auf weitere Mängel und Problemstellungen ein. Dazu werden aktuelle Trends vorgestellt und es wird zu klären versucht, welche Art und Menge von Qualität erstrebenswert ist. In der nachfolgenden Abb. 1 ist der Aufbau der vorliegende Arbeit nochmals zusammenfassend dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Aufbau der Arbeit
2 Charakterisierung der Krankenhausdienstleistung
2.1 Merkmale des stationären Sektors
Nachdem der Dienstleistungscharakter der Krankenhausleistung geklärt wurde, soll das Krankenhauswesen näher beschrieben werden. Krankenhäuser gehören zum stationären Sektor so wie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Der stationäre Sektor unterscheidet sich von der ambulanten Versorgung durch eine ständige ärztliche und pflegerische Betreuung sowie Versorgungsleistungen wie Arzneimittel, Unterkunft und Verpflegung.[12] Krankenhäuser sind im allgemeinen Behandlungs- und Geburtsstätte. Unter Behandlung wird „Krankheiten der Patienten erkennen, heilen, eine Verschlimmerung verhüten und Beschwerden lindern (…)"[13] verstanden. Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sollen dagegen lediglich eine weitere Schwächung oder Gefährdung der Gesundheit in nahe liegender Zukunft verhindern und den Erfolg der Krankenhausbehandlung sichern bzw. festigen.[11][14]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Der stationäre Sektor
(In Anlehnung an: Janssen (Wirtschaftlichkeitsbewertung, 1999), S. 31 sowie Hribek (Patientenzufriedenheit, 1999), S. 24.)
Krankenhäuser lassen sich wie in Abb. 2 dargestellt in allgemeine, sonstige und Sonderkrankenhäuser einteilen. Das Sachziel von Krankenhäusern ist somit die teil- und vollstationäre Krankenversorgung (Intensiv-, Normal-,Langzeit-, Kurzzeitpatienten).[15] Hinzu kommen ambulante Tätigkeiten, Lehre und Forschung an größeren Häusern. Abgesehen davon kommt den Krankenhäusern nicht nur regional die Bedeutung als wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor zu. So waren im Jahr 2001 in Deutschland in ca. 2200 Krankenhäusern über 1,1 Millionen Menschen unmittelbar beschäftigt. Das entspricht ungefähr einem Viertel der Beschäftigten im Gesundheitswesen und verursacht ca. ein Viertel der Ausgaben der Gesetzliche Krankenversicherung (GKV).[16]
Trägerschaft
Im Krankenhaussektor lassen sich drei unterschiedliche Träger ausmachen:[17]
1. Öffentliche Krankenhäuser werden von Gebietskörperschaften wie Bund, Ländern oder Gemeinden betrieben und unterhalten.
2. Freigemeinnützige sind von kirchlichen Trägern, Stiftungen und Vereinen getragen.
3. Private sind als gewerbliche Unternehmen durch Privatpersonen oder privatrechtliche Unternehmen bewirtschaftet.
Existieren mehrere Träger, wird der mit der überwiegenden Beteiligung oder größten Geldlast angegeben.[18] Dem Krankenhausträger obliegt die Verantwortung für die Leistungsfähigkeit, Qualität, und Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses sowie die Erfolgsüberwachung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung (siehe externe Qualitätssicherung, Kap. 5.1).[19] Demgegenüber ist die Krankenhausleitung für die eigentliche Durchführung derartiger Maßnahmen zuständig (siehe interene Qualitätssicherung, Kap. 5.1).
Finanzierung
Seit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 1972 ist eine duale Finanzierung für Krankenhäuser charakteristisch.[20] Dahinter verbirgt sich, dass Investitionskosten vom Träger und den Länder übernommen werden, während für die laufenden Kosten des Krankenhausbetriebes, d. h. die eigentliche Leistungserstellung, die Krankenkassen und Versicherungen aufkommen.[21] Das ergab sich dadurch, dass aufgrund des Sicherstellungsauftrags der ärztlichen[22] Versorgung und des Optionsgutcharakters[23] von Gesundheitsleistungen jeder Bürger für die Errichtung nötiger Einrichtungen hinzugezogen werden sollte, für die eigentliche Inanspruchnahme und Versorgung (Prozessdimension) jedoch dann nur der Betroffene oder Patient selbst aufkommt. Die dahintersteckende Bürokratie führte aber eher dazu, dass Investitionen zu spät, gar nicht oder in falscher Höhe ausfielen. Dagegen erhalten Unternehmen sowie niedergelassene Ärzte ihre Infrastruktur auch nicht gestellt, sondern müssen die Investitionsausgaben in ihren Preisen und Kosten berücksichtigen. Da die Investitionen außerdem Landessache waren, entstanden deutschlandweit unterschiedliche Standards in der Strukturqualität.[24] Das Gesundheitsreformgesetz (GRG) 2000 enthielt, neben der Einführung von fall- und leistungsorientierten pauschalierenden Vergütungssystemen[25] wieder die Forderung nach einer monistischen[26] Finanzierung,[27] bei der die Krankenhäuser selbst dafür verantwortlich sind worin, wann und wieviel investiert wird. Die Struktur eines Krankenhauses sowie darauf aufbauende Prozesse gewinnen unabhängig von Krankenhausart und Träger an Bedeutung und müssen in Qualitätsmanagementsystemen Beachtung finden. Einige unwirtschaftliche und kleinere Häuser werden dann jedoch sicher vom Markt verschwinden, andere in Verbundsysteme aufgehen, sobald sich das Land aus der Finanzierung zurückzieht. Durch weniger Fehlinvestitionen und Mittelverschwendungen werden so Einsparungen und geringerer volkswirtschaftlichen Verlust erwartet.
[...]
[1] Vgl. im Folgenden: Bruckenberger ( Aktuelle Tendenzen, 2001), S. 1. sowie Gorschlüter (Effektivität und Effizienz, 2001), S. 6.
[2] Durchschnittliche Ausgaben unter 15jähriger: 1.000 Euro pro Kopf, 85jährige 12.430 Euro, vgl. Statistisches Bundesamt (Ausgaben pro Kopf, 2004), [zit. nach Retzlaff (Teure Alte, 2004), S. 1].
[3] Neue Technologien bieten aber auch Rationalisierungspotential.
[4] Vgl. Kaltenbach (TQM im Krankenhaus, 1993), S. 279.
[5] Vgl. Prakke/Flerchinger (Qualitätsentwicklung Pflege, 1999), Einleitung.
[6] Vgl. Statistisches Bundesamt (Eckdaten, 2003): Anzahl Patienten jährlich ca. +1 %, Anteil >65jähriger +4 %.
[7] Gesundung, Vorgehen/Prozesse usw.
[8] Vgl. Benkenstein (Dienstleistungsqualität, 1994), S. 426.
[9] Der Kostenbegriff kann hier sehr weit gefasst werden: direkte Kosten der Behandlung, indi- rekte indirekte Kosten über die Sterblichkeit und Verlust an Humankapital sowie intangible Kosten in Form von Leid u. a. der Angehörigen, vgl. hierzu Niemann (Ökonomische Bewer- tung, 1996), S. 138.
[10] Vgl. Butthof (Ausländische Akkreditierungssysteme, 2003), S. 3.
[11] Vgl. im Folgenden u.a.: Noftz (SGB V kommentiert, 1989-), § 107 SGB V.
[12] Vgl. Hribek (Patientenzufriedenheit, 1999), S.22.
[13] Noftz (SGB V kommentiert, 1989-), §107 Abs. 1 SGB V.
[14] Vgl. Noftz (SGB V kommentiert, 1989-), § 107 Abs. 2 SGB V.
[15] Vgl. auch im Folgenden: Eichhorn (Krankenhausbetriebslehre, 1987), S. 7.
[16] Vgl. Statisches Bundesamt (Gesundheitspersonal, 2002) sowie Statistisches Bundesamt ( Gesundheitsausbaben, 2004).
[17] Vgl. im Folgenden: Janssen (Wirtschaftlichkeitsbewertung, 1999), S. 31 f.
[18] Vgl. Winkelmann (Ansätze zur Qualitätsmessung, 2001), S. 6, beispielsweise zählt ein recht-
lich selbstständiges Krankenhaus (z. B. GmbH) zu den öffentlichen, wenn eine Gebietskör- perperschaft eine Beteiligung am Nennkapital oder Stimmrecht von mehr als 50 % hält.
[19] Vgl. auch im Folgenden: BMG (Medizinischen Qualitätssicherung, 1994), S. 27.
[20] Vgl. Brandecker/Dietz/Bofinger (Krankenhausfinanzierungsgesetz kommentiert, 1991), S.
36 (§ 4 KHG).
[21] Vgl. Hildebrand (Das bessere Krankenhaus, 1999), S. 21.
[22] Ausreichende Versorgung muss flächendeckend gewährleistet sein, gerade für Notfalle sind Reserven nötig.
[23] Gesunde benötigen Gesundheitsleistungen erst, wenn sie krank sind.
[24] Vgl. Hildebrand (Das bessere Krankenhaus, 1999), S. 21.
[25] Vergleiche Diagnosis Related Groups (DRG), Sonderregelungen für Psychatrie und Lehrkrankenhäuser.
[26] Vgl. Mühlbauer (Krankenhausmanagement, 1997), S. 17 f.: Monistik: alle Finanztströme der
Krankenkassen laufen in den Preisen für die erbrachte Leistung zusammen.
[27] Vgl. Bruckenberger (Aktuelle Tendenzen, 2001), S. 3.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Qualitätsmanagement (QM) im Krankenhaus heute unverzichtbar?
Herausforderungen wie der medizinische Fortschritt, der demografische Wandel und gesetzliche Kostendämpfungsmaßnahmen zwingen Krankenhäuser zu mehr Effizienz und Transparenz bei gleichzeitig hoher Behandlungsqualität.
Was sind die drei Dimensionen der Qualität im Krankenhaus?
Man unterscheidet nach Donabedian zwischen Strukturqualität (Ausstattung), Prozessqualität (Abläufe) und Ergebnisqualität (Behandlungserfolg und Patientenzufriedenheit).
Welche QM-Systeme werden in deutschen Krankenhäusern eingesetzt?
Gängige Systeme sind die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, das EFQM-Modell sowie spezifisch für den Gesundheitssektor entwickelte Verfahren wie KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen).
Was ist der Unterschied zwischen Patienten und Kunden im Gesundheitswesen?
Ein Wertewandel macht aus Patienten zunehmend Kunden, die höhere Anforderungen an Service, Information und Wahlfreiheit stellen, was die Krankenhäuser zu einer stärkeren Marktorientierung zwingt.
Wie wird Patientenzufriedenheit gemessen?
Die Messung erfolgt meist über standardisierte Befragungen, die Kriterien wie die Dauer der Behandlung, die Qualität der Pflege und die Kommunikation mit den Ärzten bewerten.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm. Andreas Schneider (Author), 2004, Qualitätsmanagement im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88735