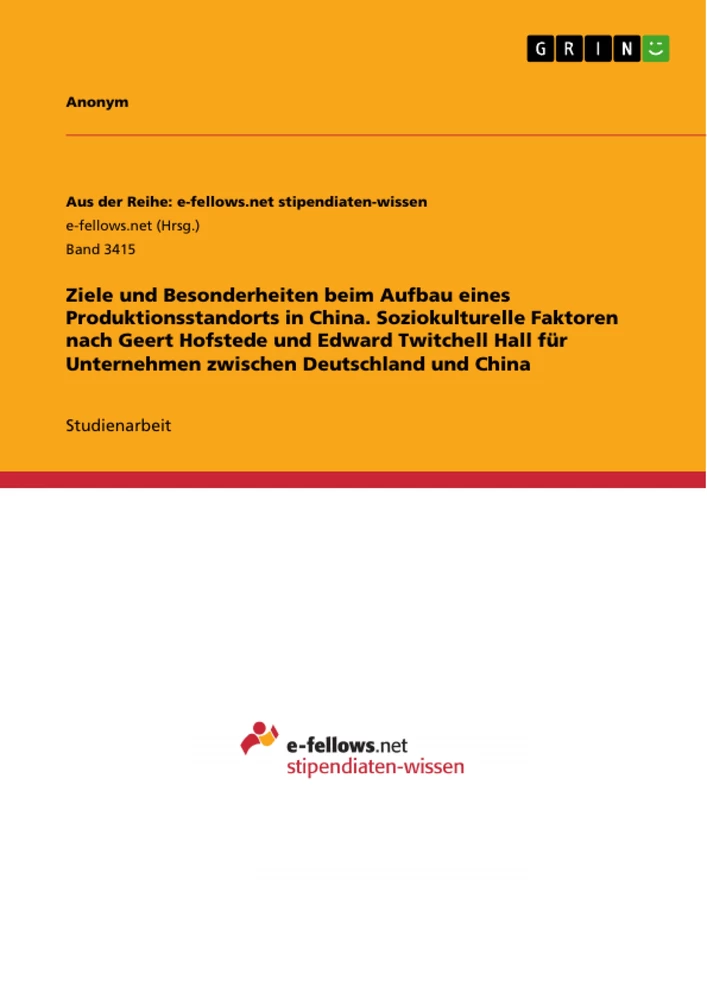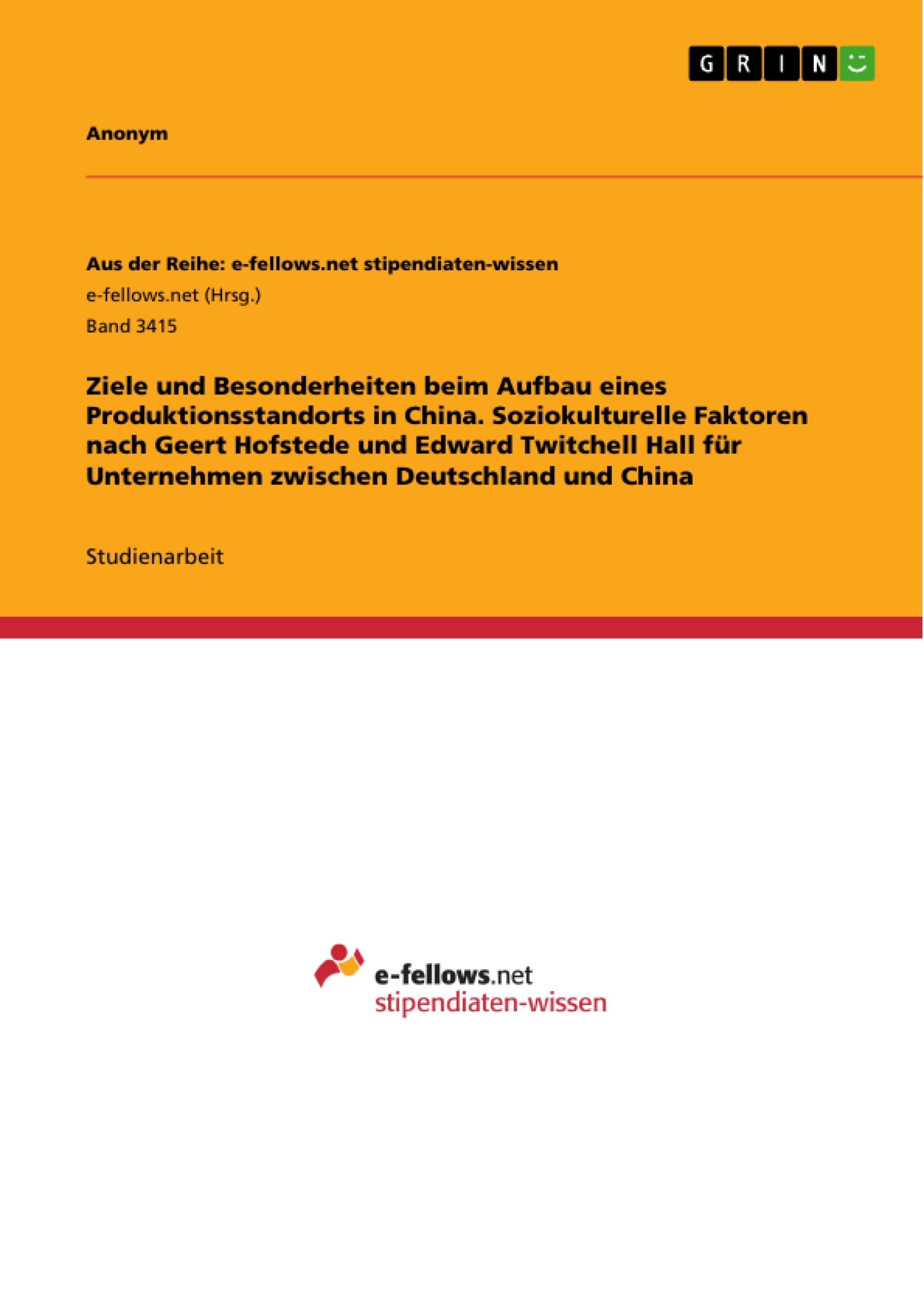In dieser Arbeit geht es um die soziokulturellen Faktoren, mit denen sich jedes Unternehmen auseinandersetzen muss, wenn es plant eine neue Produktion in China aufzubauen. Zuerst erfolgt eine kurze Darstellung der Ziele, die mit der Auslagerung eines Teils der Produktion nach China typischerweise verbunden sind. Diesem Kapitel folgt eine Darstellung ausgewählter kulturtheoretischer Ansätze und deren Ausprägungen in China und in Deutschland. Dabei wird in einem ersten Schritt auf die Kulturdimensionen nach Geert Hofstede eingegangen und anschließend werden die Kulturtheorien von Edward Twitchel Hall in diesem Kontext eingeordnet. Ein Fazit am Schluss der Arbeit fasst die wesentlichen Erkenntnisse zusammen.
Unternehmen können mit einer Auslagerung eines Teils ihrer Produktion in ein anderes Land unterschiedlichste Ziele verfolgen. Es kann dabei zum Beispiel zwischen ressourcenorientierten, effizienzorientierten und strategisch motivierten Zielen unterschieden werden. Bei dem ressourcenorientierten Motiv geht es vor allem um den Zugriff auf diverse Ressourcen, wie zum Beispiel knappe Rohstoffe oder speziell ausgebildete Arbeitskräfte. Das effizienzorientierte Motiv umfasst alle Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungspotentiale, die durch die Auslagerung der Produktion ins Ausland genutzt werden können. Das können zum Beispiel Kostensenkungen durch günstigere Energie- oder Rohstoffpreise und ein günstigeres Lohnniveau im jeweiligen Zielland im Vergleich zum Inland sein. Die dritte Kategorie, die strategisch motivierte Auslagerung der Produktion, kann zum Beispiel den Ausbau der eigenen Kompetenz zum Ziel haben. Denkbar sind dabei ebenfalls die strategischen Vorgaben innerhalb einer Unternehmensgruppe oder der Zugang zu neuen Märkten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele des Aufbaus einer neuen Produktion in China
- Kulturelle Besonderheiten Chinas im Vergleich zu Deutschland
- Kulturdimensionen nach Geert Hofstede
- Machtdistanz
- Vermeidung von Unsicherheiten
- Individualismus und Kollektivismus
- Maskulinität und Femininität
- Langzeit- oder Kurzzeitorientierung
- Kulturtheorien von Edward T. Hall
- Zeitverständnis
- Kontext in der Kommunikation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziokulturellen Faktoren, die bei der Gründung eines Produktionsstandorts in China zu beachten sind. Zuerst werden die typischen Ziele einer solchen Auslagerung beleuchtet. Anschließend werden ausgewählte kulturtheoretische Ansätze vorgestellt und deren Ausprägungen in China und Deutschland verglichen.
- Ziele der Produktionsverlagerung nach China
- Kulturdimensionen nach Geert Hofstede: Machtdistanz, Vermeidung von Unsicherheiten, Individualismus vs. Kollektivismus, Maskulinität vs. Femininität, Langzeit- vs. Kurzzeitorientierung
- Kulturtheorien von Edward T. Hall: Zeitverständnis, Kontext in der Kommunikation
- Vergleich der kulturellen Ausprägungen in China und Deutschland
- Herausforderungen und Chancen bei der Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Arbeit befasst sich mit den soziokulturellen Faktoren, die bei der Gründung eines Produktionsstandorts in China relevant sind. Die Arbeit stellt die Ziele der Produktionsverlagerung vor und gibt einen Überblick über wichtige kulturtheoretische Ansätze.
Ziele des Aufbaus einer neuen Produktion in China
Unternehmen können mit einer Auslagerung ihrer Produktion verschiedene Ziele verfolgen. Ressourcenorientierte Ziele beziehen sich auf den Zugang zu Ressourcen wie Rohstoffen oder Arbeitskräften. Effizienzorientierte Ziele zielen auf Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen ab. Strategisch motivierte Ziele können den Ausbau der eigenen Kompetenz oder den Zugang zu neuen Märkten beinhalten.
Kulturelle Besonderheiten Chinas im Vergleich zu Deutschland
Dieses Kapitel befasst sich mit ausgewählten kulturellen Besonderheiten in China und Deutschland. Es werden die Kulturdimensionen nach Geert Hofstede und die Kulturtheorien von Edward T. Hall vorgestellt.
Kulturdimensionen nach Geert Hofstede
Geert Hofstede hat fünf Kulturdimensionen identifiziert, die in verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgeprägt sind. Diese Dimensionen sind Machtdistanz, Vermeidung von Unsicherheiten, Individualismus vs. Kollektivismus, Maskulinität vs. Femininität und Langzeit- vs. Kurzzeitorientierung.
Kulturtheorien von Edward T. Hall
Edward T. Hall hat sich mit dem Zeitverständnis und dem Kontext in der Kommunikation beschäftigt. Seine Theorien liefern wichtige Erkenntnisse für die interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit.
Schlüsselwörter
Soziokulturelle Faktoren, Produktionsstandort, China, Deutschland, Kulturdimensionen, Geert Hofstede, Edward T. Hall, Machtdistanz, Vermeidung von Unsicherheiten, Individualismus, Kollektivismus, Maskulinität, Femininität, Langzeit- und Kurzzeitorientierung, Zeitverständnis, Kontext, interkulturelle Kommunikation, Unternehmenskultur.
Häufig gestellte Fragen
Welche Ziele verfolgen Unternehmen beim Aufbau einer Produktion in China?
Ziele können ressourcenorientiert (Rohstoffe), effizienzorientiert (Lohnkosten) oder strategisch (Marktzugang) motiviert sein.
Was sagen die Kulturdimensionen nach Geert Hofstede über China aus?
China zeichnet sich im Vergleich zu Deutschland oft durch eine höhere Machtdistanz, starken Kollektivismus und eine ausgeprägte Langzeitorientierung aus.
Welche Rolle spielt der "Kontext" in der Kommunikation nach Edward T. Hall?
China ist eine High-Context-Kultur, in der viel Information zwischen den Zeilen und durch die Situation vermittelt wird, während Deutschland eher Low-Context (direkt) ist.
Wie unterscheidet sich das Zeitverständnis zwischen Deutschland und China?
Deutschland ist eher monochron geprägt (linearer Zeitablauf), während China oft polychrone Züge aufweist (viele Dinge gleichzeitig, Flexibilität).
Was sind die größten soziokulturellen Herausforderungen für deutsche Manager?
Die Herausforderungen liegen im Verständnis von Hierarchien, der Bedeutung von "Gesichtswahrung" und den unterschiedlichen Kommunikationsstilen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Ziele und Besonderheiten beim Aufbau eines Produktionsstandorts in China. Soziokulturelle Faktoren nach Geert Hofstede und Edward Twitchell Hall für Unternehmen zwischen Deutschland und China, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/888828