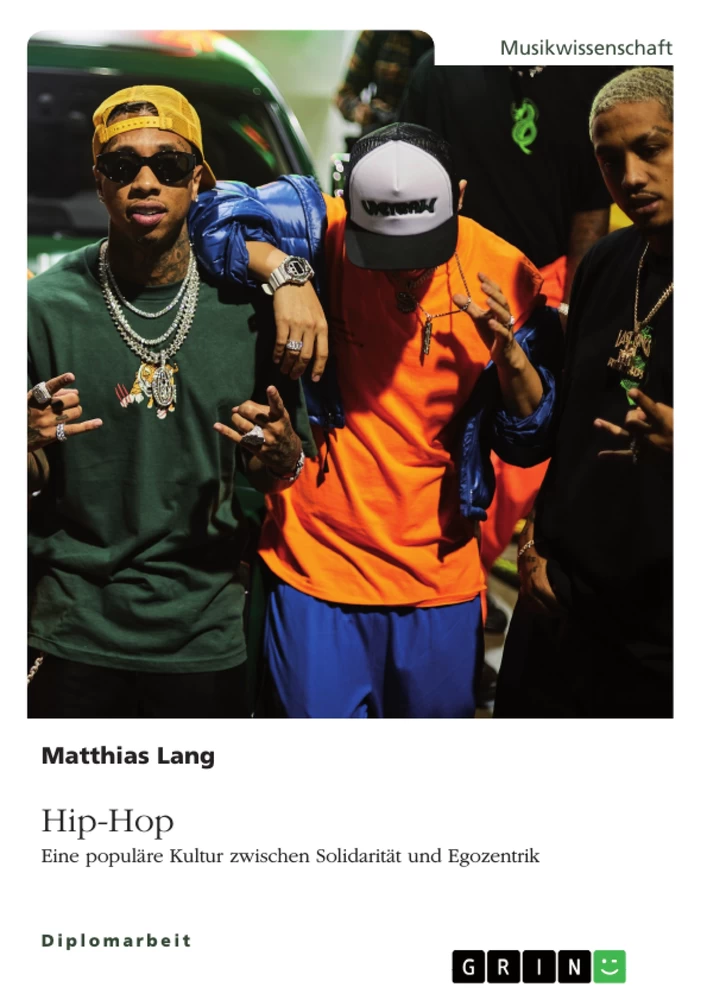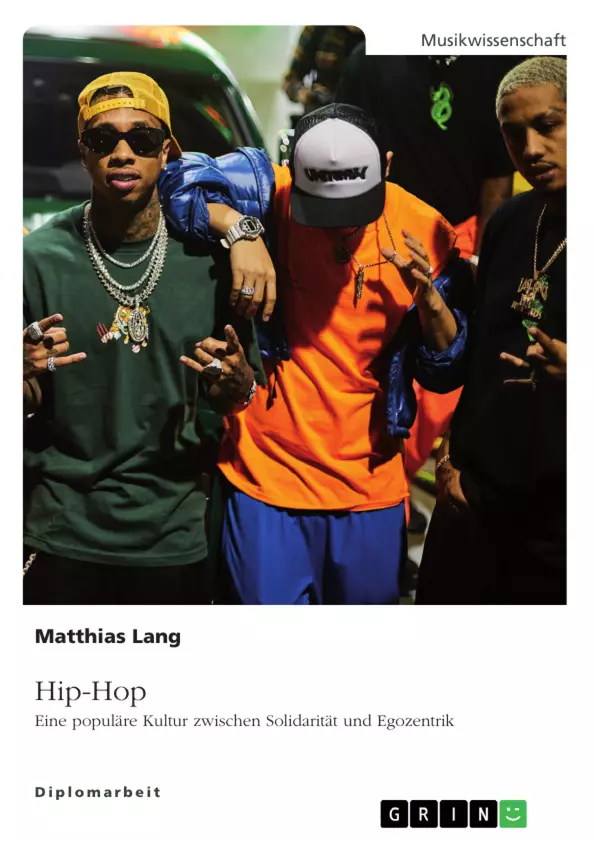HipHop ist eine populäre Kultur, die auf Mode, Sprache, Konsum-, Sozial- und Sexualverhalten Jugendlicher erstaunlichen Einfluss hat. Dabei befindet sie sich stets in einem Spannungsfeld zwischen Solidarität und Egozentrik. Diese Arbeit beschreibt zuerst, wie sich HipHop von einer Subkultur zu einer populären Kultur entwickelte. Im zweiten Kapitel wird dann insbesondere auf das Zusammenwirken von Kollektiv und Individuum innerhalb des neuen Kontextes eingegangen.
In den 1970er Jahren wurde der Musikstil Disco populär und sorgte mit dem Film Saturday Night Fever [Samstagnacht-Fieber] für ein weltweites Massenspektakel. Mit der Zeit fand die neue Musikrichtung Zugang zu der glamourösen Welt der Schickeria von New York, wo sich Tanzbegeisterte in privaten Clubs oder teuren Etablissements der Großstadt trafen, um ihrem hedonistischen Lebensstil Ausdruck zu verleihen.
Die französische Bezeichnung „discothèque“ setzte sich allmählich für jene Tanzclubs durch, deren Merkmal stets eine von Schallplatten gespielte Musik war. Nun standen nicht mehr die Sänger oder Musiker im Mittelpunkt, die ein Publikum unterhielten, sondern der Einzelne, der für sich selbst tanzte. Die Elemente Party, Clubs, Tanz, Nachtleben usw. sollten für nachfolgende Musikrichtungen von zentraler Bedeutung bleiben.
Währenddessen entstand in der Bronx von New York ein anderer Stil, der dem Glanz und Glamour der Discoszene eine ärmliche Subkultur entgegensetzte – HipHop. Die Bronx waren von je her Symbol städtischer Verwahrlosung. Graffiti überzogene Hauswände, verkommene Plattenbauten, alte Ruinen usw. stellten hier gleichzeitig den Alltag der schwarzen und den Alptraum der weißen Bevölkerung dar. Durch den großen Zustrom von Immigranten aus allen Teilen der Welt und den kaum mehr lösbaren sozialen und verkehrstechnischen Problemen nahm das Bandenunwesen und somit auch die Kriminalität in jenem Viertel der Stadt enorm zu. Kaum vorstellbar, dass sich ausgerechnet in der Bronx eine Kultur entwickeln sollte, die über mehrere Jahrzehnte hinweg die Popmusik prägen würde.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Old School (1974 bis 1984)
- 1.1 HipHop als Subkultur
- 1.2 Direkter Wettbewerb als eine Form von Solidarität
- 2 New School (1984 bis dato)
- 2.1 HipHop als populäre Kultur
- 2.2 Indirekter Wettbewerb als eine Form von Egozentrik
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Entwicklung von HipHop von einer Subkultur zu einer populären Kultur und analysiert das Spannungsfeld zwischen Solidarität und Egozentrik innerhalb dieser Kultur. Die Arbeit beleuchtet die Ursprünge von HipHop in der Bronx und dessen Einfluss auf die Popmusik.
- Entwicklung von HipHop als Subkultur zur populären Kultur
- Das Zusammenspiel von Kollektiv und Individuum im HipHop
- Solidarität und Wettbewerb innerhalb der HipHop-Kultur
- Der Einfluss von HipHop auf das Sozialverhalten Jugendlicher
- HipHop im Kontext sozialer und wirtschaftlicher Bedingungen der Bronx
Zusammenfassung der Kapitel
1 Old School (1974 bis 1984): Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von HipHop in der Bronx der 1970er Jahre als Reaktion auf die glamouröse Discoszene. Es wird der Kontext von Armut, sozialem Zerfall und Bandenkriminalität beleuchtet, der die Entwicklung von HipHop als Subkultur prägte. Die vier Elemente – B-Boying (Breakdance), Writing (Graffiti), DJing und MCing – werden als Ausdruck von Kreativität und Solidarität innerhalb einer benachteiligten Community dargestellt. Der direkte Wettbewerb zwischen verschiedenen Crews wird als eine Form von innerer Solidarität und Gemeinschaftsgefühl interpretiert, die die Szene zusammenhielt. Die Entwicklung der einzelnen Elemente und ihre Wechselwirkung wird detailliert geschildert.
2 New School (1984 bis dato): Im zweiten Kapitel wird die Transformation von HipHop von einer Subkultur zu einer populären Kultur untersucht. Es wird der Wandel von direktem zu indirektem Wettbewerb analysiert, der mit dem Aufstieg von HipHop im Mainstream einherging. Die Kapitelthemen "Be tough!" und "Be cool!" repräsentieren die zwei Seiten der Medaille: den Umgang mit den Herausforderungen des Lebens und den Selbstausdruck des erfolgreichen Künstlers. Der Text analysiert, wie der individuelle Erfolg im Kontext der HipHop-Kultur mit dem ursprünglichen Solidaritätsgedanken interagiert und teilweise in Konflikt gerät. Die Kommerzialisierung von HipHop und deren Auswirkungen auf die ursprüngliche Ethik der Bewegung werden ebenfalls thematisiert. Die Kapitel untersuchen den Übergang zur Konsumkultur und den damit verbundenen Anstieg des Egozentrismus.
Schlüsselwörter
HipHop, Subkultur, Populärkultur, Solidarität, Egozentrik, Bronx, New York, Breakdance, Graffiti, DJing, MCing, Direkter Wettbewerb, Indirekter Wettbewerb, Sozialverhalten, Jugendkultur, Kommerzialisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: HipHop – Von der Subkultur zur Populärkultur
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des HipHop von seinen Anfängen als Subkultur in der Bronx bis hin zu seiner heutigen Stellung als globale Populärkultur. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse des Spannungsfeldes zwischen Solidarität und Egozentrik innerhalb der HipHop-Kultur im Laufe dieser Entwicklung.
Welche Zeiträume werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit teilt die Geschichte des HipHop in zwei Abschnitte ein: "Old School" (1974-1984) und "New School" (1984 bis heute). Diese Einteilung erlaubt es, die Entwicklung der Kultur über verschiedene Phasen hinweg zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus zwei Hauptkapiteln: Kapitel 1 ("Old School") befasst sich mit der Entstehung des HipHop als Subkultur in der Bronx, während Kapitel 2 ("New School") die Transformation zu einer Populärkultur und die damit einhergehenden Veränderungen in der Kultur beschreibt.
Welche Themen werden im Kapitel "Old School" behandelt?
Kapitel 1 beschreibt die Entstehung des HipHop als Reaktion auf die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen der Bronx der 1970er Jahre. Es analysiert die vier Elemente des HipHop (B-Boying, Writing, DJing, MCing) als Ausdruck von Kreativität und Solidarität innerhalb einer benachteiligten Community. Der Fokus liegt auf dem direkten Wettbewerb zwischen verschiedenen Crews als eine Form von innerer Solidarität.
Welche Themen werden im Kapitel "New School" behandelt?
Kapitel 2 untersucht den Wandel von direktem zu indirektem Wettbewerb im Zusammenhang mit dem Aufstieg des HipHop im Mainstream. Es analysiert den Konflikt zwischen individuellem Erfolg und dem ursprünglichen Solidaritätsgedanken der Bewegung. Die Kommerzialisierung von HipHop und die Auswirkungen auf die ursprüngliche Ethik werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit zentral?
Zentrale Begriffe sind: HipHop, Subkultur, Populärkultur, Solidarität, Egozentrik, Bronx, New York, Breakdance, Graffiti, DJing, MCing, direkter Wettbewerb, indirekter Wettbewerb, Sozialverhalten, Jugendkultur, Kommerzialisierung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung des HipHop von einer Subkultur zu einer Populärkultur zu untersuchen und das Spannungsfeld zwischen Solidarität und Egozentrik innerhalb dieser Kultur zu analysieren. Dabei wird der Einfluss von HipHop auf die Popmusik und das Sozialverhalten Jugendlicher beleuchtet.
Welche Quellen wurden für die Arbeit verwendet? (Diese Frage kann nicht aus dem gegebenen Text beantwortet werden)
Die konkreten Quellen sind aus dem gegebenen Text nicht ersichtlich.
- Quote paper
- Matthias Lang (Author), 2007, Hip-Hop. Eine populäre Kultur zwischen Solidarität und Egozentrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/889004