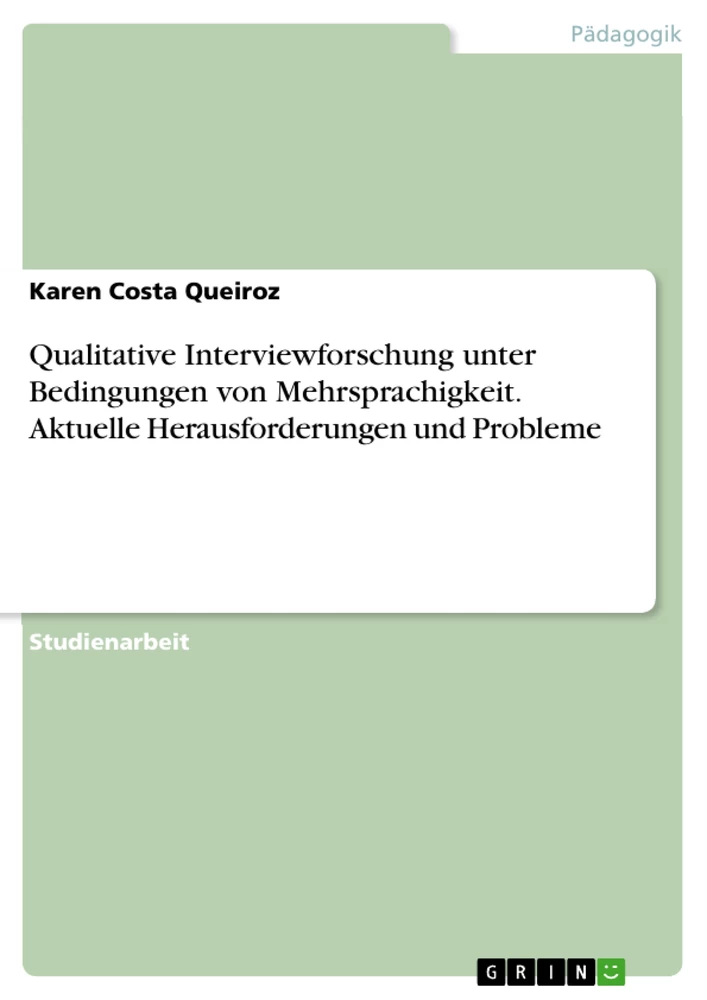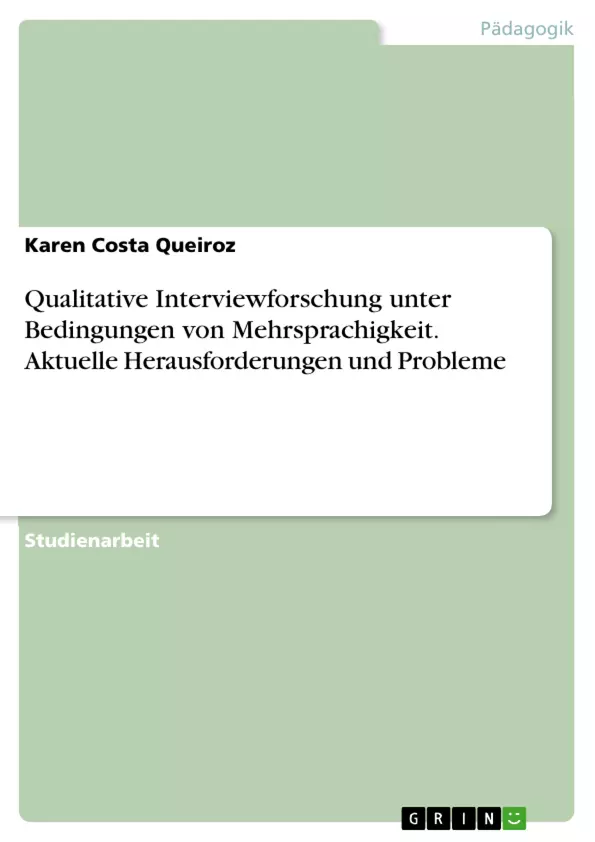In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich mich mit den Herausforderungen der qualitativen Interviewforschung und Problemen der Interviewführung unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit auseinandersetzen. Im ersten Teil führe ich zunächst in die qualitative Interviewforschung ein. Dabei gehe ich insbesondere auf das narrative Interview ein, das ein zentrales Verfahren in der qualitativen Forschung darstellt. Im dritten Teil setze ich mich mit der Bedeutung und den Herausforderungen von Mehrsprachigkeit in qualitativen Interviews unter Bedingungen von Migration auseinander. Anschließend skizziere ich anhand eines Beispiels aus der Forschungspraxis die praktischen Herausforderungen einer Interviewdurchführung unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit, bevor ich in der Abschlussbetrachtung die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfasse
Migration, Transnationalisierung und Globalisierung fordern nicht nur die theoretische Diskussion in der Erziehungswissenschaft heraus, sondern auch die Methoden der qualitativen Forschung. Die Interviewforschung, d.h. die Datenerhebung und Auswertung von Interviews, stellt einen zentralen Ansatz in der qualitativen Forschung dar. Es gibt zahlreiche Interviewformen, die von Leitfadeninterviews bis zu narrativen Interviews reichen, die in der Forschung eingesetzt werden. Die meisten dieser Verfahren sind in den 1970er Jahren im deutschsprachigen Raum in monolingualen Kontexten entwickelt worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Qualitative Forschung
- 1.1. Qualitative Interviewforschung
- 1.2. Die Gestaltung und die Durchführung des Interviews
- 2. Das narrative Interview in der qualitativen Forschung
- 3. Beispiel aus der Forschungspraxis
- 3.1. Eröffnung des Interviews
- 3.2. Haupterzählung
- 4. Qualitative Interviews unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit
- 4.1. Mehrsprachigkeit im Forschungsprozess
- 5. Schlussdiskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Herausforderungen der qualitativen Interviewforschung unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit. Sie befasst sich mit der Gestaltung und Durchführung von Interviews im Kontext von Migration und Transnationalisierung, wobei der Schwerpunkt auf dem narrativen Interview liegt.
- Qualitative Interviewforschung als zentrale Methode in der Erziehungswissenschaft
- Das narrative Interview als Instrument zur Erhebung von subjektiven Erfahrungen und Perspektiven
- Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit im Forschungsprozess
- Herausforderungen bei der Interviewführung unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit
- Praktische Beispiele aus der Forschungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und beleuchtet die Bedeutung von Mehrsprachigkeit in der heutigen Gesellschaft. Sie führt in die Thematik der qualitativen Interviewforschung ein und erläutert die Relevanz des narrativen Interviews für die Erhebung subjektiver Erfahrungen.
Kapitel 1 liefert eine Einführung in die qualitative Forschung. Es werden verschiedene Methoden und theoretische Ansätze vorgestellt und die Grundprinzipien der qualitativen Interviewforschung erörtert.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem narrativen Interview als spezifischer Methode der qualitativen Forschung. Es werden die Besonderheiten und Vorteile dieser Methode sowie die spezifischen Anforderungen an die Interviewführung hervorgehoben.
Kapitel 3 präsentiert ein Beispiel aus der Forschungspraxis, um die Herausforderungen und Chancen der Interviewdurchführung unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit zu veranschaulichen.
Kapitel 4 geht näher auf die Bedeutung und die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit im Forschungsprozess ein. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie zum Beispiel die Bedeutung der Sprachkenntnisse des Forschenden, die Auswahl geeigneter Interviewmethoden und die Analyse von Mehrsprachigkeitsdaten.
Schlüsselwörter
Qualitative Interviewforschung, Mehrsprachigkeit, Migration, Transnationalisierung, narratives Interview, Forschungspraxis, Sprachkenntnisse, Interviewführung, Datenauswertung, Erziehungswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Herausforderungen qualitativer Forschung bei Mehrsprachigkeit?
Herausforderungen liegen in der Datenerhebung und Auswertung, wenn Interviewer und Befragte unterschiedliche Erstsprachen sprechen, was die Validität der Ergebnisse beeinflussen kann.
Was ist ein narratives Interview?
Es ist eine Methode, bei der der Befragte frei erzählen kann. In monolingualen Kontexten entwickelt, stößt es unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit auf spezifische Barrieren.
Warum sind Sprachkenntnisse der Forschenden so wichtig?
Sprachkenntnisse entscheiden über den Zugang zum Feld, die Qualität der Eröffnung des Interviews und das Verständnis nuancierter kultureller Bedeutungen.
Wie wirken sich Migration und Transnationalisierung auf die Forschung aus?
Sie fordern klassische, oft monolingual konzipierte Methoden der Erziehungswissenschaft heraus und machen eine Sensibilisierung für mehrsprachige Forschungsprozesse notwendig.
Was zeigt das Praxisbeispiel in der Hausarbeit?
Anhand einer Haupterzählung wird skizziert, welche praktischen Probleme bei der Interviewdurchführung auftreten können, wenn mehrere Sprachen im Spiel sind.
- Citation du texte
- Karen Costa Queiroz (Auteur), 2020, Qualitative Interviewforschung unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit. Aktuelle Herausforderungen und Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/889444