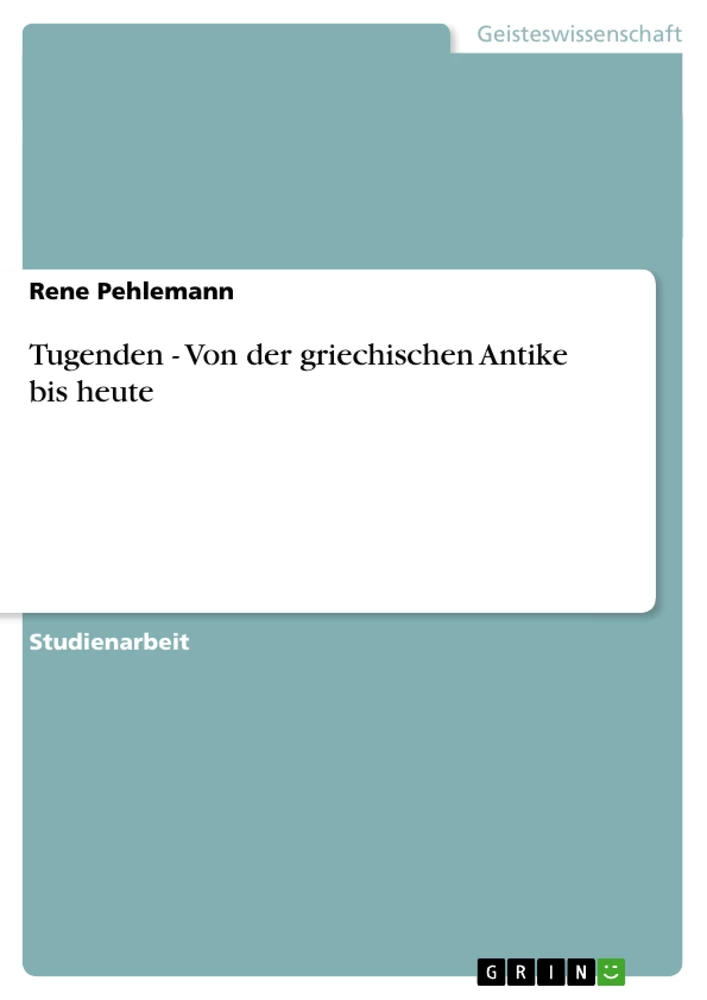I. Was ist Tugend?
Was Tugend ist, weiß ein jeder im alltäglichen Leben. Wo wir über unser eigenes Verhalten nachdenken, wo wir das Verhalten anderer beurteilen, überall orientieren wir uns an bestimmten Vorstellungen von dem, wie der Mensch sein soll. Der Begriff der Tugend ist seit Platon und Aristoteles als einer der Grundbegriffe der Ethik anzusehen. Aber um ihn richtig zu verstehen muss man diesen Begriff umfassend betrachten und erläutern. Vom griechischen Wort „aretè“ und vom lateinischen „virtus“ abgeleitet, kann der Grundbegriff entweder mit „Vortrefflichkeit“ oder auch mit „Bestheit“ übersetzt werden und setzt auch beim Menschen meist eine sittliche Haltung voraus. Daher nahm die Tugend in Annährung an den lateinischen Begriff mehr und mehr diese Bedeutung an. Ebenso ist Tugend die durch beständige Übung und Selbsterziehung gewonnene gute sittliche Eigenschaft und Grundhaltung eines Menschen, die in seinem Denken und Handeln als echte Menschlichkeit zum Ausdruck kommt. Des Weiteren ist Tugend die durch beständige Übung erworbene körperliche und geistige Fähigkeit, das, was in einer Gesellschaft als gut und wertvoll angesehen wird, mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit zu tun. Laut der Enzyklopädie der Philosophie ist Tugend die Gesamtheit der sittlich guten Eigenschaften, die sich vom Verhalten des Menschen aussagen lassen. Weitere verschieden Definitionen und Ansichten des Begriffes werden immer wieder in der Seminararbeit aufgeführt, da der Begriff sich in der Zeit von der Antike bis heute in einigen Punkten wandelte. Aber im Allgemeinen betrachtet beinhaltet die Tugend die Kraft, das sittlich Gute zu verwirklichen und zu erfüllen, und dies freudig wie auch beharrlich zu tun. Dies kann auch gegen innere und äußere Widerstände und unter Erbringung von Opfern geschehen. Von einer Tugend ist auszugehen, wenn die Verfolgung des sittlichen Guten nicht aus Zufall, Gewohnheit oder sozialem Zwang sondern aus Freiheit vollzogen wird. Dabei wird vorausgesetzt, dass die sittlich gebildete Persönlichkeit weder Werkzeug ihrer Treibkräfte ist, noch von sozialen Rollenerwartungen angetrieben wird. Vielmehr ist es nötig, dem kritisch gegenüberzustehen und aus Verantwortung für sich und seine Mitmenschen ein Leben zu führen, dass der Selbstverwirklichung dient und mit einer eigenen, der höchsten Form von Freude verbindet. In der Tugend werden im Menschen angelegte Möglichkeiten und Fähigkeiten entwickelt und vollendet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Was ist Tugend?
- II. Die Tugend von Platon
- III. Die Tugend von Aristoteles
- IV. Die Tugend von Thomas von Aquin
- V. Bürgerliche Tugenden
- VI. Preußische Tugenden
- VII. Die Tugend von Kant
- VIII. Die Tugend heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Tugendbegriffs von der griechischen Antike bis in die Gegenwart. Sie analysiert die verschiedenen philosophischen Ansätze zur Definition von Tugend und beleuchtet deren Relevanz für das menschliche Handeln.
- Definition und Entwicklung des Tugendbegriffs
- Philosophische Perspektiven auf Tugend (Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Kant)
- Tugend im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- Der Stellenwert von Tugend in der modernen Gesellschaft
- Die Bedeutung von Wissen und Selbstbeherrschung für tugendhaftes Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
I. Was ist Tugend?: Dieses einführende Kapitel beleuchtet den alltäglichen Umgang mit dem Tugendbegriff und seine Bedeutung in der Ethik. Es untersucht verschiedene Definitionen von Tugend, beginnend mit den griechischen und lateinischen Wurzeln ("aretè," "virtus") und ihren Übersetzungen als "Vortrefflichkeit" oder "Bestheit." Der Text betont die Bedeutung beständiger Übung und Selbsterziehung für die Entwicklung tugendhaften Verhaltens, welches sich in Denken und Handeln als echte Menschlichkeit ausdrückt. Die Fähigkeit, gesellschaftlich als gut und wertvoll angesehene Handlungen mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit auszuführen, wird ebenfalls als Merkmal von Tugend hervorgehoben. Das Kapitel schließt mit der Diskussion der Herausforderungen bei der Bestimmung des sittlich Guten und der Notwendigkeit einer kritischen Haltung und Realitätssinns für tugendhaftes Handeln.
II. Die Tugend von Platon: Dieses Kapitel widmet sich Platons Verständnis von Tugend in seiner „Politeia“. Platon betrachtet Tugend als eine Form des Guten, das höchste Prinzip von Erkenntnis und Wirklichkeit. Er analysiert die menschliche Persönlichkeit als Zusammenspiel von physischen Begierden, Temperament und Vernunft, wobei Konflikte zwischen diesen Elementen drohen. Um diese zu bewältigen, führt Platon die Kardinaltugenden ein: Wissen (sophia) als oberste Tugend, die die Unterscheidung von Gut und Böse ermöglicht; Mäßigkeit (sophrosyne) als Einschränkung physischer Bedürfnisse und harmonische Erfüllung von Wünschen; und Tapferkeit (andreia) als weitere wichtige Tugend. Platons Ansatz betont die Notwendigkeit von Wissen für die richtige Einordnung und Überwachung triebhafter Neigungen.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Tugend
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Wandel des Tugendbegriffs von der Antike bis in die Gegenwart. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener philosophischer Ansätze zur Definition von Tugend und deren Relevanz für menschliches Handeln.
Welche Philosophen werden behandelt?
Der Text behandelt die Tugendkonzepte von Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin und Kant. Es werden deren jeweilige Definitionen und Ansätze zur Beschreibung von Tugend analysiert und im Kontext ihrer Zeit beleuchtet.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel gegliedert, die jeweils einen spezifischen Aspekt des Tugendbegriffs behandeln. Er beginnt mit einer einführenden Betrachtung des allgemeinen Tugendverständnisses und beleuchtet anschließend die verschiedenen philosophischen Perspektiven. Weitere Kapitel befassen sich mit dem Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und dem Stellenwert von Tugend in der modernen Gesellschaft.
Was ist die zentrale Fragestellung des Textes?
Die zentrale Fragestellung des Textes ist die Untersuchung des Wandels des Tugendbegriffs über die Jahrhunderte hinweg und die Analyse seiner Bedeutung im menschlichen Handeln und gesellschaftlichen Kontext. Es wird untersucht, wie sich das Verständnis von Tugend von der Antike bis in die heutige Zeit verändert hat und welche Relevanz der Begriff in der modernen Gesellschaft besitzt.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Der Text enthält Zusammenfassungen für die Kapitel "Was ist Tugend?" und "Die Tugend von Platon". Kapitel 1 ("Was ist Tugend?") beleuchtet den alltäglichen und ethischen Umgang mit dem Begriff, seine griechischen und lateinischen Wurzeln und die Bedeutung beständiger Übung für tugendhaftes Handeln. Kapitel 2 ("Die Tugend von Platon") beschreibt Platons Verständnis von Tugend in der "Politeia", einschließlich der Kardinaltugenden Sophia, Sophrosyne und Andreia.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Definition und Entwicklung des Tugendbegriffs, philosophische Perspektiven (Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Kant), Tugend im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen, der Stellenwert von Tugend in der modernen Gesellschaft und die Bedeutung von Wissen und Selbstbeherrschung für tugendhaftes Handeln.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die sich akademisch mit dem Thema Tugend auseinandersetzen möchten. Die Sprache und der Aufbau des Textes deuten auf eine Verwendung im akademischen Kontext hin.
- Citation du texte
- Diplom-Staatswissenschaftler Rene Pehlemann (Auteur), 2006, Tugenden - Von der griechischen Antike bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89018