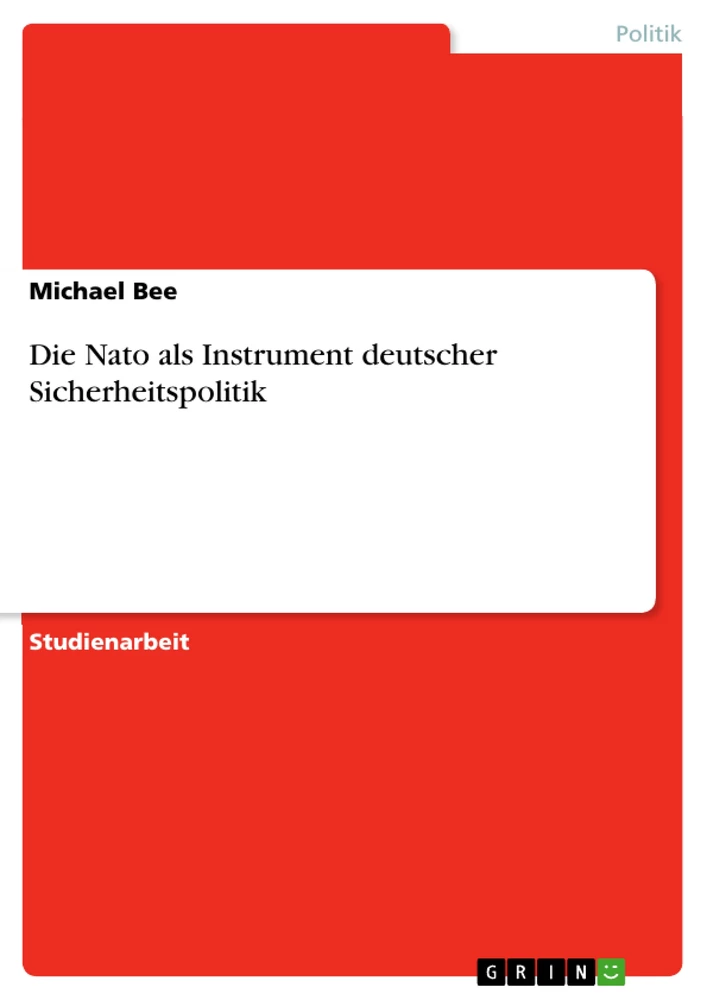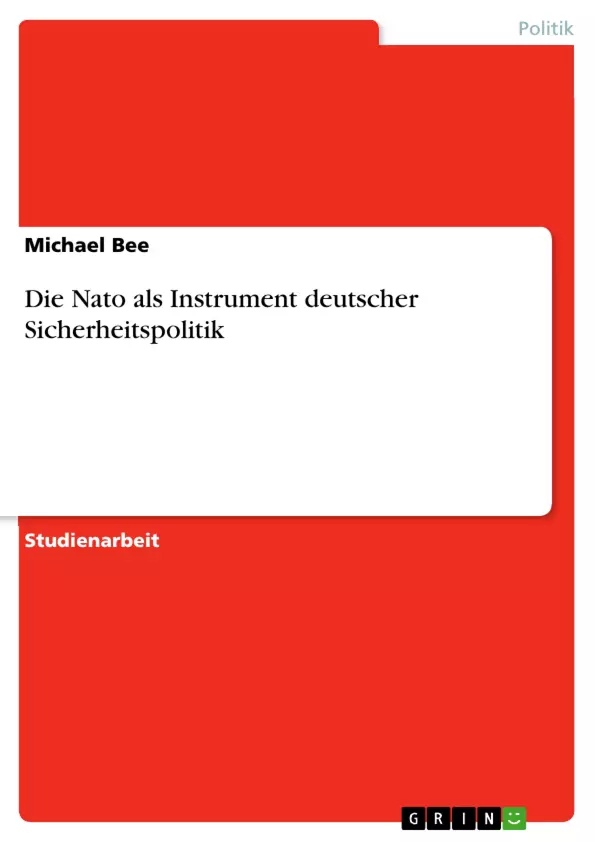Als eine Geschichte zwischen „Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung“ beschreibt Helga Haftendorn die Entwicklung der deutschen Außenpolitik von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Diese Etikettierung verweist auf eine spezifische Strategie nationaler Zurückhaltung, um im Rahmen multilateraler Institutionen und Kooperationen einen Souveränitätszuwachs durch Souveränitätsverzicht zu erzielen. Dies betrifft in besonderer Weise die deutsche Sicherheitspolitik. Denn die transatlantischen Beziehungen im Rahmen der Nato und der europäische Integrationsprozess bilden für Deutschland den entscheidenden Rahmen, in dem Sicherheitspolitik als kollektive Aufgabe verhandelt und wahrgenommen wird. Das Ende des Ost-West-Konfliktes und die „Neuordnung der Weltpolitik“ hin zu einer unipolaren Struktur unter US-amerikanischer Führung, spätestens aber die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus nach den Anschlägen vom 11. September 2001, stellen die Frage nach der Ausrichtung deutscher Sicherheitspolitik neu.
Grundlegend für diese Hausarbeit ist die These, dass der Strukturwandel des internationalen Systems nach Ende des Ost-West-Konfliktes auch einen Wandel der auf Kontinuität bedachten deutschen Sicherheitspolitik bedingt. Oder konkreter gewendet: Die unipolare Weltordnung zwingt deutsche Bundesregierungen zu einer veränderten Sicherheitspolitik mit verbreitertem Aufgabenspektrum und verengtem Handlungsspielraum. Dabei sind deutsche Entscheidungsträger dazu gezwungen, traditionelle und bewährte Aktionsmuster aufzugeben.
Ich möchte in dieser Hausarbeit den Versuch unternehmen, diese These am Beispiel der deutschen Nato-Politik empirisch zu verdeutlichen und ihre Entwicklung unter diesem verengten Focus nachzuvollziehen. Das Konzept des Neorealismus dient mir dabei als theoretische Fundierung, die eine Selektion des kaum zu überschauenden Forschungsmaterials rechtfertigen kann. In einem ersten Schritt soll erläutert werden, wie sicherheitspolitisches Handeln aus neorealistischer Perspektive zu erklären ist (2.1). Mit diesem Instrumentarium sind die wesentlichen Strukturmerkmale des internationalen Systems während des Ost-West-Konfliktes und die daraus ableitbaren Restriktionen für sicherheitspolitisches Handeln fassbar (2.2). Eingebettet in diese theoretischen und historischen Koordinaten möchte ich im Anschluss die grundlegenden Traditionslinien deutscher Nato-Politik bis zur Wiedervereinigung offen legen (2.3).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Kontinuität und Wandel deutscher Nato-Politik
- 2. Souveränitätsgewinn durch Souveränitätsverzicht: Theoretische und historische Verortung deutscher Nato-Politik
- 2.1 Kerngedanken des Neorealismus
- 2.2 Restriktionen außenpolitischen Handelns unter bipolaren Voraussetzungen
- 2.3 Aspekte deutscher Nato-Politik während des Ost-West-Konfliktes
- 3. Aktuelle Analyse deutscher Nato-Politik
- 3.1 Nach der Zeitenwende: Unipolarität als Bedingungsrahmen deutscher Nato-Politik
- 3.2 Deutschland und die Umgestaltung der Nato
- 3.3 Neue Herausforderungen durch veränderte Bedrohungswahrnehmung
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die deutsche Nato-Politik im Kontext des Strukturwandels des internationalen Systems nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes. Sie argumentiert, dass die unipolare Weltordnung die deutsche Sicherheitspolitik zu einer veränderten Ausrichtung mit verbreitertem Aufgabenspektrum und verengtem Handlungsspielraum zwingt. Die Arbeit analysiert, wie deutsche Entscheidungsträger traditionelle Aktionsmuster aufgeben müssen, um sich den neuen Herausforderungen zu stellen.
- Entwicklung der deutschen Nato-Politik im Spannungsfeld zwischen „Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung“
- Anwendung des Neorealismus als theoretisches Instrumentarium zur Analyse der Struktur des internationalen Systems
- Restriktionen für sicherheitspolitisches Handeln unter bipolaren und unipolaren Voraussetzungen
- Die Rolle der Nato für die verschiedenen Bundesregierungen seit der Wiedervereinigung
- Die Auswirkungen neuer Herausforderungen auf die sicherheitspolitische Bedrohungswahrnehmung der Bundesrepublik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 legt den thematischen Rahmen der Arbeit fest und führt in die Problematik der deutschen Nato-Politik im Kontext des Strukturwandels des internationalen Systems ein. Die These der Arbeit wird präsentiert: Die unipolare Weltordnung erzwingt eine veränderte Ausrichtung deutscher Sicherheitspolitik.
Kapitel 2 analysiert die theoretischen und historischen Grundlagen deutscher Nato-Politik. Hierbei werden zunächst die Kerngedanken des Neorealismus und deren Bedeutung für die Analyse sicherheitspolitischen Handelns erläutert. Im Anschluss werden die Restriktionen für außenpolitisches Handeln unter bipolaren Voraussetzungen im Rahmen des Ost-West-Konfliktes dargestellt. Abschließend werden die zentralen Traditionslinien deutscher Nato-Politik bis zur Wiedervereinigung beleuchtet.
Kapitel 3 untersucht die jüngere Vergangenheit deutscher Nato-Politik. Es wird die Struktur des internationalen Systems nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes skizziert, und anschließend die Rolle der Nato für die verschiedenen Bundesregierungen seit der Wiedervereinigung analysiert. Des Weiteren werden die Auswirkungen von neuen Herausforderungen auf die sicherheitspolitische Bedrohungswahrnehmung der Bundesrepublik diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die deutsche Nato-Politik, Neorealismus, bipolare und unipolare Weltordnung, Sicherheitsdilemma, Machtpolitik, Sicherheitspolitik, Bedrohungswahrnehmung, Ost-West-Konflikt, Wiedervereinigung, transatlantische Beziehungen, europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Souveränitätsgewinn durch Souveränitätsverzicht“?
Es beschreibt die deutsche Strategie, durch Einbindung in multilaterale Organisationen wie die NATO eigene Sicherheit zu garantieren und politischen Einfluss zu gewinnen, indem man Teile der nationalen Souveränität abgibt.
Wie veränderte sich die deutsche NATO-Politik nach dem Kalten Krieg?
Der Übergang von einer bipolaren zu einer unipolaren Weltordnung zwang Deutschland zu einem breiteren Aufgabenspektrum bei gleichzeitig verengtem Handlungsspielraum.
Welche Rolle spielt der Neorealismus in dieser Analyse?
Der Neorealismus dient als theoretische Basis, um sicherheitspolitisches Handeln als Reaktion auf die Struktur des internationalen Systems und Machtverhältnisse zu erklären.
Wie beeinflusste der 11. September 2001 die deutsche Sicherheitspolitik?
Die Anschläge führten zu einer veränderten Bedrohungswahrnehmung durch internationalen Terrorismus und stellten die Frage nach der Ausrichtung der NATO und deutscher Beteiligungen neu.
Besteht Kontinuität in der deutschen NATO-Politik seit der Wiedervereinigung?
Trotz struktureller Änderungen versuchen deutsche Regierungen, traditionelle Muster der multilateralen Kooperation beizubehalten, müssen diese aber an neue globale Krisen anpassen.
- Quote paper
- Michael Bee (Author), 2008, Die Nato als Instrument deutscher Sicherheitspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89057