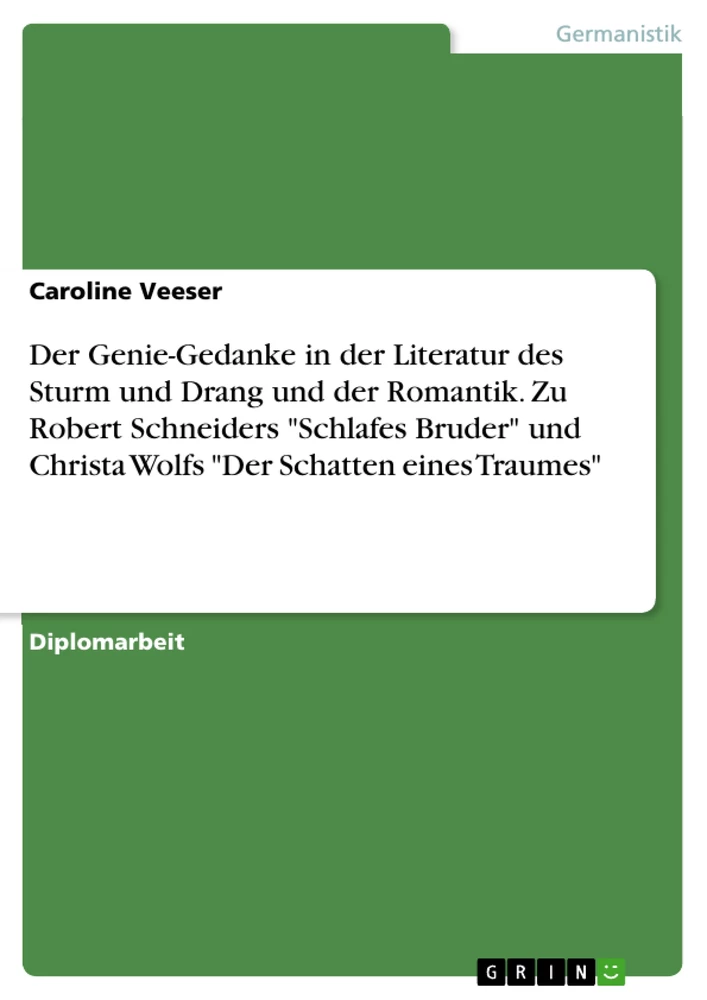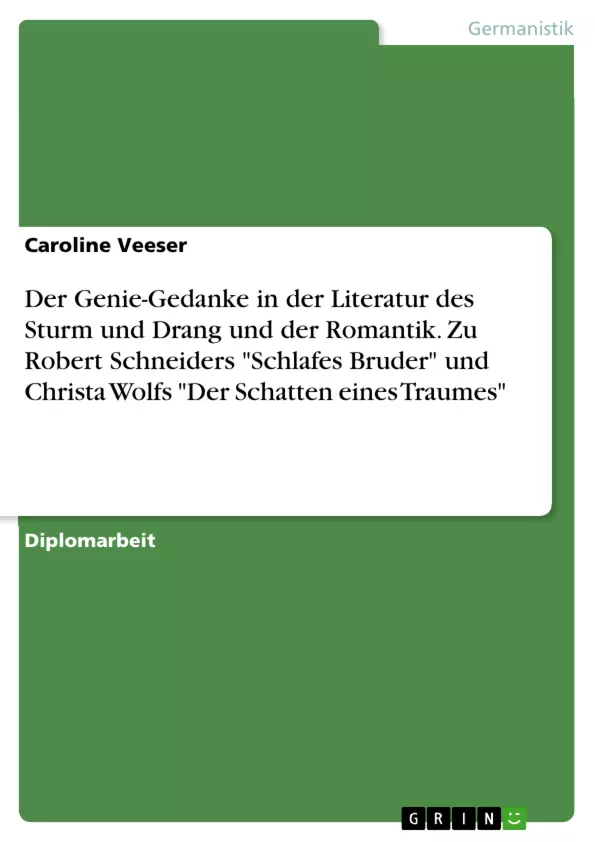„Seit wohl 10 000 Jahren weiß der Mensch um das „cogito, ergo sum“, das heißt, er ist sich seiner Stellung sowohl zur Umwelt bewußt wie zum Gestern und zum Morgen, er hat ein Bewußtsein von sich selbst und wird damit zur Persönlichkeit. Und wenn in einem Exemplar dieser Gattung Mensch höchste Persönlichkeitswerte im Sinne von Ethos und Scientia gekoppelt sind, so spricht die Menschheit seit etwa 2500 Jahren von einem Genie.“
Unabhängig von Zeitalter, Disziplinen, Einzelmenschen als auch ganzen Nationen und Völkern spielt der Genie-Begriff als Persönlichkeitsideal und Vorbild zur Nachahmung eine bedeutende Rolle. Weiter dient die Genie-Verehrung für den rational denkenden Kulturmenschen als Ersatz für die verloren gegangene Religion und damit als eine Art Rechtfertigung für das menschliche Dasein, seinen Zweck und das Ziel seiner Entwicklung.
Wilhelm Lange-Eichbaum und Wolfram Kurth bezeichnen den Genie-Begriff als einen „ausgesprochen europäischen Begriff“, da zu seiner Entwicklung eine ganz bestimmte kultur- und geistesgeschichtliche Grundhaltung erforderlich ist. Seinen Ursprung hat der Genie-Begriff in der Mythologie und Religion der Antike. Das Wort „Genie“ leitet sich her aus „ingenium“, dem natürlichen und angeborenen Talent, und aus „genius“, dem Schutzgeist. Als beste deutsche Übersetzung von „Genie“ gilt der Begriff „Geist“. Auch die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, setzen in ihrem „Deutschen Wörterbuch“ den Geist gleich spiritus, anima, mens und genius.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Genie-Gedanke im Sturm und Drang
- 2.1 Ausgangssituation - Der Genie-Gedanke vor dem Sturm und Drang
- 2.1.1 Johann Christoph Gottsched
- 2.1.2 Die Schweizer: Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger
- 2.1.3 Gotthold Ephraim Lessing
- 2.2 Der Sturm und Drang in Deutschland
- 2.2.1 Charakter der neuen literarischen Bewegung
- 2.2.2 Die Wegbereiter des Sturm und Drang und ihr Einfluss auf den Genie-Gedanken dieser Zeit
- 2.3 Der junge Goethe
- 2.3.1 Kunstreligion und religiöse Verehrung des Genies
- 2.3.2 Der moderne Kunstbetrachter
- 2.3.3 Goethes Hymnen - dichterischer Höhepunkt der Geniezeit
- 2.3.4 Das Vorbild William Shakespeare
- 2.3.5 Das Genie in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“
- 2.4 Zusammenfassung: Der Genie-Gedanke im Sturm und Drang - Das Originalgenie
- 3 Robert Schneider „Schlafes Bruder“
- 3.1 Johannes Elias Alder als Genie
- 3.2 Johannes Elias Alder - Originalgenie des Sturm und Drang?
- 3.2.1 Dichter vs. Musiker
- 3.2.2 Gefühl vs. Vernunft
- 3.2.3 Natur
- 3.2.4 Regellosigkeit
- 3.2.5 Das Gottesbild
- 3.2.6 Autonomie und Subjektivität
- 3.2.7 Hamanns Genie-Gedanke
- 3.2.8 Vergleich mit Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“
- 3.3 Robert Schneiders Held - Konstruktion eines Sturm- und Drang-Genies?
- 4 Der Genie-Gedanke in der Romantik
- 4.1 Die Epoche
- 4.2 Wegbereiter der Romantik und ihr Einfluss auf den Genie-Gedanken
- 4.2.1 Immanuel Kant
- 4.2.2 Johann Gottlieb Fichte
- 4.2.3 Friedrich Wilhelm Schelling
- 4.3 August Wilhelm und Friedrich Schlegel
- 4.4 E.T.A. Hoffmann
- 4.5 Zusammenfassung: Der Genie-Gedanke in der Romantik
- 5 Christa Wolf „Der Schatten eines Traumes“
- 5.1 Das „weibliche Genie“ - Frauen in der Romantik
- 5.2 Karoline von Günderrode - das romantische Genie?
- 6 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Genie-Gedanken in der deutschen Literatur des Sturm und Drang und der Romantik. Sie analysiert, wie dieser Begriff sich entwickelt hat und wie er in den Werken Robert Schneiders „Schlafes Bruder“ und Christa Wolfs „Der Schatten eines Traumes“ verwirklicht wird. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss wichtiger Philosophen und Schriftsteller auf die Vorstellung des Genies.
- Entwicklung des Genie-Begriffs vom Sturm und Drang bis zur Romantik
- Der Einfluss von Philosophie und Literatur auf den Genie-Gedanken
- Vergleichende Analyse der Darstellung des Genies in ausgewählten literarischen Werken
- Untersuchung der Geschlechterrollen im Kontext des Genie-Begriffs
- Die Rolle des Genies als Persönlichkeitsideal und Vorbild
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Genie-Gedankens ein und beschreibt seine historische Entwicklung und Bedeutung als Persönlichkeitsideal und kulturelle Referenz. Sie betont die zwei Hauptrichtungen der Genie-Theorien: das Genie als Mysterium und das Genie als Gegenstand rationaler Betrachtung. Die Einleitung unterstreicht die weitreichende Bedeutung des Genie-Gedankens über das 18. Jahrhundert hinaus und seine Verknüpfung mit Philosophie und Politik. Es wird die Relevanz des Sturm und Drang und der Romantik für die Entwicklung des Genie-Begriffs herausgestellt.
2 Der Genie-Gedanke im Sturm und Drang: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und Entwicklung des Genie-Gedankens im Sturm und Drang. Es analysiert die Vorläufer des Sturm und Drang, die die Basis für den neuen Geniebegriff gelegt haben und zeichnet den Charakter der neuen literarischen Bewegung nach. Es beleuchtet den Einfluss von Schriftstellern wie Goethe und die Bedeutung von Werken wie „Die Leiden des jungen Werthers“ im Kontext des Genie-Gedankens.
3 Robert Schneider „Schlafes Bruder“: Dieses Kapitel analysiert die Figur Johannes Elias Alder in Robert Schneiders Roman „Schlafes Bruder“ unter dem Aspekt des Genie-Gedankens. Es untersucht, ob Alder als ein Originalgenie des Sturm und Drang betrachtet werden kann und vergleicht ihn mit dem Geniebegriff im Sturm und Drang, insbesondere mit Goethe's Werk "Die Leiden des jungen Werthers". Es werden Aspekte wie Alder's Rolle als Dichter vs. Musiker, sein Verhältnis von Gefühl und Vernunft, seine Beziehung zur Natur und seine Autonomie untersucht.
4 Der Genie-Gedanke in der Romantik: Dieses Kapitel erörtert die Weiterentwicklung des Genie-Gedankens in der Romantik. Es beleuchtet den Einfluss von Philosophen wie Kant, Fichte und Schelling und zeigt, wie die romantischen Schriftsteller den Geniebegriff aufgenommen und weiterentwickelt haben. Die Kapitel behandelt die Rolle von Schriftstellern wie den Brüdern Schlegel und E.T.A. Hoffmann.
5 Christa Wolf „Der Schatten eines Traumes“: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung des „weiblichen Genies“ in der Romantik, analysiert die Figur Karoline von Günderrode im Kontext des romantischen Genie-Begriffs und untersucht, inwiefern sie als ein romantisches Genie betrachtet werden kann, im Kontext von Christa Wolf's Werk "Der Schatten eines Traumes".
Schlüsselwörter
Genie-Gedanke, Sturm und Drang, Romantik, Goethe, Robert Schneider, Christa Wolf, „Schlafes Bruder“, „Der Schatten eines Traumes“, Originalgenie, Kunstreligion, Autonomie, Gefühl, Vernunft, Natur, Philosophie, Literatur, Geschlechterrollen, Persönlichkeitsideal.
Häufig gestellte Fragen zu: Genie-Gedanke im Sturm und Drang und in der Romantik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Genie-Gedanken in der deutschen Literatur des Sturm und Drang und der Romantik. Sie analysiert die Entwicklung dieses Begriffs und seine Umsetzung in den Werken Robert Schneiders „Schlafes Bruder“ und Christa Wolfs „Der Schatten eines Traumes“. Dabei wird der Einfluss wichtiger Philosophen und Schriftsteller beleuchtet.
Welche Epochen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Sturm und Drang und die Romantik, zwei bedeutende Epochen der deutschen Literatur, in denen der Genie-Gedanke eine zentrale Rolle spielte.
Welche Autoren und Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Werke von Goethe (insbesondere „Die Leiden des jungen Werthers“), Robert Schneider („Schlafes Bruder“) und Christa Wolf („Der Schatten eines Traumes“). Zusätzlich werden die Beiträge von bedeutenden Philosophen und Schriftstellern dieser Epochen berücksichtigt, wie z.B. Kant, Fichte, Schelling, die Brüder Schlegel und E.T.A. Hoffmann.
Wie entwickelt sich der Genie-Begriff im Laufe der Arbeit?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung des Genie-Begriffs vom Sturm und Drang bis zur Romantik. Sie zeigt, wie sich die Vorstellung vom Genie veränderte und welche Einflüsse – philosophische wie literarische – diese Entwicklung prägten.
Welche Aspekte des Genie-Gedankens werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte des Genie-Gedankens, darunter die Entwicklung des Begriffs selbst, den Einfluss von Philosophie und Literatur, die Darstellung des Genies in ausgewählten literarischen Werken, die Geschlechterrollen im Kontext des Genie-Begriffs und die Rolle des Genies als Persönlichkeitsideal und Vorbild. Spezifische Aspekte wie das Verhältnis von Gefühl und Vernunft, die Bedeutung der Natur und die Frage nach der Autonomie des Genies werden ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielen die Philosophen?
Die Arbeit untersucht den Einfluss wichtiger Philosophen wie Kant, Fichte und Schelling auf die Entwicklung des Genie-Gedankens in der Romantik. Ihre philosophischen Konzepte werden in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die literarische Vorstellung des Genies analysiert.
Wie wird das „weibliche Genie“ behandelt?
Die Arbeit widmet sich der Darstellung des „weiblichen Genies“ in der Romantik und analysiert die Figur Karoline von Günderrode im Kontext des romantischen Genie-Begriffs in Christa Wolf's Werk "Der Schatten eines Traumes".
Welche Schlüsselfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Fragen wie: Was charakterisiert ein Genie? Wie unterscheidet sich der Genie-Begriff im Sturm und Drang von dem in der Romantik? Welche Rolle spielt das Genie als gesellschaftliches Ideal? Wie wird das Genie in den analysierten literarischen Werken dargestellt? Welche Bedeutung hat das Geschlecht im Kontext des Genie-Begriffs?
Gibt es einen Vergleich zwischen den analysierten Werken?
Ja, die Arbeit beinhaltet einen Vergleich der Darstellung des Genies in den Werken Robert Schneiders („Schlafes Bruder“) und Christa Wolfs („Der Schatten eines Traumes“), sowie einen Vergleich zwischen Goethes "Leiden des jungen Werthers" und Schneiders Roman.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Genie-Gedanke, Sturm und Drang, Romantik, Goethe, Robert Schneider, Christa Wolf, „Schlafes Bruder“, „Der Schatten eines Traumes“, Originalgenie, Kunstreligion, Autonomie, Gefühl, Vernunft, Natur, Philosophie, Literatur, Geschlechterrollen, Persönlichkeitsideal.
- Quote paper
- Caroline Veeser (Author), 2006, Der Genie-Gedanke in der Literatur des Sturm und Drang und der Romantik. Zu Robert Schneiders "Schlafes Bruder" und Christa Wolfs "Der Schatten eines Traumes", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89070