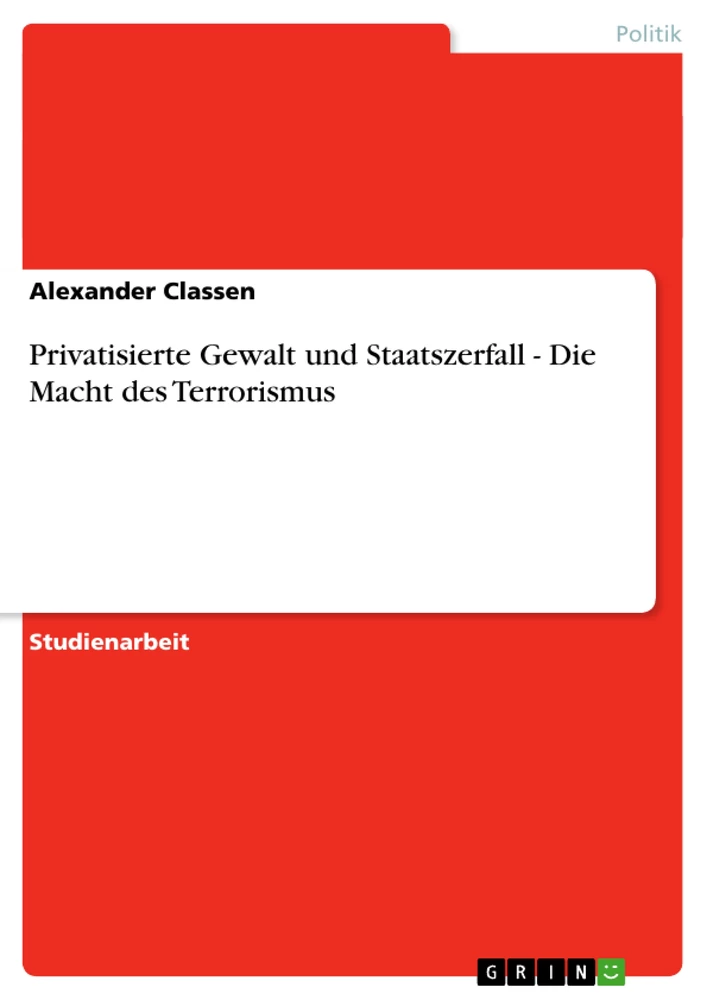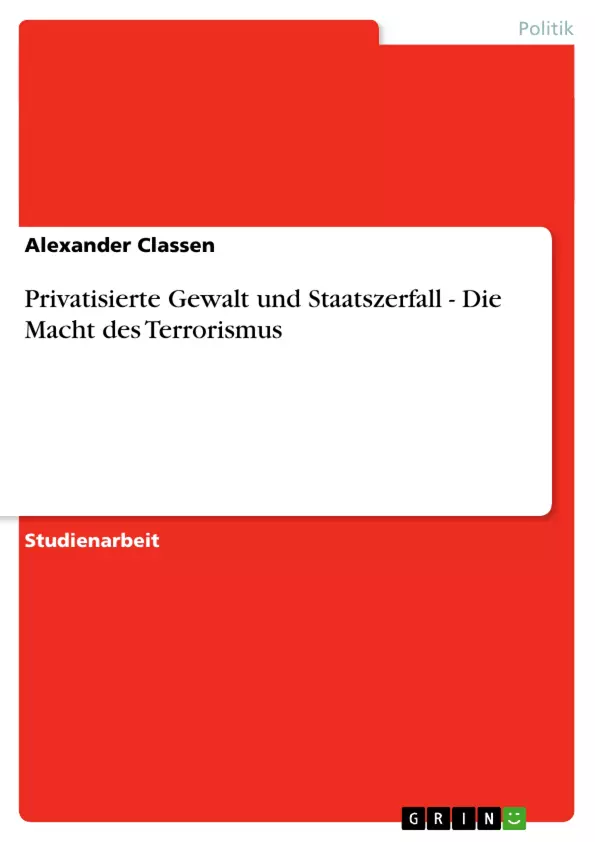Das Problem besteht darin, dass die Strategien und Kampfmittel des Militärs zu großen Teilen noch für „klassische“ Staatenkriege konzipiert sind. Sie stellen kein taugliches Mittel zur Bekämpfung entstaatlichter Gewalt und der Verhinderung terroristischer Anschläge dar. Die neuen Konflikte unterscheiden sich in Struktur und Zielsetzung von den einstmals üblichen Staatenkriegen. So wird darauf hingewiesen, dass die durch die Andersartigkeit der neuen Kriege bedingte Einschränkung der Abwehrfähigkeit für Staaten die Gefahr der Erosion des Gewaltmonopoles in sich berge. Bei erfolgter Erosion hat dann die entstaatlichte, privatisierte Gewalt das letzte Wort.
Geborgenheit, Zuversicht und Wohlbefinden. Begriffe, die sich lediglich denjenigen Individuen zuordnen lässt, die sich in einer Umgebung aufhalten, welche ihnen Freiheit und Sicherheit nicht nur faktisch zukommen lässt, sondern ihnen auch das Gefühl vermittelt, dass sich an diesem Zustand so schnell nichts ändern wird. Welche psychologischen Narben hinterlassen die Spuren von Terroranschlägen, die sich selbst bei den „Nichtopfern“ zunehmend tiefer ins Bewusstsein zu graben scheinen? Vielleicht liegt es an der schweren Fassbarkeit des Phänomens Terrorismus, dass seiner Eigenart nach zwar nicht neu, aber nach wie vor schwer greifbar scheint. Vor-liegend soll im Kontext einer Analyse staatlicher Gewalt skizziert werden, was Terrorismus ist, wo seine Funktionsweisen liegen. Vielleicht ermöglicht die Analyse eine Perspektive, die Denkansätze - nicht zur Bekämpfung, sondern zur Vermeidung - aufzeigt und dabei einen unverklärten Blick darauf ermöglicht, inwieweit die weltumspannende Gesellschaftsstruktur der Staatlichkeit überhaupt noch geeignet ist, diesem Tod der Geborgenheit zu begegnen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Der Machtverlust des Staates
- Die ursprüngliche Struktur
- Das Schicksal des Gewaltmonopols
- Der Einfluss von Wirtschafts- und Sicherheitsbündnissen
- Die Entfremdung
- Der Gewaltverlust
- Wenn Kriege Kinder kriegen
- Die Gestalt des Krieges
- Die neuen Kriege
- Das terroristische Kalkül
- Wenn Kriege Kinder kriegen
- Terroristischer Wirkungsgrad und Staatserosion, Möglichkeiten zum Erhalt des staatlichen Gewaltmonopols
- Die Möglichkeit der Erosion
- Die Möglichkeiten des Erhalts staatlicher Gewalt
- Die Politik des Äußeren
- Die Politik des Inneren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Phänomen des Terrorismus und untersucht dessen Auswirkungen auf die staatliche Gewalt. Er analysiert den Machtverlust des Staates im Angesicht des Terrorismus und beleuchtet die Erosion des staatlichen Gewaltmonopols.
- Der Verlust des staatlichen Gewaltmonopols
- Die veränderte Gestalt des Krieges
- Die Funktionsweise des terroristischen Kalküls
- Die Auswirkungen des Terrorismus auf die Gesellschaft
- Möglichkeiten zum Erhalt des staatlichen Gewaltmonopols
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die ursprüngliche Struktur des Staates und die Entwicklung des Gewaltmonopols. Es untersucht, wie der Einfluss von Wirtschafts- und Sicherheitsbündnissen sowie die Entfremdung die Macht des Staates beeinflussen.
Das zweite Kapitel analysiert den Gewaltverlust des Staates im Kontext des Terrorismus. Es untersucht die veränderte Gestalt des Krieges, insbesondere im Hinblick auf die neuen Kriege, und analysiert das terroristische Kalkül.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Staatserosion durch den Terrorismus und den Möglichkeiten zum Erhalt des staatlichen Gewaltmonopols. Es betrachtet die Auswirkungen des Terrorismus auf die Gesellschaft und analysiert die Politik des Äußeren und des Inneren im Kampf gegen den Terrorismus.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Staat, Gewaltmonopol, Staatserosion, neue Kriege, Terroristisches Kalkül, Politische Macht, Sicherheitsbündnisse, Entfremdung, Politik des Äußeren, Politik des Inneren.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „privatisierter Gewalt“?
Privatisierte Gewalt bezeichnet Gewaltakte, die nicht von staatlichen Armeen, sondern von nicht-staatlichen Akteuren wie Terrororganisationen oder Warlords ausgeübt werden, wodurch der Staat sein Gewaltmonopol verliert.
Warum scheitern klassische Militärstrategien im Kampf gegen den Terrorismus?
Klassische Strategien sind für Kriege zwischen Staaten konzipiert. Terrorismus hingegen ist entstaatlicht, dezentral und nutzt asymmetrische Kampfmittel, gegen die herkömmliche Armeen oft machtlos sind.
Was ist das „terroristische Kalkül“?
Das Kalkül zielt darauf ab, durch Angst und Schrecken psychologische Narben in der Gesellschaft zu hinterlassen, das Sicherheitsgefühl zu zerstören und den Staat zu Überreaktionen oder zur Erosion seiner Macht zu zwingen.
Wie beeinflussen Wirtschafts- und Sicherheitsbündnisse die staatliche Macht?
Solche Bündnisse können die Macht des Staates stützen, führen aber oft auch zu einer Abgabe von Souveränität, was die Handlungsfähigkeit des Einzelstaates im Krisenfall einschränken kann.
Kann der Staat sein Gewaltmonopol im Angesicht neuer Kriege erhalten?
Die Arbeit diskutiert Möglichkeiten durch eine angepasste Politik des Inneren und Äußeren. Es wird jedoch kritisch hinterfragt, ob die herkömmliche Staatsstruktur den neuen Herausforderungen noch gewachsen ist.
Welche Rolle spielt die „Entfremdung“ beim Machtverlust des Staates?
Wenn Bürger sich vom Staat entfremdet fühlen oder dieser ihnen keinen Schutz mehr bietet, sinkt die Legitimität des staatlichen Gewaltmonopols, was den Raum für privatisierte Gewalt vergrößert.
- Quote paper
- Alexander Classen (Author), 2006, Privatisierte Gewalt und Staatszerfall - Die Macht des Terrorismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89079