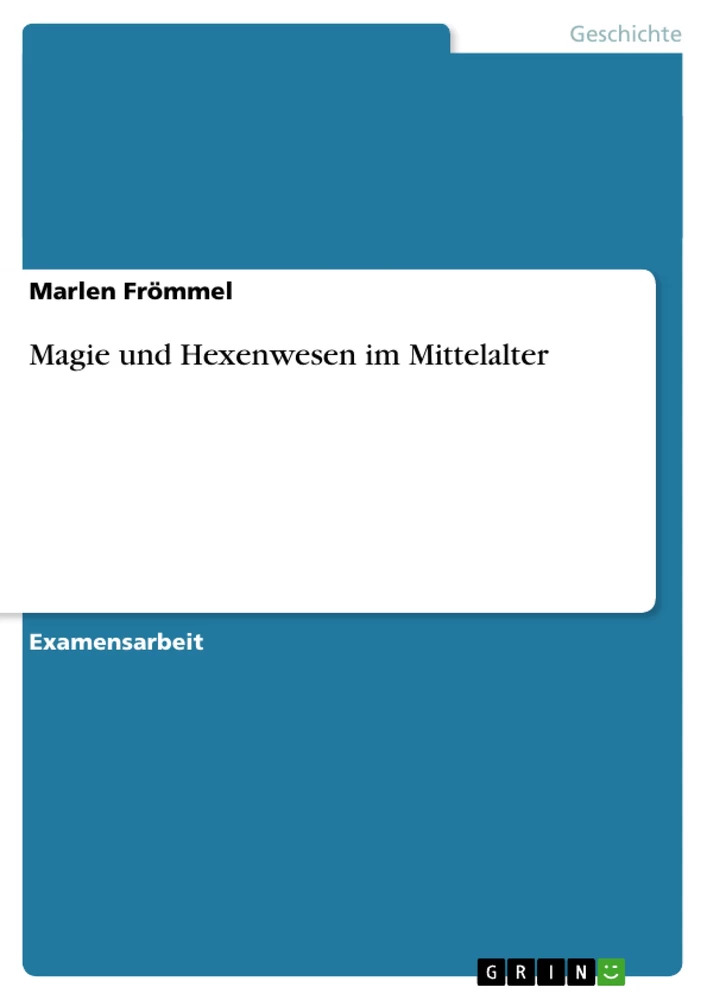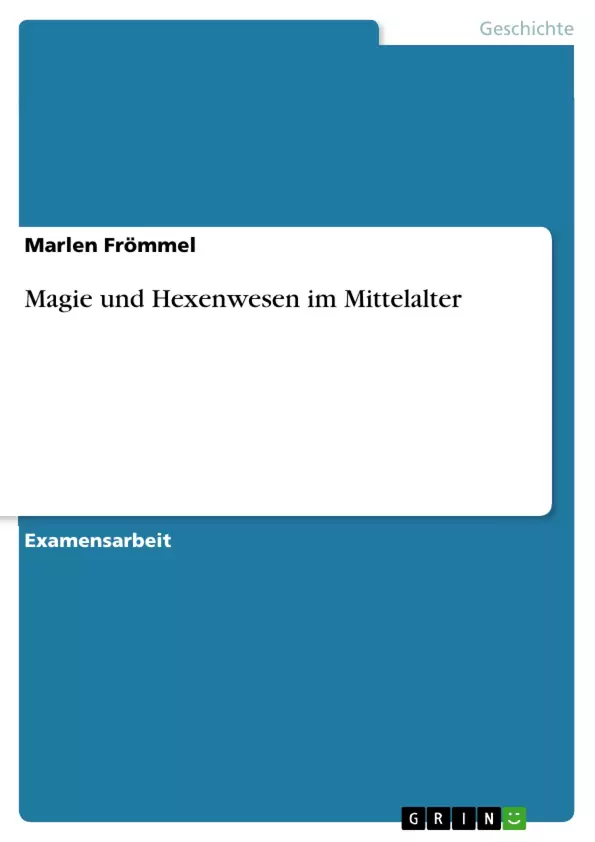Den Ausgangspunkt bildet die Magievorstellung des Mittelalters, welche sich aus antiken Traditionen herausgebildet hatte. Obwohl sie mit der zunehmenden Macht der christlichen Kirche als Konkurrenz angesehen und auch so behandelt wurde, durchzog die Dichotomie Religion – Magie das gesamte Mittelalter. [...] In diesem Zusammenhang soll der Entwicklungslinie Magie-Heidentum-Häresie-Hexenwesen nachgegangen werden.
Magie und Hexenwesen durchzogen alle Bereiche der Gesellschaft: Angefangen bei der Alltagswirklichkeit der mittelalterlichen Gesellschaft über die Theologie der Kirche, die Politik des Staates sowie die Rechtsordnungen beider Bereiche bis hin zu Literatur und verschiedenen kulturellen Beziehungen.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch das Forschungsinteresse in unterschiedlichsten Disziplinen geweckt wurde.
Um dieser [Interpretationsvielfalt] möglichst gerecht zu werden, sollen in einem ersten theoretischen Teil ein kurzer Überblick über Entwicklung der Magie- und Hexenforschung (Kap. I/1) und existierende Forschungskontroversen (Kap. I/2) gegeben sowie das methodische Vorgehen für die Bearbeitung (Kap. I/3) vorgestellt werden. Aufgrund der im Vergleich eher begrenzten Magie-Literatur liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit beim Hexenwesen. Von dieser Prämisse ausgehend müssen zunächst die Begriffe „Magie/Magier“ und „Hexe“ näher bestimmt werden (Kap. I/4).
Im zweiten Kapitel soll die Magie des Mittelalters als Voraussetzung für die Entstehung des Hexenwesens dargestellt werden. Hierfür werden die Ursprünge der Magie, besonders in der klassischen Kultur der griechisch-römischen Welt (Kap. II/1), aus der sich die mittelalterlichen Magievorstellungen ergaben (Kap. II/2), sowie die theoretische Einstellung der Kirche (Kap. II/3) näher betrachtet.
Das mittelalterliche Hexenwesen und die beginnenden Hexenverfolgungen sind Gegenstand des dritten Teils dieser Arbeit. Ausgehend von der Überformung der magischen Volkskultur durch die kirchliche Hexenlehre (Kap. III/1) wird das Verhältnis von Kirche und Staat zur Magie nachgezeichnet (Kap. III/2) – beides Vorbedingungen, aus denen sich der Hexenstereotyp (Kap. III/3) entwickelte, welches besonders in den „Hexenhammer“ (Kap. III/4) Eingang fand. Die Lage der Frau in Hinblick auf die Gesellschaft sowie die Veränderungen im mittelalterlichen Weltbild (Kap. III/5) werden thematisiert, um die Genese der Hexenverfolgungen (Kap. III/6) zu veranschaulichen.
Inhaltsverzeichnis
- Arbeitsvorhaben und Aufbau der Arbeit
- Teil I: Eine Annäherung von theoretischer Seite
- Die Entwicklung des Forschungsdiskurses
- Die Forschungskontroversen
- Der Methodischer Ansatz
- Einige Begriffsbestimmungen
- Teil II: Die Magie im Mittelalter als Voraussetzung für die Entstehung des Hexenwesens
- Die Magie - ein Erbe der klassischen Kultur der Antike
- Die Graeco-romanische Welt
- Das frühe Christentum und die Bibel
- Das heidnische Europa
- Die Zauberei und die Kirche
- Die Meinung der Theologen
- Die Zauberei der Priester und Päpste
- Die Magie in der Volkstradition des Mittelalters
- Die magische Praxis
- Das Ritual und die Zauberbücher
- Der magische Spruch
- Der Bildzauber und der Liebeszauber
- Die Wahrsagerei
- Die Verwendung von Bibel, Psalmen, Sakramenten zu magischen Zwecken
- Die Magie und die Wissenschaft
- Die medicina magica
- Die magische Praxis
- Die Magie - ein Erbe der klassischen Kultur der Antike
- Teil III: Das mittelalterliche Hexenwesen und der Beginn der Hexenverfolgungen
- Die Überformung der magischen Volkskultur durch die Hexenlehre
- Der Dämonenpakt
- Die Ketzer
- Das Verhältnis von Kirche und Staat zur Magie
- Die rechtliche Situation
- Die Inquisition
- Der Hexenstereotyp
- Der „Malleus Maleficarum“ – Der Hexenhammer
- Das Entstehungsumfeld und die Rezeption
- Der Inhalt des Hexenhammers
- Die Frauenfeindlichkeit im Titel
- Die Beschuldigung der Hebammen als Hexen
- Die Voraussetzungen für die Anfänge der Hexenverfolgungen
- Die Anfänge der Hexenverfolgung
- Die Überformung der magischen Volkskultur durch die Hexenlehre
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Hexenwesens im Mittelalter und seine Verbindung zur mittelalterlichen Magie. Sie beleuchtet den Wandel der magischen Praktiken und Vorstellungen im Laufe der Jahrhunderte und analysiert die Rolle der Kirche und des Staates in der Entstehung und Bekämpfung der Hexenverfolgung. Die Arbeit strebt danach, die komplexen Zusammenhänge zwischen Magie, Religion und gesellschaftlichen Strukturen aufzuzeigen.
- Die Entwicklung des magischen Weltbildes im Mittelalter
- Die Beziehung zwischen Magie und christlicher Religion
- Die Entstehung des Hexenstereotyps und die Rolle der Inquisition
- Die rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen der Hexenverfolgung
- Die unterschiedlichen Interpretationsansätze zum Thema Hexenverfolgung
Zusammenfassung der Kapitel
Arbeitsvorhaben und Aufbau der Arbeit: Diese Einleitung skizziert den Forschungsstand zum Thema Magie und Hexenwesen im Mittelalter und benennt die Forschungslücken, die diese Arbeit zu schließen versucht. Sie umreißt den methodischen Ansatz und die Struktur der Arbeit, die sich in drei Teile gliedert: eine theoretische Annäherung, die mittelalterliche Magie als Grundlage des Hexenwesens und schließlich das mittelalterliche Hexenwesen selbst und der Beginn der Verfolgung.
Teil I: Eine Annäherung von theoretischer Seite: Dieser Teil bietet eine Übersicht über den Forschungsdiskurs zum Thema Magie und Hexenwesen im Mittelalter. Er beleuchtet unterschiedliche Forschungsansätze und Kontroversen und definiert wichtige Begriffe, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden. Dieser Abschnitt legt das methodische Fundament für die Analyse der folgenden Teile der Arbeit.
Teil II: Die Magie im Mittelalter als Voraussetzung für die Entstehung des Hexenwesens: Dieser Teil untersucht die Wurzeln der mittelalterlichen Magie in der antiken Tradition und die Interaktion zwischen Magie und christlicher Kirche. Er beleuchtet verschiedene Formen der magischen Praxis in der mittelalterlichen Volkskultur, inklusive der Verwendung von religiösen Elementen in magischen Ritualen und der Beziehung zwischen Magie und Medizin. Der Fokus liegt auf der Darstellung der allgegenwärtigen, wenn auch verdrängten, Bedeutung der Magie im Mittelalter, die als Vorstufe zur späteren Dämonisierung der Hexerei verstanden werden kann.
Teil III: Das mittelalterliche Hexenwesen und der Beginn der Hexenverfolgungen: Dieser Teil konzentriert sich auf die Entwicklung des Hexenstereotyps und die Anfänge der Hexenverfolgung. Er analysiert die Transformation der Volksmagie in die Hexenlehre, die Rolle des Dämonenpaktes, das Verhältnis von Kirche und Staat zur Hexenverfolgung und die Bedeutung des „Malleus Maleficarum“. Der Teil beleuchtet die rechtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für die zunehmenden Hexenverfolgungen, ohne jedoch bereits auf die eigentlichen Verfolgungen im Detail einzugehen.
Schlüsselwörter
Magie, Hexenwesen, Mittelalter, Hexenverfolgung, Kirche, Staat, Volksglaube, Dämonenpakt, Inquisition, Malleus Maleficarum, Forschungsdiskurs, Methodologie, Heidentum, Häresie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Mittelalterliche Magie und Hexenverfolgung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Hexenwesens im Mittelalter und dessen Verbindung zur mittelalterlichen Magie. Sie analysiert den Wandel magischer Praktiken und Vorstellungen, die Rolle von Kirche und Staat bei der Entstehung und Bekämpfung der Hexenverfolgung und die komplexen Zusammenhänge zwischen Magie, Religion und gesellschaftlichen Strukturen. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: eine theoretische Einführung, die mittelalterliche Magie als Grundlage des Hexenwesens und schließlich das mittelalterliche Hexenwesen und der Beginn der Verfolgung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Entwicklung des magischen Weltbildes im Mittelalter, die Beziehung zwischen Magie und christlicher Religion, die Entstehung des Hexenstereotyps und die Rolle der Inquisition, die rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen der Hexenverfolgung sowie unterschiedliche Interpretationsansätze zum Thema Hexenverfolgung. Konkret werden Aspekte wie die Graeco-romanische Magie, die Zauberei in der frühen Kirche, die Volksmagie des Mittelalters (inkl. Ritualen, Zauberbüchern und der medicina magica), der Dämonenpakt, der "Malleus Maleficarum" und die rechtliche Situation der Magie im Mittelalter untersucht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: Teil I bietet eine theoretische Einführung mit Forschungsdiskurs, Kontroversen, methodischem Ansatz und Begriffsbestimmungen. Teil II untersucht die mittelalterliche Magie als Grundlage des Hexenwesens, beginnend mit der antiken Tradition, der Interaktion mit der Kirche und verschiedenen magischen Praktiken in der mittelalterlichen Volkskultur. Teil III konzentriert sich auf das mittelalterliche Hexenwesen und den Beginn der Hexenverfolgung, analysiert die Transformation der Volksmagie, die Rolle von Kirche und Staat, den Hexenstereotyp und den "Malleus Maleficarum". Ein Resümee rundet die Arbeit ab.
Welche Quellen werden verwendet?
Die HTML-Vorschau nennt keine konkreten Quellen. Die verwendeten Quellen müssten im vollständigen Text nachgeschlagen werden. Der Text verweist jedoch auf den Forschungsdiskurs und unterschiedliche Interpretationsansätze zum Thema.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Magie, Hexenwesen, Mittelalter, Hexenverfolgung, Kirche, Staat, Volksglaube, Dämonenpakt, Inquisition, Malleus Maleficarum, Forschungsdiskurs, Methodologie, Heidentum, Häresie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung des Hexenwesens im Mittelalter und seine Verbindung zur mittelalterlichen Magie zu untersuchen und die komplexen Zusammenhänge zwischen Magie, Religion und gesellschaftlichen Strukturen aufzuzeigen. Sie beleuchtet den Wandel der magischen Praktiken und Vorstellungen im Laufe der Jahrhunderte und analysiert die Rolle der Kirche und des Staates in der Entstehung und Bekämpfung der Hexenverfolgung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die HTML-Vorschau enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Arbeitsvorhaben und Aufbau der Arbeit, Teil I-III und Resümee), welche die jeweiligen Inhalte und Forschungsansätze knapp beschreiben.
- Quote paper
- Marlen Frömmel (Author), 2007, Magie und Hexenwesen im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89093