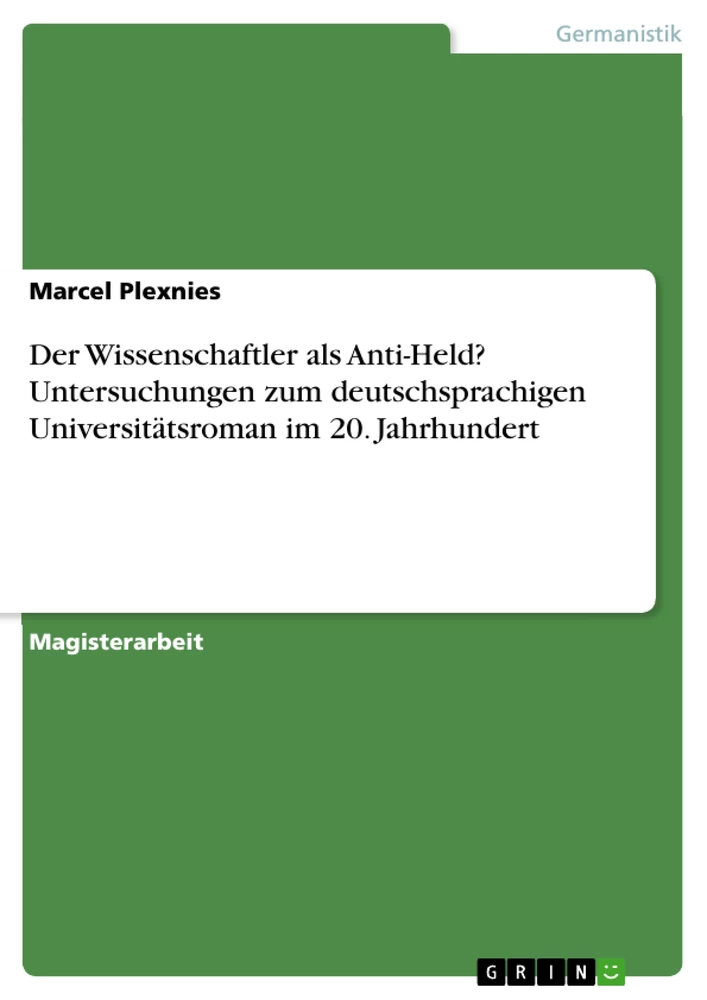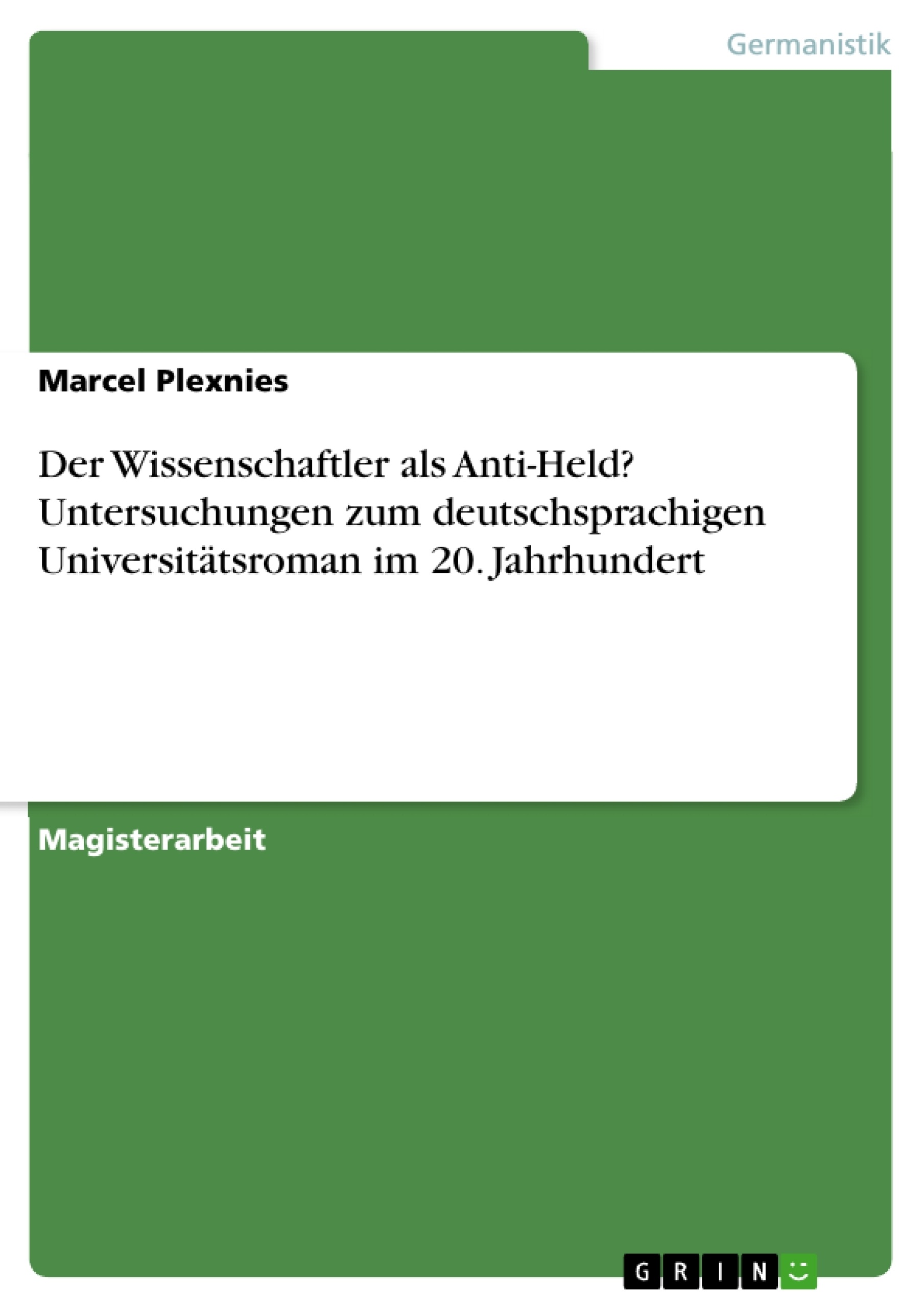Das Feld deutschsprachiger Universitätsromane ist, verglichen mit seinen angloamerikanischen Pendants, bis dato nur spärlich bestellt. Eine wirkliche Tradition wie in Großbritannien oder den USA gibt es nicht. Und auch die Sekundärliteratur, die sich mit den wenigen, unregelmäßig erschienenen Vertretern dieser kaum als solche zu bezeichnenden Subgattung beschäftigt, betont immer wieder die Seltenheit des behandelten Textes im deutschsprachigen Literaturkreis – oder noch deutlicher, die weitläufige Abstinenz derartiger Texte.
Es bietet sich deshalb an, in dieser Arbeit genau dort anzusetzen, wo die Literaturkritik noch eine nicht zu verachtende Lücke aufweist: eine vergleichende Arbeit, die die deutschsprachigen Universitätsromane durch ein wiederkehrendes Motiv miteinander in Verbindung bringen könnte. Dazu sollen einige ausgewählte Werke untersucht werden. Im Mittelpunkt steht jeweils die Hauptfigur. Anhand der einzelnen Charaktere soll analysiert werden, ob ein solches verbindendes, wiederkehrendes Motiv unter einigen der deutschsprachigen Universitätsromane existiert, das sich bei der eingehenden Lektüre der Werke ergeben hat – nämlich: Der Wissenschaftler als Anti-Held.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Zielsetzung
- Begriffserklärungen: Wissenschaftler, Held, Anti-Held
- Wissenschaftler als Anti-Helden? - Protagonisten ausgewählter Universitätsromane
- Der Desillusionierte: Helmut Halm in Walsers Brandung
- Der Gestürzte: Hanno Hackmann in Schwanitz' Der Campus
- Der Mitläufer: Hellmut Buchwald in Zellers Follens Erbe
- Der Nihilist: Fabian Kelch in Schmickls Alles, was der Fall ist
- Anti-Heldinnen nur im Ansatz: Weibliche Hauptfiguren
- Exkurs: Romanfiguren bei David Lodge
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Frage, ob der Wissenschaftler im deutschsprachigen Universitätsroman des 20. Jahrhunderts als Anti-Held dargestellt wird. Die Arbeit analysiert verschiedene Romane, die sich mit dem Universitätsalltag auseinandersetzen, und untersucht die Charakteristika ihrer Protagonisten, um ein mögliches wiederkehrendes Motiv, nämlich den Wissenschaftler als Anti-Held, zu identifizieren.
- Analyse der Protagonisten in ausgewählten Universitätsromanen
- Vergleich der Figuren mit den Stereotypen des Wissenschaftlers und des Anti-Helden
- Einordnung der Romane in die Tradition des deutschsprachigen Universitätsromans
- Bezüge zu angloamerikanischen Universitätsromanen
- Untersuchung der Rolle der Universität als Schauplatz und Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungslücke im Bereich des deutschsprachigen Universitätsromans dar und führt den Begriff des Wissenschaftlers als Anti-Helden ein. Das zweite Kapitel erläutert die zentralen Begriffe der Arbeit, nämlich Wissenschaftler, Held und Anti-Held. Die folgenden Kapitel analysieren die Protagonisten in vier ausgewählten Universitätsromanen: Walsers Brandung, Schwanitz' Der Campus, Zellers Follens Erbe und Schmickls Alles, was der Fall ist. Anhand der Charakterstudien wird untersucht, ob sich ein wiederkehrendes Motiv des Wissenschaftlers als Anti-Held zeigt. Ein Exkurs über zwei Universitätsromane von David Lodge gibt einen Einblick in die Figurenkonzeption des englischen Autors. In der Abschlussbetrachtung werden die Ergebnisse der Analysen zusammengefasst und die These des Wissenschaftlers als Anti-Held auf ihre Haltbarkeit geprüft.
Schlüsselwörter
Universitätsroman, deutschsprachige Literatur, Wissenschaftler, Anti-Held, Held, Protagonist, Charakteranalyse, David Lodge, Genreforschung, Universität, Romanfiguren, Motivforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These der Arbeit zum deutschsprachigen Universitätsroman?
Die Arbeit untersucht, ob der Wissenschaftler in deutschsprachigen Universitätsromanen des 20. Jahrhunderts als ein wiederkehrender Typus des "Anti-Helden" dargestellt wird.
Welche Autoren und Werke werden in der Analyse betrachtet?
Untersucht werden unter anderem Martin Walser ("Brandung"), Dietrich Schwanitz ("Der Campus"), Bernhard Zeller ("Follens Erbe") und Schmickl ("Alles, was der Fall ist").
Wie unterscheidet sich der deutsche Universitätsroman von angloamerikanischen Vorbildern?
Im Gegensatz zu Großbritannien oder den USA gibt es im deutschsprachigen Raum keine ausgeprägte Tradition dieses Subgenres; entsprechende Texte sind vergleichsweise selten.
Was kennzeichnet den Wissenschaftler als "Anti-Helden"?
Die Protagonisten werden oft als desillusioniert, gestürzt, als Mitläufer oder Nihilisten dargestellt, was im Gegensatz zum klassischen Heldenbild steht.
Welche Rolle spielt David Lodge in dieser Arbeit?
In einem Exkurs werden die Romanfiguren des englischen Autors David Lodge betrachtet, um einen Vergleich zur internationalen Tradition des Universitätsromans zu ziehen.
- Quote paper
- Magister Artium (M.A.) Marcel Plexnies (Author), 2006, Der Wissenschaftler als Anti-Held? Untersuchungen zum deutschsprachigen Universitätsroman im 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89098