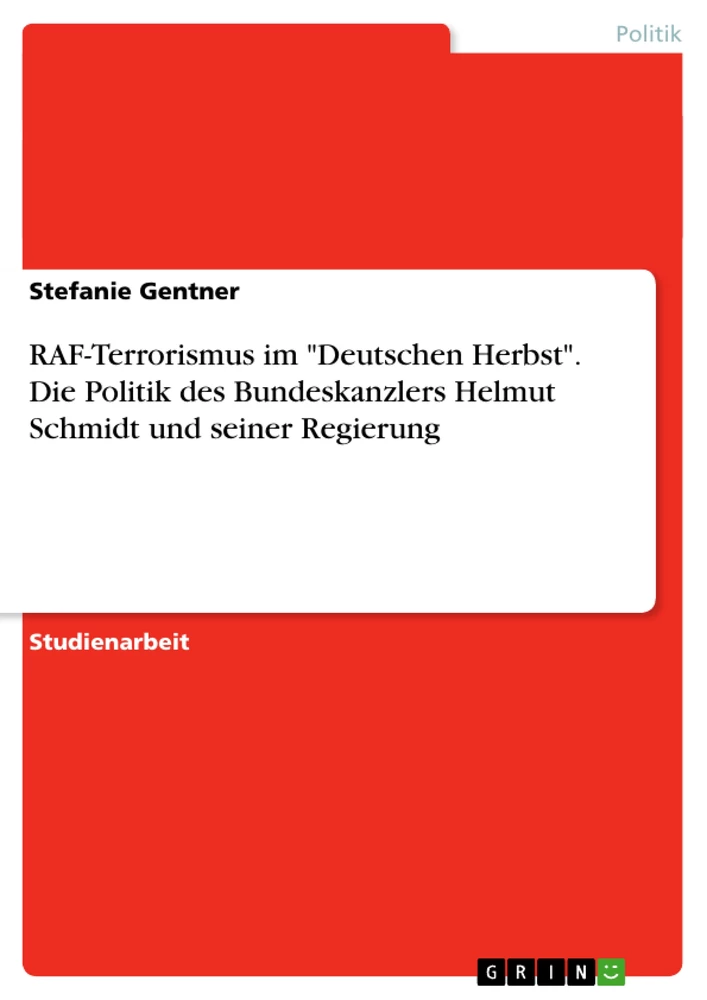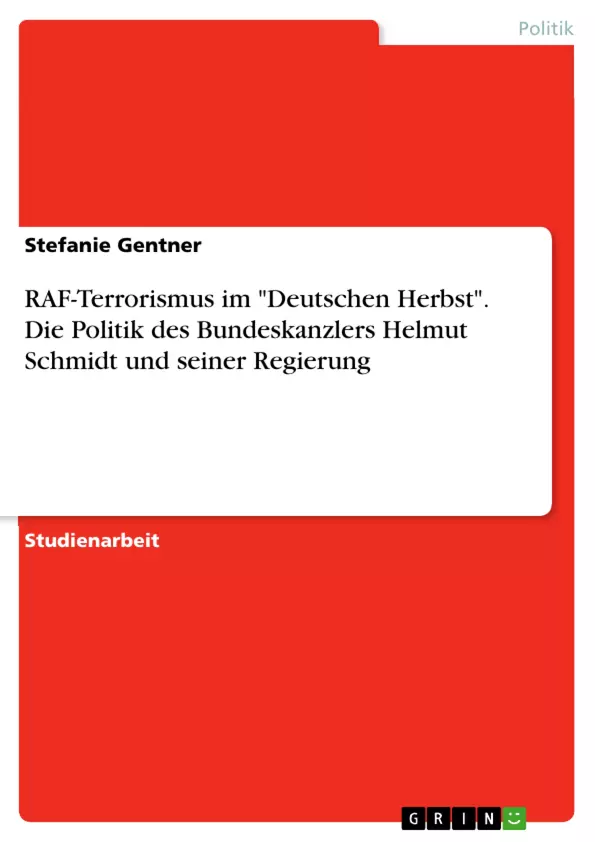Um den Regierungsstil und die Art der Amtsführung eines Bundeskanzlers, und deren Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse in der Politik reflektieren und beurteilen zu können, müssen zunächst die eigentlichen Kompetenzen und die Stellung des Bundeskanzlers dargestellt werden. Hier ist festzustellen, dass die Rolle des Kanzlers als herausragend angesehen wird.
Zentrale Grundlage für die weit reichenden Kompetenzen des Bundeskanzlers ergeben sich aus dem so genannten Kanzlerprinzip. Nach Art. 65 GG hat der Kanzler die Richtlinienkompetenz, das heißt, gegenüber dem Kabinett „bestimmt (er) die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung“ . Dem gesamten Bundestag gegenüber ist er für die Regierungsarbeit verantwortlich. Dabei kommt ihm nach Art. 65 Abs. 1 Satz 4 GG die Leitungskompetenz über die Geschäfte zu. Nach § 1 Abs. 2 GOBReg hat er die Pflicht und das Recht, auf die Durchführung der Richtlinien zu achten. Außerdem ernennt der Bundespräsident entsprechend dem Kabinettsbildungsrecht auf Vorschlag des Bundeskanzlers die Bundesminister (Art. 64 Abs. 1 GG), deren Ämter nach Art. 69 Abs. 2 GG an das des Bundeskanzlers gebunden sind. Zu betonen ist, dass jeder Minister im Rahmen der Richtlinie des Bundeskanzlers entsprechend dem Ressortprinzip für sein Ministerium verantwortlich ist, das besagt Art. 65 Abs. 1 Satz 2 GG. Der Bundeskanzler kann hier nicht ohne weiteres in einzelnen Sachfragen eingreifen. Das Kollegialprinzip grenzt nach Art. 65 Abs. 1 Satz 3 GG die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers zudem noch ein, indem es vorgibt, dass bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ministern die Bundesregierung als Kollegium entscheidet. Hier finden sich somit Handelsbefugnisse und Kompetenzen für das Kabinett als Kollektiv in Abgrenzung zu alleinigen Befugnissen und Vorgaben des Kanzlers. Dieser kurze Abriss macht die Stellung des Bundeskanzlers deutlich. Dennoch: Wie führungsstark ein Kanzler ist, zeigt die Realität. Die Richtlinie orientiert sich am Gesamtcharakter der Politik. Im Falle von Helmut Schmidt betont der Autor Michael Schwelien: „In der Tat gibt das Grundgesetz dem Kanzler eine äußerst starke Stellung – aber wenn der Koalitionspartner sich abwendet, nutzt das alles nichts.“ Ob Helmut Schmidt als fünfter deutscher Bundeskanzler Führungspotenzial bewiesen hat, soll in dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem RAF-Terrorismus zur Zeit des „Deutschen Herbstes“ beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Abriss über Stellung und Aufgaben des Bundeskanzlers im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
- Auswirkungen des RAF-Terrorismus im „Deutschen Herbst“ auf die Politik und das Verhalten des Bundeskanzlers Helmut Schmidt und seiner Regierung
- Die politische Entwicklung Helmut Schmidts und seine Anfänge als Bundeskanzler
- Der junge Schmidt
- Helmut Schmidts politische Laufbahn
- Vorgeschichte zum „Deutschen Herbst“ 1977
- Ereignisse im „Deutschen Herbst“ 1977
- Entführung Hanns-Martin Schleyers
- Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“
- Die Todsnacht im Gefängnis Stammheim in Stuttgart
- Tod Hanns-Martin Schleyers
- Die politische Entwicklung Helmut Schmidts und seine Anfänge als Bundeskanzler
- Schluss: Zusammenfassende Analyse zum Verhalten Helmut Schmidts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des RAF-Terrorismus während des „Deutschen Herbstes“ 1977 auf die Politik und das Verhalten von Bundeskanzler Helmut Schmidt und seiner Regierung. Die Analyse beleuchtet Schmidts Regierungsstil und seine Entscheidungsfindungsprozesse im Kontext dieser extremen Krise.
- Stellung und Aufgaben des Bundeskanzlers im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
- Helmut Schmidts politische Entwicklung und sein Regierungsstil
- Die Ereignisse des „Deutschen Herbstes“ 1977 und ihre unmittelbaren Auswirkungen
- Schmidts Reaktionen auf den Terrorismus und seine Krisenmanagementstrategie
- Langfristige Folgen des „Deutschen Herbstes“ für die deutsche Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Abriss über Stellung und Aufgaben des Bundeskanzlers im politischen System der Bundesrepublik Deutschland: Die Einleitung beschreibt die weitreichenden Kompetenzen des Bundeskanzlers im deutschen politischen System, basierend auf dem Kanzlerprinzip (Art. 65 GG). Sie erläutert die Richtlinienkompetenz, die Leitungskompetenz und die Rolle des Kanzlers bei der Kabinettsbildung. Die Einleitung hebt die Bedeutung des Kanzlerprinzips hervor, betont aber auch die Grenzen der Kanzlermacht durch das Kollegialprinzip und das Ressortprinzip. Die vage Definition der „Richtlinienkompetenz“ wird als ein entscheidender Faktor für die Auslegung und den tatsächlichen Einfluss des Kanzlers in der Politik dargestellt. Schließlich wird die Bedeutung des Kanzlers als Führungspersönlichkeit betont, die auf Autorität und das Vertrauen des Kabinetts angewiesen ist.
Auswirkungen des RAF-Terrorismus im „Deutschen Herbst“ auf die Politik und das Verhalten des Bundeskanzlers Helmut Schmidt und seiner Regierung: Dieses Kapitel analysiert die Reaktion von Bundeskanzler Helmut Schmidt und seiner Regierung auf den RAF-Terrorismus während des „Deutschen Herbstes“ 1977. Es wird die politische Entwicklung Schmidts skizzieren, seine Laufbahn bis zum Kanzleramt beleuchten und dann detailliert die Ereignisse des „Deutschen Herbstes“ behandeln, einschließlich der Entführung Hanns-Martin Schleyers, der Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ und der Ereignisse in Stammheim. Die Analyse wird sich auf die Entscheidungen und Handlungen Schmidts im Umgang mit der Krise konzentrieren und deren Auswirkungen auf die Politik der Bundesrepublik bewerten. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung des Krisenmanagements Schmidts und seiner politischen Strategie angesichts der außergewöhnlichen Herausforderungen des Terrorismus.
Schlüsselwörter
Bundeskanzler, Helmut Schmidt, RAF, Deutscher Herbst, Terrorismus, Krisenmanagement, Richtlinienkompetenz, Kanzlerprinzip, Kollegialprinzip, Ressortprinzip, Politik, Regierungsstil, Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Auswirkungen des RAF-Terrorismus im „Deutschen Herbst“ auf Helmut Schmidt
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen des RAF-Terrorismus während des „Deutschen Herbstes“ 1977 auf die Politik und das Verhalten von Bundeskanzler Helmut Schmidt und seiner Regierung. Sie untersucht Schmidts Regierungsstil und seine Entscheidungsfindungsprozesse in dieser extremen Krise. Der Fokus liegt auf Schmidts Krisenmanagement und seiner politischen Strategie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Stellung und Aufgaben des Bundeskanzlers im deutschen politischen System, Helmut Schmidts politische Entwicklung und Regierungsstil, die Ereignisse des „Deutschen Herbstes“ 1977 und deren Auswirkungen, Schmidts Reaktionen auf den Terrorismus und seine Krisenmanagementstrategie, sowie die langfristigen Folgen des „Deutschen Herbstes“ für die deutsche Politik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil über die Auswirkungen des RAF-Terrorismus im „Deutschen Herbst“, und einem Schluss. Die Einleitung beschreibt die Kompetenzen des Bundeskanzlers im deutschen politischen System. Der Hauptteil analysiert detailliert Schmidts Reaktion auf den Terrorismus, inklusive der Ereignisse der Entführungen und der Geschehnisse in Stammheim. Der Schluss bietet eine zusammenfassende Analyse von Schmidts Verhalten.
Wie wird die Rolle des Bundeskanzlers beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die weitreichenden Kompetenzen des Bundeskanzlers basierend auf dem Kanzlerprinzip (Art. 65 GG), einschließlich Richtlinienkompetenz und Leitungskompetenz. Sie betont aber auch die Grenzen der Kanzlermacht durch das Kollegialprinzip und das Ressortprinzip und die Bedeutung des Kanzlers als Führungspersönlichkeit.
Welche Ereignisse des „Deutschen Herbstes“ werden behandelt?
Der Hauptteil behandelt detailliert die Ereignisse des „Deutschen Herbstes“ 1977, insbesondere die Entführung Hanns-Martin Schleyers, die Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ und die Ereignisse in Stammheim. Die Analyse konzentriert sich auf Schmidts Entscheidungen und Handlungen im Umgang mit der Krise.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Bundeskanzler, Helmut Schmidt, RAF, Deutscher Herbst, Terrorismus, Krisenmanagement, Richtlinienkompetenz, Kanzlerprinzip, Kollegialprinzip, Ressortprinzip, Politik, Regierungsstil, Entscheidungsfindung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Kontext des deutschen politischen Systems und der Reaktion auf Terrorismus.
- Citar trabajo
- MA Stefanie Gentner (Autor), 2007, RAF-Terrorismus im "Deutschen Herbst". Die Politik des Bundeskanzlers Helmut Schmidt und seiner Regierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89200