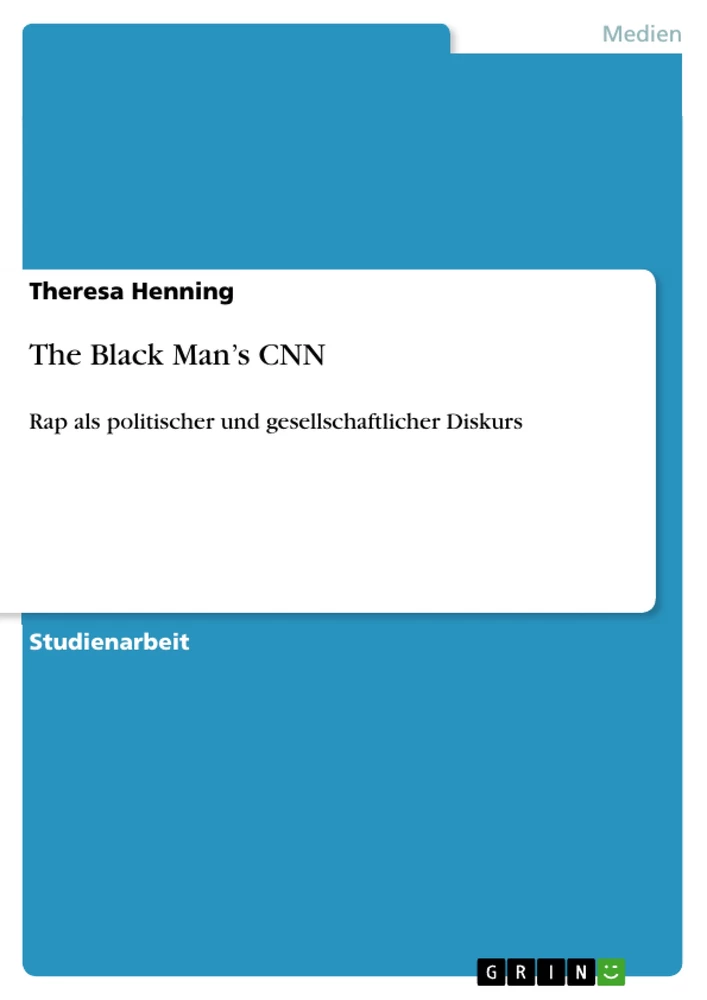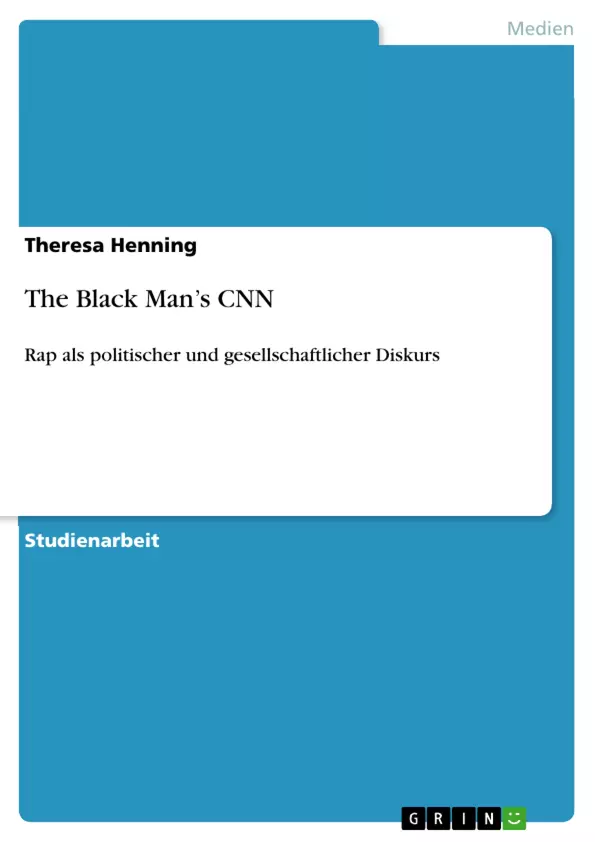„Black Music“ barg über Jahrhunderte das Potential, Unterdrückung und Rassentrennung zu beklagen. Doch erst in den frühen 80er Jahren begannen afroamerikanische Männer in der South Bronx New Yorks, Musik intensiv als Medium zu nutzen, um politische Meinungen zu artikulieren und ein Bewusstsein für soziale Missstände zu schaffen. Die informelle Segregation erwies sich als weitaus hartnäckiger als die gesetzliche, denn der Rassismus war noch tief in den Köpfen der weißen Mehrheit eingegraben. Vor diesem Hintergrund entstand in den 70er Jahren die Hip-Hop-Kultur als eine Alternative zu den Bandenkriegen der späten 60er Jahre. Sie funktionierte jedoch zuerst lange Zeit nur im Untergrund, wo sich einst rivalisierende Gangs nun gegenseitig Wortgefechte (sogenannte „Battles“) im Sprechgesang lieferten. Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die neue Bewegung auch außerhalb der schwarzen Szene Aufmerksamkeit erhielt. 1979 wurden erste Platten veröffentlicht (allen voran „Rapper’s Delight“ von der Sugarhill Gang), und mit „The Message“ (von Grandmaster Flash and the Furious Five) gerieten schließlich diejenigen, die sich stets nur am Rande der Gesellschaft befanden, zum ersten Mal in das Zentrum weißer Wahrnehmung. Dieser Hit aus dem Jahre 1982 leitete eine Phase des inhaltlich bestimmten und engagierten Rap ein. Hip Hop wurde zu einer Lebensphilosophie („Hip Hop is not just a music, it is an attitude, it is an awareness, it is a way to view the world.“ ) und Rap zu einer Ausdrucksform, die Chuck D, Frontmann der Gruppe Public Enemy, Mitte der 80er Jahre zum CNN der schwarzen Bevölkerung („the black man’s CNN“) ernannte. „Rap hat den Schwarzen eine Sprache gegeben.“ Da das Fernsehen nur einseitige Informationen lieferte, erfuhren sie beim Hören der Musik erstmals etwas über die Lebensverhältnisse anderer Afroamerikaner. Rap wird in den folgenden Jahren für Gruppen wie Public Enemy, Boogie Down Productions und etwas später Dead Prez zum Medium für Botschaften, zum „Message Rap“. Ihr erklärtes Ziel ist es, schwarze Jugendliche in ihrer eigenen Sprache anzusprechen und sie über Themen aufzuklären, die für ihr Leben eine Rolle spielen. Die Texte dieser Künstler sollen im Folgenden als Grundlage dienen, um den Rap der 80er und 90er Jahre als ein wichtiges Kommunikationsmedium für die Reproduktion und Verbreitung politischer und sozialer Ansichten herauszustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung: Rap als Sprachrohr der Unterdrückten
- 2. Ghettozentrismus
- 3. Afrozentrismus
- 4. Gangsta Rap und Rassismus
- 5. „Stop the Violence“ und Selbstkritik
- 6. Conscious Rap
- 7. Religion
- 8. Merkmale der Diskursstrategie
- 9. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Rap der 1980er und 1990er Jahre als ein wichtiges Kommunikationsmedium für afroamerikanische Künstler, das es ihnen ermöglichte, politische und soziale Ansichten zu artikulieren und soziale Missstände aufzudecken. Sie beleuchtet, wie Rap zu einer Plattform für soziale und politische Kritik wurde und die Lebensrealität und die Herausforderungen afroamerikanischer Menschen in den Vereinigten Staaten widerspiegelte.
- Der Einfluss der Hip-Hop-Kultur auf die politische Kommunikation
- Die Darstellung von Ghettozentrismus und die Lebensbedingungen in afroamerikanischen Gemeinden
- Die Rolle von Rap als Sprachrohr für soziale und politische Kritik am Rassismus und an der Diskriminierung in der US-amerikanischen Gesellschaft
- Die verschiedenen Strömungen im Rap, wie z.B. „Message Rap“, „Conscious Rap“ und „Gangsta Rap“
- Die Bedeutung von Rap für die Identitätsfindung und den Ausdruck von Selbstbewusstsein innerhalb der afroamerikanischen Community
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Rap als Sprachrohr der Unterdrückten
Dieses Kapitel führt in die Geschichte des Raps als politisches und soziales Medium ein und zeigt, wie er aus den Ghettos von New York entstand. Es beleuchtet den Kontext der Unterdrückung und des Rassismus, der zur Entstehung der Hip-Hop-Kultur führte. Des Weiteren wird die Bedeutung von Rap als Alternative zu Bandenkriegen und als Sprachrohr für die afroamerikanische Community hervorgehoben.
2. Ghettozentrismus
Das Kapitel fokussiert auf die Darstellung von Ghettozentrismus in Rap-Texten der 1980er und 1990er Jahre. Es analysiert, wie Rap-Künstler die Lebensbedingungen in afroamerikanischen Ghettos, die Probleme von Armut, Kriminalität und Diskriminierung thematisieren und die Perspektive derjenigen reflektieren, die in diesen Gemeinden leben. Die Bedeutung von „The Message“ als ein Frühbeispiel für Ghettozentrismus im Rap wird erläutert.
- Quote paper
- Theresa Henning (Author), 2004, The Black Man’s CNN, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89214