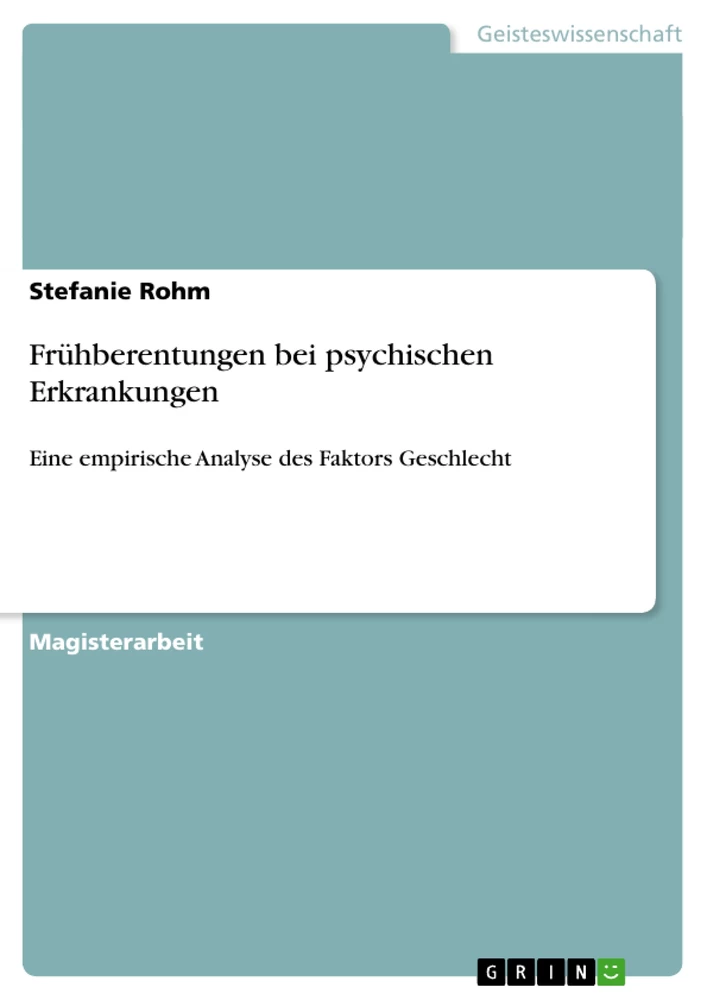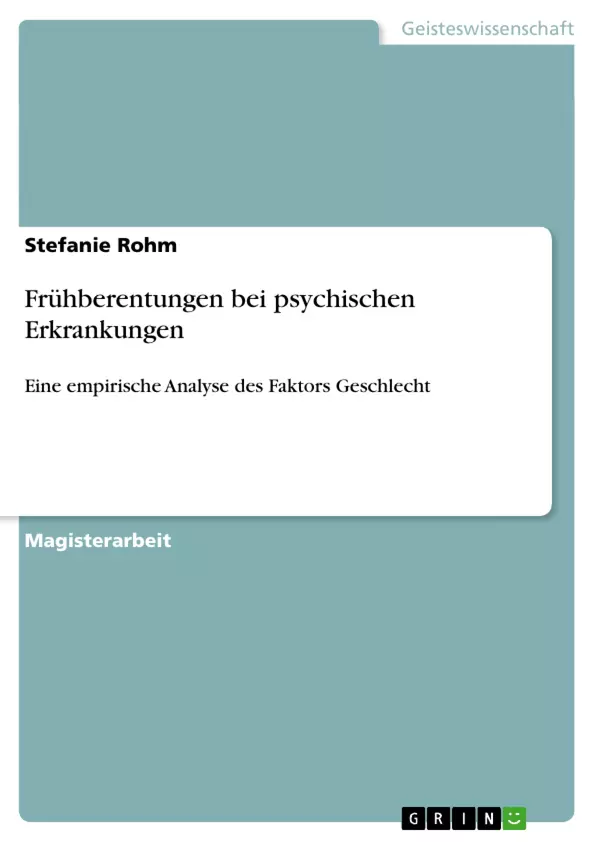Der Übertritt in den Ruhestand ist heute für alle erwerbstätigen Personen ein wichtiger Lebensabschnitt. Die Bedeutung dieses Ereignisses liegt in dem Rückzug aus dem Erwerbsleben, womit gleichzeitig die Herausforderung für eine neue alltägliche Lebensgestaltung besteht.
Gemeinhin wird angenommen, dass der Übergang in die Rente für Frauen weniger problematisch ist als für Männer. Das Argument bezieht sich auf die geschlechtsspezifische Einstellung zur Erwerbstätigkeit. “Men have […] a ‘one-dimensional’ view of life. Work is very important. Women have a more multidimensional perspective […]“ (Einerhand & van der Stelt 2005: 81). Bei Männern stellt die berufliche Tätigkeit folglich einen hohen Identitätsfaktor dar, während Frauen sich zumeist mehreren Dingen (Kindererziehung, Familie und Beruf) gleichzeitig widmen, woraufhin vielfach angenommen wird, Erwerbstätigkeit sei für sie weniger wichtig.
In einer US-Studie konnte gezeigt werden, dass der (Vor-)Ruhestand durchschnittlich zwei Jahre nach der Berentung eher von Männern positiv wahrgenommen wird, während sich bei Frauen depressive Symptome einstellen. Frühzeitige Berentung wieder-um verstärkt depressive Symptome vor allem bei Männern (Kim & Moen 2002). Der Ausschluss aus der Berufswelt ist demzufolge für viele Frühberentete mit gesellschaftlicher Exklusion aufgrund fehlender Partizipation am Arbeitsmarkt verbunden.
In einer Schweizer Studie wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise der Status der Berufsunfähigkeit ein gering stigmatisierter Status ist - im Gegensatz zu dem der Arbeitslosigkeit (Herzer 2000). Möglicherweise stellt sich zudem nach jahrzehntelanger Erwerbstätigkeit eine Art Gerechtigkeitsempfinden ein, den „Beitrag“ zur Gesellschaft bereits geleistet und damit Anspruch auf eine (vorzeitige) Rente zu haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Vorüberlegungen
- Geschlecht und Frühberentung
- Frühberentung in der Bundesrepublik Deutschland
- Frühberentungen und sozioökonomischer Status
- Frühberentung und Familienstand
- Frühberentung und Erwerbstätigkeit
- Fazit: Geschlecht und Frühberentung
- Geschlecht und psychische Störungen
- Allgemeine Epidemiologie
- Geschlechtsunterschiede bei Depressionen
- Geschlechtsunterschiede bei Angststörungen
- Geschlechtsunterschiede bei somatoformen Störungen
- Geschlechtsunterschiede bei Alkoholstörungen
- Geschlechtsunterschiede bei Schizophrenie
- Erwerbsarbeit, Geschlecht und psychische Gesundheit
- Epidemiologie im Ost-West-Vergleich
- Fazit: Geschlecht und psychische Störungen
- Geschlecht und Erwerbsarbeit
- Die Entwicklung der Lebensverlaufsforschung
- Geschlechtsspezifik von Erwerbsverläufen in Westdeutschland
- Erwerbsverläufe im Ost-West-Vergleich
- Fazit: Geschlecht und Erwerbsarbeit
- Zusammenfassung
- Geschlecht und Frühberentung
- Empirische Untersuchung
- Datengrundlage
- Methode
- Soziodemographische Merkmale
- Epidemiologische Merkmale
- Erwerbsbezogene Rentenmerkmale
- Ergebnisse
- Frühberentung, Geschlecht und Risikofaktoren
- Epidemiologie, Geschlecht und Region
- Erwerbsverlauf, Geschlecht und Region
- Diskussion der Ergebnisse
- Frühberentung und Risikofaktoren
- Frühberentung und Epidemiologie
- Frühberentung und Erwerbsarbeit
- Stärken und Schwächen der Methode
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der empirischen Analyse des Faktors Geschlecht im Zusammenhang mit Frühberentungen bei psychischen Erkrankungen. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Geschlecht, psychischen Störungen, Erwerbsverlauf und Frühberentung zu untersuchen.
- Geschlechtsunterschiede in Bezug auf Frühberentung aufgrund psychischer Erkrankungen
- Risikofaktoren, die mit Frühberentung im Zusammenhang stehen
- Epidemiologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern
- Der Einfluss des Geschlechts auf den Erwerbsverlauf und die Frühberentung
- Regionale Unterschiede in der Frühberentungsrate
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Ruhestandes als Lebensabschnitt und stellt die These auf, dass der Übergang in die Rente für Frauen weniger problematisch ist als für Männer. Die Studie fokussiert auf die Frühberentung wegen Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer Störungen und beleuchtet die Forschungslücke hinsichtlich der Einflüsse von Geschlecht auf diese Art der Berentung.
Theoretische Vorüberlegungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Studie. Es werden die Konzepte Geschlecht, Frühberentung und psychische Störungen in Bezug zueinander analysiert. Es wird die Geschlechterforschung im Hinblick auf Erwerbsarbeit und die Bedeutung von psychischen Störungen für die Frühberentung beleuchtet.
Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Datengrundlage und die Methoden der Untersuchung. Die Ergebnisse werden in Bezug auf Geschlecht, Risikofaktoren, Epidemiologie und Erwerbsverlauf analysiert und interpretiert. Die Studie untersucht auch regionale Unterschiede in der Frühberentungsrate.
Diskussion der Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung diskutiert. Die Untersuchungsergebnisse werden im Kontext der Literatur und der theoretischen Vorüberlegungen analysiert. Die Studie beleuchtet die Stärken und Schwächen der Methode sowie die Grenzen der Interpretation der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Frühberentung, Geschlecht, psychische Erkrankungen, Erwerbsunfähigkeit, Erwerbsverlauf, Risikofaktoren, Epidemiologie, Regionale Unterschiede
Häufig gestellte Fragen
Warum nehmen psychische Erkrankungen als Grund für Frühberentung zu?
Steigender Leistungsdruck am Arbeitsmarkt, veränderte Arbeitswelten und eine bessere diagnostische Erfassung führen dazu, dass immer mehr Menschen aufgrund von Depressionen oder Burnout vorzeitig in Rente gehen.
Gibt es Geschlechtsunterschiede bei der Frühberentung?
Ja, die Arbeit untersucht, ob Männer den Verlust des Arbeitsplatzes als Identitätsverlust stärker empfinden, während Frauen oft eine multidimensionale Perspektive (Familie und Beruf) haben.
Welche psychischen Störungen führen am häufigsten zur Rente?
Depressionen, Angststörungen und somatoforme Störungen gehören zu den Hauptgründen für eine Erwerbsunfähigkeit vor dem Erreichen des regulären Rentenalters.
Wie wirkt sich der Familienstand auf das Risiko einer Frühberentung aus?
Statistiken zeigen oft, dass Alleinstehende ein höheres Risiko für psychische Instabilität und damit für eine krankheitsbedingte Frühberentung haben als Menschen in stabilen Partnerschaften.
Gibt es regionale Unterschiede (Ost-West) bei der Frühberentung?
Die Studie analysiert epidemiologische Merkmale im Ost-West-Vergleich und stellt fest, dass unterschiedliche Erwerbsbiografien und regionale Arbeitsmarktbedingungen die Raten beeinflussen.
Ist die Frühberentung mit sozialer Stigmatisierung verbunden?
Während Arbeitslosigkeit oft stark stigmatisiert ist, wird Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit gesellschaftlich teilweise eher als legitimer "Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen" akzeptiert.
- Quote paper
- Magister Artium Stefanie Rohm (Author), 2007, Frühberentungen bei psychischen Erkrankungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89232