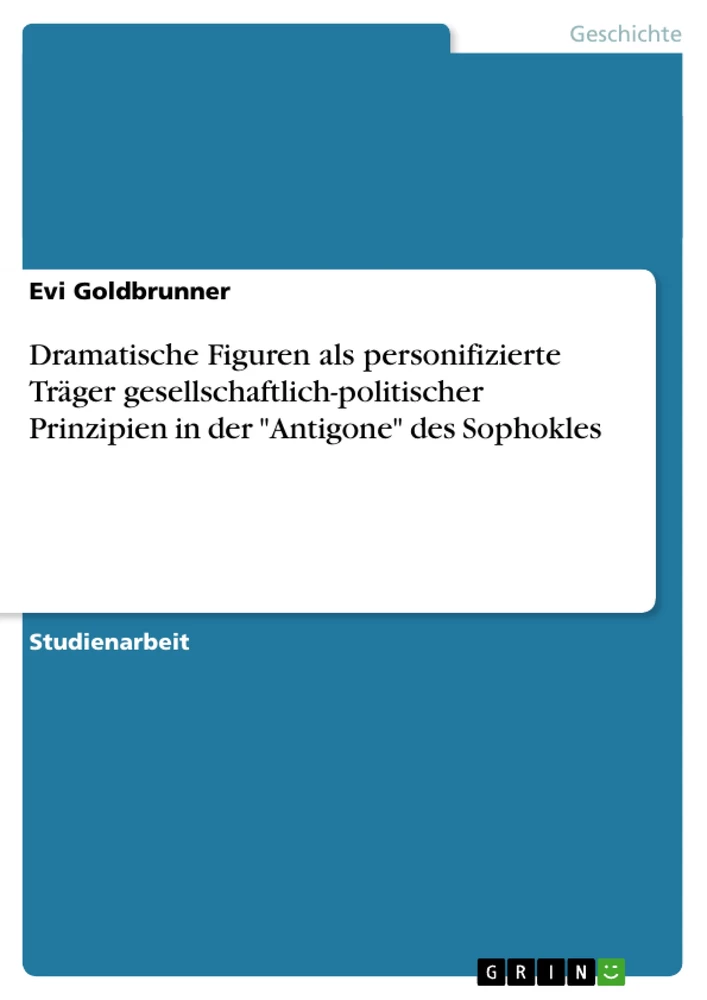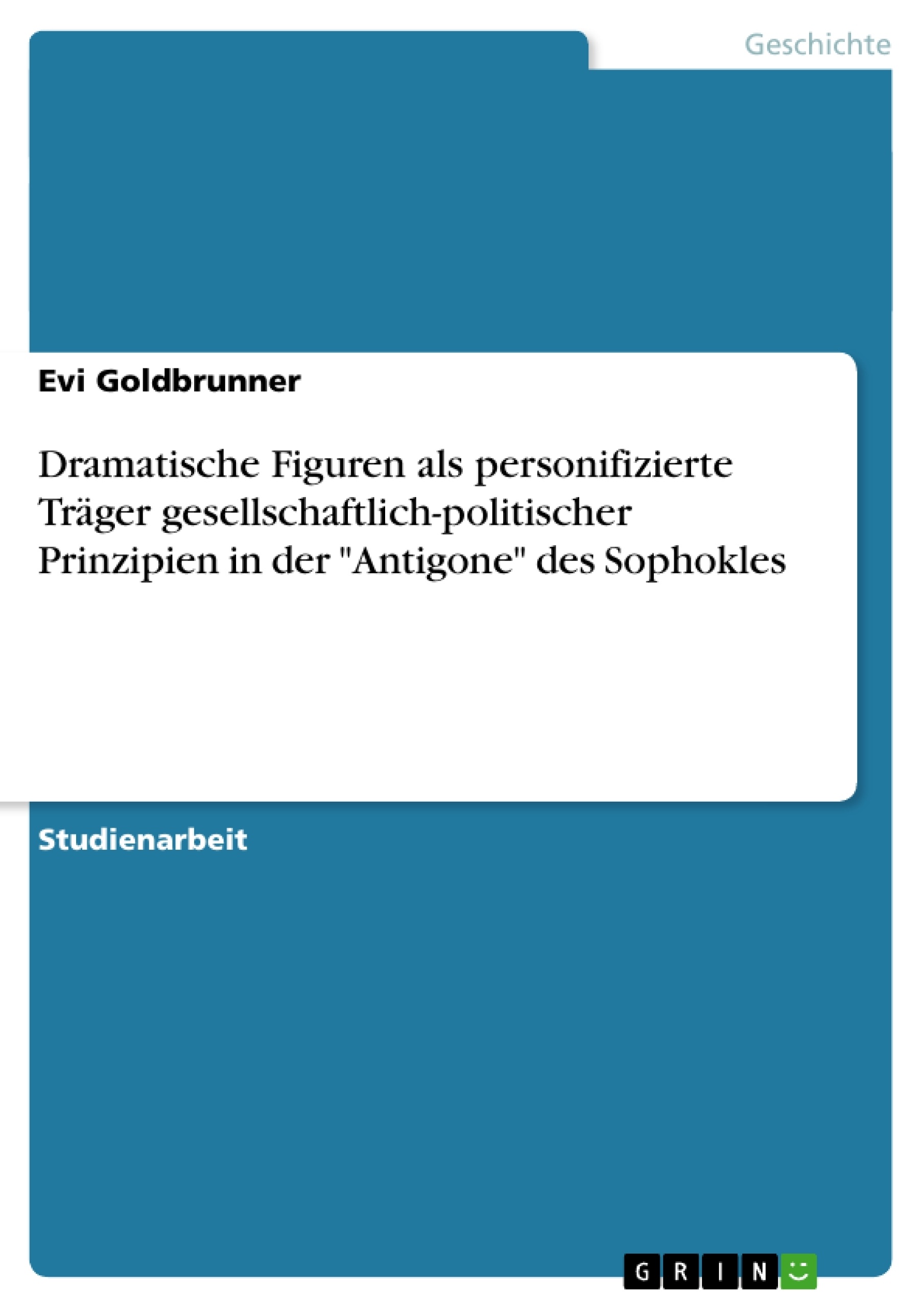Wie alle griechischen Tragödien so war auch die "Antigone" des Sophokes keineswegs für ein Fachpublikum, sondern für die gesamte attische Bürgerschaft bestimmt und hatte somit allein durch ihre Zielgruppe eine das soziale Bewußtsein bildende Funktion bzw. die Aufgabe, die Bürgerschaft Athens für bestimmte politische Vorgänge zu sensibilisieren.
Darüberhinaus war Sophokles' "Antigone" zur Zeit ihrer Uraufführung 440 v.Chr. von großer politischer wie auch sozialer Brisanz, denn obwohl die rein äußere Handlung der "Antigone" in die mythische Vergangenheit zurückversetzt ist, war doch ihre thematische Problematik vor dem Hintergrund der beginnenden Poliskrise von großer Aktualität.
Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine historische und nicht um eine altphilologische Abhandlung handelt, werden nicht die sprachlich-literarischen Dimsionen der "Antigone", sondern vielmehr die sozialen und politischen Bedingungen ihres Entstehungskontextes herausgearbeitet. Diesen Entstehungskontext bildet das Perikleische Athen des 5. Jahrhunderts v.Chr., in dem sich der Übergang von archaischer zu klassischer Zeit bzw. von der Aristokratie zur Polisdemokratie vollzog.
Vor diesem Hintergrund bleiben im Rahmen dieser Arbeit die individuellen Komponenten der einzelnen Charaktere in der "Antigone" unberücksichtigt und werden stattdessen die Figuren ausschließlich in ihrer Funktion als personifizierte Träger jener gesellschaftlich-politischen Prinzipien und Haltungen untersucht, die Sophokles für seine Zeit auszumachen glaubte. Denn indem Sophokles jeder Figur ein bestimmtes Prinzip bzw. eine bestimmte Haltung zuordnete, konnte er eine aktelle politische Stimmung artikulieren. Dies anhand eines für eine Tragödie adaptierten mythologischen Stoffes zu tun, war gerade zu jener Zeit allgemeiner Usus.
Sieht man diese Wirkungsabsicht Sophokles' als gegeben an, so sind konkret für seine "Antigone" folgende Thesen als richtig zu werten: (1) Sophokles hat den Antigone-Mythos nach den sozialen, religiösen und politischen Verhältnissen des Athens des 5. Jahrhunderts umgeformt. (2) Genauso wie das Theben vor Kreons Herrschaft die archaische, so verkörpert das Theben unter Kreons Herrschaft die klassische attische Ordnung. (3) Entsprechend ist die Bürgerschaft Athens in der Bürgerschaft Thebens dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Antigone als Verkörperung der tradierten Ordnung
- 1.1. Die Prinzipien der Antigone
- 1.2. Sophokles' Darstellung der Antigone.
- 2. Kreon als Verkörperung des neuen Systems
- 2.1. Die Prinzipien des Kreon
- 2.2. Sophokles' Darstellung des Kreon......
- 3. Verkörperungen der passiven bürgerlichen Haltungen in der Ismene, dem
Haimon, dem Wächter sowie dem Chor.
- 3.1. Die Konformität der Ismene..
- 3.2. Die Rationalität des Haimon
- 3.3. Der Egoismus des Wächters.
- 3.4. Die Diplomatie des Chors.....
- 4. Verkörperung des göttlichen Willens in Teiresias.
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die "Antigone" des Sophokles unter dem Blickwinkel der gesellschaftlich-politischen Prinzipien und Haltungen, die durch die einzelnen Figuren verkörpert werden. Die Analyse fokussiert auf die Entstehung des Dramas im Kontext des Perikleischen Athens, der sich im Übergang von der archaischen zur klassischen Zeit befand, und untersucht die Figuren als Repräsentanten der sich verändernden sozialen und politischen Ordnung.
- Die gegensätzlichen Prinzipien der tradierten Ordnung (vertreten durch Antigone) und des neuen Systems (vertreten durch Kreon).
- Die Darstellung der Figuren als personifizierte Träger von gesellschaftlich-politischen Prinzipien und Haltungen.
- Die passiven Haltungen der Bürgerschaft, die durch die Nebenfiguren Ismene, Haimon, den Wächter und den Chor dargestellt werden.
- Der göttliche Wille als maßgebliche letzte Instanz, der durch Teiresias verkörpert wird.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt den historischen Kontext der "Antigone" und die Relevanz des Dramas für die attische Bürgerschaft im 5. Jahrhundert v.Chr. Die Arbeit konzentriert sich auf die sozialen und politischen Bedingungen des Dramas, statt auf sprachlich-literarische Dimensionen. Anschließend werden die beiden Hauptfiguren Antigone und Kreon beleuchtet, die als Verkörperung der gegensätzlichen Prinzipien der tradierten Ordnung und des neuen Systems dargestellt werden.
Im nächsten Kapitel werden die Nebenfiguren Ismene, Haimon, der Wächter und der Chor behandelt. Diese Figuren repräsentieren die passiven Haltungen der Bürgerschaft, wie Konformität, Rationalität, Egoismus und Diplomatie. Schließlich wird im Kapitel über Teiresias der göttliche Wille als letzte Instanz eingeführt, der die anderen dargestellten Prinzipien und Haltungen bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit analysiert die "Antigone" des Sophokles im Kontext des 5. Jahrhunderts v.Chr., fokussiert auf die gesellschaftlich-politischen Prinzipien und Haltungen, die durch die Figuren verkörpert werden. Die Analyse untersucht die Rolle von Antigone und Kreon als Verkörperung der tradierten Ordnung und des neuen Systems, sowie die passiven Haltungen der Bürgerschaft, die durch die Nebenfiguren repräsentiert werden. Der göttliche Wille wird durch Teiresias als letzte Instanz dargestellt.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Fokus legt die Arbeit bei der Analyse der "Antigone"?
Die Arbeit ist eine historische Abhandlung, die sich auf die sozialen und politischen Bedingungen des Entstehungskontextes im 5. Jahrhundert v. Chr. konzentriert.
Was verkörpert die Figur der Antigone in dieser Analyse?
Antigone wird als Verkörperung der tradierten, archaischen Ordnung und religiöser Prinzipien dargestellt.
Welches Prinzip repräsentiert Kreon?
Kreon steht für das neue System der Polisdemokratie und die klassische attische Ordnung seiner Zeit.
Welche Rolle spielen Nebenfiguren wie Ismene oder der Wächter?
Diese Figuren verkörpern passive bürgerliche Haltungen wie Konformität, Egoismus oder Rationalität innerhalb der Gesellschaft.
Wie wird der göttliche Wille im Stück dargestellt?
Der Seher Teiresias fungiert als personifizierter Träger des göttlichen Willens und als letzte moralische Instanz.
- Citation du texte
- Evi Goldbrunner (Auteur), 1999, Dramatische Figuren als personifizierte Träger gesellschaftlich-politischer Prinzipien in der "Antigone" des Sophokles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89286