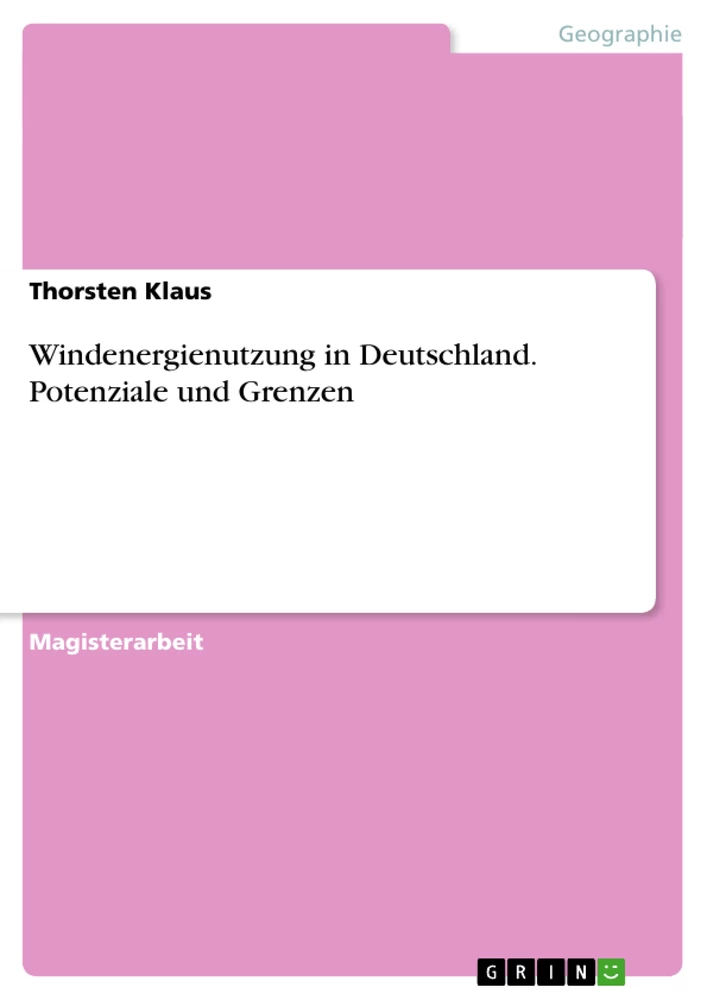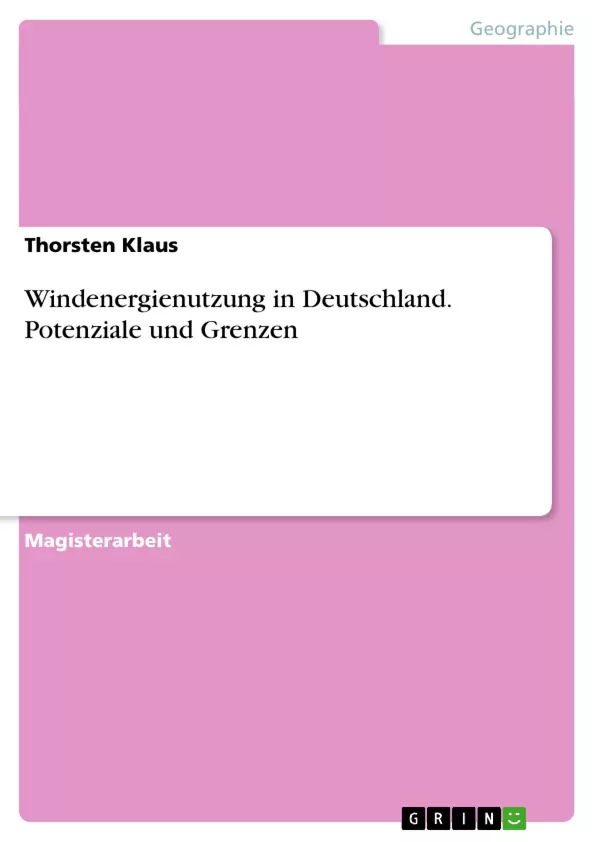Die Windenergie soll einen wichtigen Beitrag zu dem ehrgeizigen Klimaschutzziel der deutschen Bundesregierung leisten, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% gegenüber dem Wert von 1990 zu senken (vgl. BMU 2007). Seit den 1990er Jahren schreitet ihr Ausbau rasant voran. Allerdings deuten die z.T. beträchtlichen Akzeptanzprobleme v.a. in den Küstengebieten auf das erhebliche Konfliktpotenzial dieser Art der Stromerzeugung hin.
Es sollen im Folgenden die Chancen und Potenziale der Windenergienutzung, aber auch ihre Grenzen dargestellt werden. Vorliegende Arbeit fragt zunächst nach den Gründen der zu beobachtenden dynamischen Entwicklung der Windenergienutzung und erläutert dann – mit besonderem Blick auf die Offshore-Windenergie – die möglichen Auswirkungen von Windenergieanlagen (WEA) auf Mensch und Natur.
Neben der Methodik der Standortermittlung für WEA stehen hier v.a. mögliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, Aspekte des Natur- und Umweltschutzes, sowie Fragen der Akzeptanz von WEA im Vordergrund. Hier zeigt sich, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Windenergienutzung nicht auf wirtschaftsgeographische Fragestellungen beschränkt bleiben darf. Ebenso müssen sozial- und verhaltenswissenschaftliche Aspekte berücksichtigt werden.
Für die vorliegende Untersuchung wurde eine Literaturanalyse durchgeführt, welche die relevanten aktuellen Studien und Fachartikel berücksichtigt. Eine gezielte Dokumentenrecherche in den Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) vervollständigt die Quellenarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbemerkungen und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Gesetzliche Förderinstrumente
- 2.1 Stromeinspeisungsgesetz
- 2.2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- 2.3 Subventionierung - Sinn oder Unsinn?
- 3. Standortermittlung für Windenergieanlagen
- 3.1 Die Methodik in Nordrhein-Westfalen
- 3.2 Der Beitrag der Standortermittlung zur Konfliktminimierung
- 4. Das naturräumliche Potenzial Deutschlands hinsichtlich der Windenergienutzung
- 4.1 Aspekte der Windströmungen
- 4.2 Räumliche Verteilung der Windenergiestandorte in Deutschland
- 4.3 Windenergiepotenziale in großen Nabenhöhen
- 5. Die Windenergienutzung in Deutschland aus wirtschaftsgeographischer Sicht
- 5.1 Installierte Leistung
- 5.2 Arbeitsplatzeffekte
- 5.2.1 Bruttobeschäftigungseffekte
- 5.2.2 Nettobeschäftigungseffekte
- 5.3 Repowering-Maßnahmen
- 5.4 Probleme der Netzintegration des Windstroms
- 6. Offshore-Windenergienutzung
- 6.1 Ökologische Fragen und Probleme
- 6.2 Offshore-Windenergienutzung – Eine energiepolitische Perspektive?
- 7. Praxisteil/Vorbemerkungen
- 7.1 Akzeptanzfragen
- 7.2 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes?
- 7.3 Akustische Auswirkungen
- 7.4 Visuelle Auswirkungen
- 7.5 Flächenverbrauch und Bodenversiegelung
- 7.6 Effekte auf Vögel
- 7.7 Eisansatz
- 7.8 Sonstige Gefahrenpotenziale
- 7.9 Lösungsansätze
- 8. Fallstudie: Die Konflikte um die Offshore-Windenergienutzung
- 8.1 Offshore-Windenergienutzung als Hoffnungsträger einer strukturschwachen Region?
- 8.2 Die ökonomischen Akteure
- 8.3 Negative Effekte auf die Tourismusbranche als Folge von „Horizontverschmutzung“?
- 8.4 Der innerökologische Konflikt
- 8.5 Die Perspektive der Fischereiwirtschaft
- 8.6 Offshore-Windparks als Auslöser von Ölkatastrophen?
- 8.7 Perspektiven der Konfliktlösung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Windenergienutzung in Deutschland und analysiert deren Potenziale und Grenzen. Sie beleuchtet die dynamische Entwicklung der Windenergienutzung und untersucht die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Mensch und Natur, insbesondere im Bereich der Offshore-Windenergie. Der Fokus liegt dabei auf der Standortermittlung, der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, dem Natur- und Umweltschutz sowie der Akzeptanz von Windenergieanlagen. Die Arbeit zeigt, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Windenergienutzung notwendig ist, die sowohl wirtschaftsgeographische als auch sozial- und verhaltenswissenschaftliche Aspekte berücksichtigt.
- Entwicklung der Windenergienutzung in Deutschland
- Potenziale und Grenzen der Windenergienutzung
- Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Mensch und Natur
- Standortermittlung und Akzeptanz von Windenergieanlagen
- Konflikte und Herausforderungen der Offshore-Windenergienutzung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Windenergienutzung für die deutsche Energiepolitik.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den gesetzlichen Förderinstrumenten für Windenergieanlagen, insbesondere dem Stromeinspeisungsgesetz und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
- Kapitel 3: Hier wird die Standortermittlung für Windenergieanlagen, speziell in Nordrhein-Westfalen, behandelt, und der Beitrag zur Konfliktminimierung beleuchtet.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel wird das naturräumliche Potenzial Deutschlands hinsichtlich der Windenergienutzung analysiert, wobei Windströmungen, die räumliche Verteilung der Standorte und Windenergiepotenziale in großen Nabenhöhen betrachtet werden.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel befasst sich mit der Windenergienutzung in Deutschland aus wirtschaftsgeographischer Sicht. Es analysiert die installierte Leistung, Arbeitsplatzeffekte, Repowering-Maßnahmen und die Probleme der Netzintegration des Windstroms.
- Kapitel 6: Hier wird die Offshore-Windenergienutzung behandelt. Ökologische Fragen und Probleme sowie die energiepolitische Perspektive der Offshore-Windenergie werden diskutiert.
- Kapitel 7: Der Praxisteil befasst sich mit Akzeptanzfragen, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, akustischen und visuellen Auswirkungen, Flächenverbrauch und Bodenversiegelung, Effekten auf Vögel, Eisansatz, sonstigen Gefahrenpotenzialen und Lösungsansätzen.
- Kapitel 8: In der Fallstudie werden die Konflikte um die Offshore-Windenergienutzung im Detail untersucht, wobei die Rolle der ökonomischen Akteure, die Auswirkungen auf die Tourismusbranche, den innerökologischen Konflikt, die Perspektive der Fischereiwirtschaft, die Gefahr von Ölkatastrophen und Perspektiven der Konfliktlösung betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Windenergienutzung, Offshore-Windenergie, Standortermittlung, Akzeptanz, Landschaftsbild, Natur- und Umweltschutz, Konflikte, Energiepolitik, wirtschaftsgeographische Aspekte, sozial- und verhaltenswissenschaftliche Aspekte, sowie die Rolle der ökonomischen Akteure. Darüber hinaus werden wichtige Begriffe wie Erneuerbare Energien, Nennleistung, Bruttostromverbrauch und Nettostromverbrauch erläutert.
Häufig gestellte Fragen
Welches Klimaschutzziel verfolgt die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Windenergie?
Die Bundesregierung strebt an, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 40 % gegenüber dem Wert von 1990 zu senken, wobei die Windenergie einen wesentlichen Beitrag leisten soll.
Welche gesetzlichen Förderinstrumente für Windenergie werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit beleuchtet insbesondere das Stromeinspeisungsgesetz sowie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
Was sind die größten Konfliktpotenziale bei der Windenergienutzung?
Zu den Hauptkonflikten zählen Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung, Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ("Horizontverschmutzung"), akustische Auswirkungen sowie der Natur- und Umweltschutz.
Welche Rolle spielt die Offshore-Windenergie in der Untersuchung?
Die Offshore-Windenergie wird als Hoffnungsträger für strukturschwache Regionen betrachtet, bringt jedoch spezifische ökologische Probleme und Konflikte mit der Tourismus- und Fischereiwirtschaft mit sich.
Wie wird die Standortermittlung für Windenergieanlagen durchgeführt?
Die Arbeit erläutert die Methodik am Beispiel von Nordrhein-Westfalen und zeigt auf, wie eine fundierte Standortermittlung zur Konfliktminimierung beitragen kann.
Welche wirtschaftsgeographischen Aspekte werden betrachtet?
Untersucht werden unter anderem die installierte Leistung, Brutto- und Nettobeschäftigungseffekte sowie Probleme bei der Netzintegration des Windstroms.
- Arbeit zitieren
- Thorsten Klaus (Autor:in), 2008, Windenergienutzung in Deutschland. Potenziale und Grenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89300