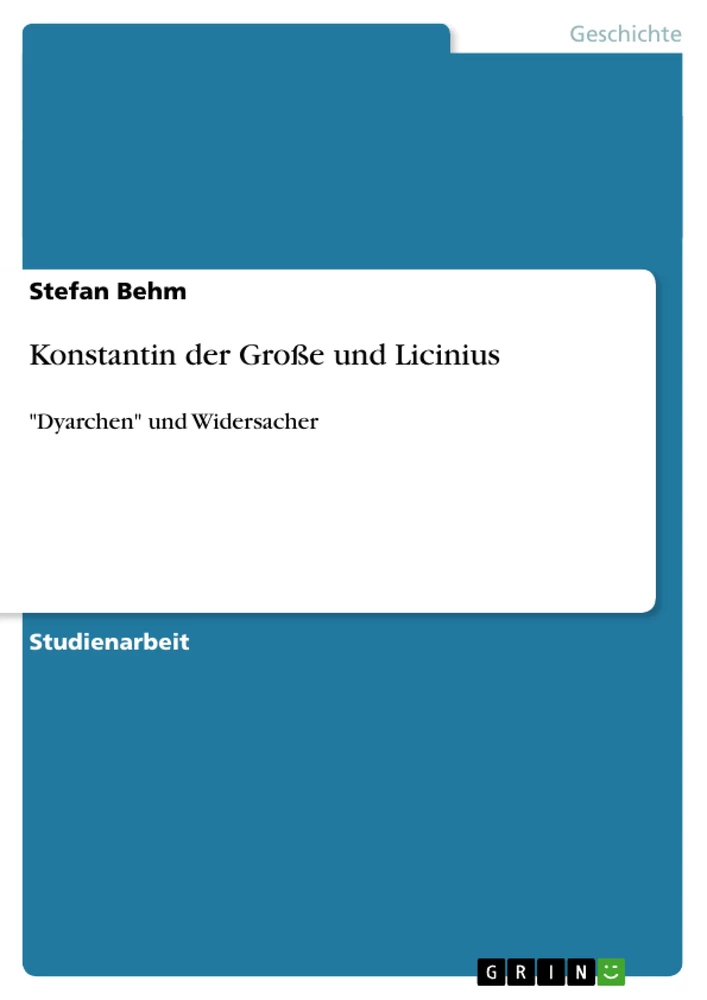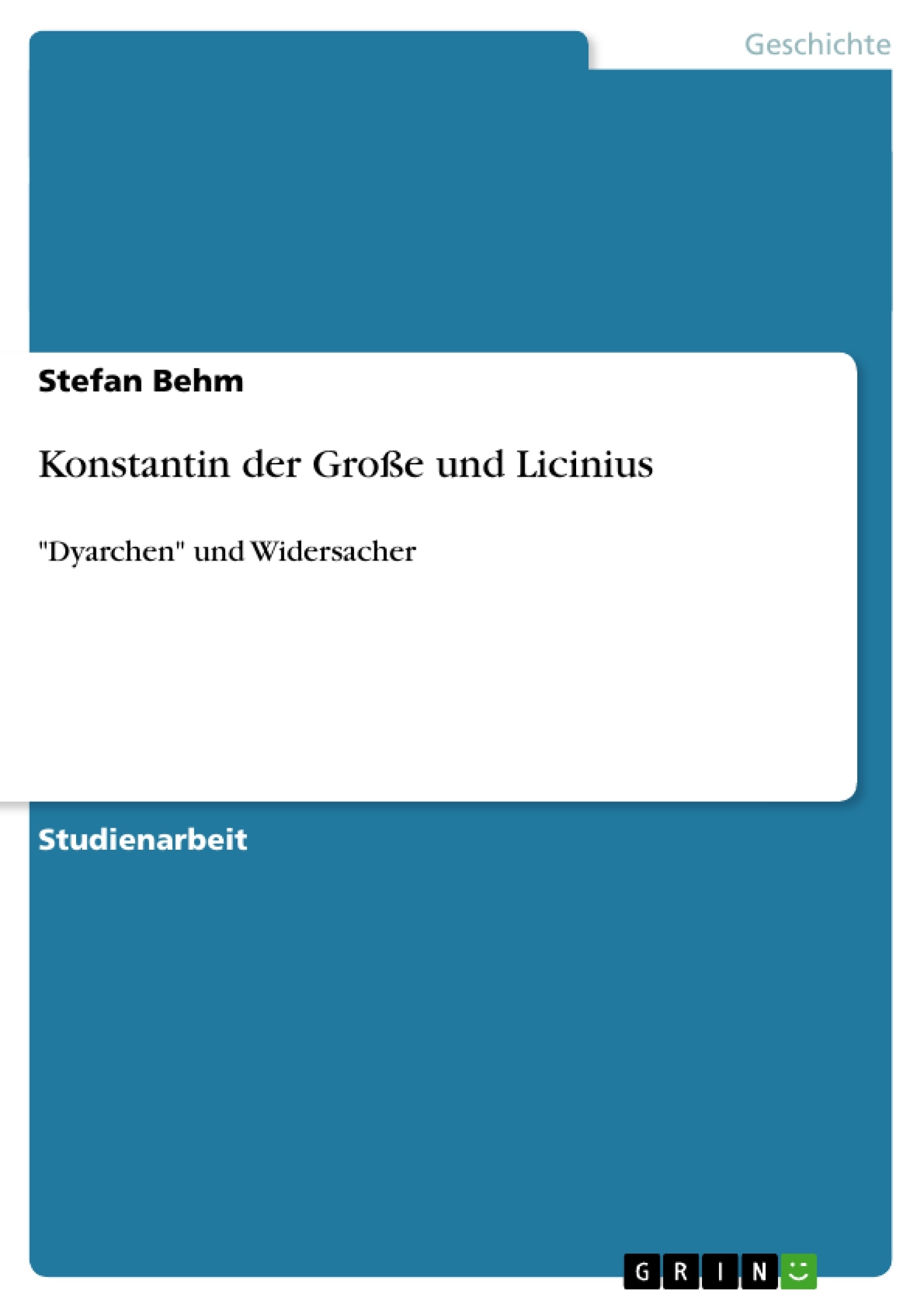Der aus Naissus stammende Konstantin (Constantinus) genoss als Sohn eines Kaisers die übliche Ausbildung eines Soldaten und wurde später selbst als Usurpator zum Soldatenkaiser. Die Tetrarchie war mit der Machtergreifung des Sohnes von Constantius Chlorus stark ins Wanken geraten und musste von Galerius, dem ranghöchsten Augustus, nach dem Tod des Constantius mühsam wiederhergestellt werden. Doch zahlreiche Usurpationsversuche sollten die Tetrarchie aus dem Gleichgewicht bringen und damit ihr Scheitern besiegeln. In der Folgezeit kam es zu innerpolitischen Konflikten, die die Wirtschaft des Reiches lähmten und die Stabilität gefährdeten. Die gegensätzlichen religiösen Entwicklungen im Reich gestalteten sich zu Glaubenskrisen zwischen den verbliebenen Kaisern. Bündnisse wurden geschmiedet und Kriege ausgefochten. Das entscheidende Bündnis zur Wiederherstellung der politischen Ordnung war das des Konstantin mit Licinius, einem weiteren Soldatenkaiser aus Thrakien. In meiner Hausarbeit werde ich dabei besonders auf die Entstehung dieses Bündnisses eingehen und dessen Verlauf untersuchen. Ein Kernpunkt wird dabei die spätere religiöse Disharmonie der beiden Kaiser einnehmen. Wie kam es zum Bruch des Bündnisses und welche Faktoren waren ausschlaggebend? In den späten Quellen wird Konstantin als Held und sein Widersacher Licinius als Verräter am Glauben und als „Monster“ dargestellt. Die frühen Quellen jedoch zeichnen ein ganz anderes Bild. Auch Konstantin der Große war eine mystische Figur, die einerseits als erster christlicher Kaiser gefeiert, andererseits aber als machtgieriger Tyrann beschrieben wird. Wie kommt es zu den unterschiedlichen Beschreibungen? Ich werde an dieser Stelle besonders einen kritischen Blick auf die Quellen von Laktanz, Eusebius von Caesarea und auf die des Zosimus werfen. Letzterer hinterlässt als heidnischer Historiker, einen der wenigen Anhaltspunkte für ein anderes Konstantinbild. Als letzten Punkt werde ich die Konflikte des Konstantin mit Licinius beleuchten, die letztendlich zum Fall des Kaisers im Osten führten und die Alleinherrschaft des ersten christlichen Kaisers besiegeln sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken
- Entstehung und Verlauf der "Dyarchie"
- Die Mailänder Vereinbarung
- Die Rückkehr zum Zweikaisertum
- Die Konflikte zwischen den Kaisern und die Auflösung der “Dyarchie”
- Die machtpolitischen Konflikte
- Der erste Krieg der beiden ehemals Verbündeten
- Der Weg zur Auflösung der “Dyarchie”
- Religionspolitische Konflikte
- Die Erringung der Alleinherrschaft für Konstantin
- Die machtpolitischen Konflikte
- Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entstehung und den Verlauf der „Dyarchie“ zwischen Konstantin dem Großen und Licinius, zwei Soldatenkaiser des späten Römischen Reiches. Ein Schwerpunkt liegt auf den religiösen und politischen Konflikten, die zum Zerbrechen des Bündnisses und zur Alleinherrschaft Konstantins führten. Die Arbeit analysiert unterschiedliche Quellen, um ein differenziertes Bild der beiden Kaiser und ihrer Beziehung zu zeichnen.
- Die Entstehung des Bündnisses zwischen Konstantin und Licinius
- Die politischen Konflikte zwischen Konstantin und Licinius
- Die Rolle der religiösen Differenzen im Zerbrechen der „Dyarchie“
- Die unterschiedlichen Darstellungen Konstantins in den Quellen
- Der Weg Konstantins zur Alleinherrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Gedanken: Die Einleitung stellt Konstantin den Großen und Licinius vor, skizziert den Kontext der spät-römischen Tetrarchie und ihre Instabilität, und kündigt die zentrale Fragestellung an: die Entstehung, den Verlauf und das Zerbrechen des Bündnisses zwischen Konstantin und Licinius, mit besonderem Fokus auf die religiösen Konflikte und die unterschiedlichen Darstellungen der beiden Kaiser in den Quellen. Die Arbeit verspricht eine kritische Auseinandersetzung mit den Quellen von Laktanz, Eusebius von Caesarea und Zosimus.
Entstehung und Verlauf der "Dyarchie": Dieses Kapitel beschreibt die Situation nach dem Tod von Galerius im Jahre 311 und den daraus resultierenden Konflikt zwischen Licinius und Maximinus Daia um die Herrschaft im Osten. Es beleuchtet die strategischen Bündnisse, die geschmiedet wurden, insbesondere die Verbindung zwischen Konstantin und Licinius durch die Verlobung Konstantins Halbschwester Constantia mit Licinius. Das Kapitel beschreibt Konstantins militärische Offensive gegen Maxentius im Jahre 312, die Belagerung von Verona und den entscheidenden Sieg an der Milvischen Brücke. Die Interpretation der Vision Konstantins vor der Schlacht und die Bedeutung des Christogramms XP werden kurz erwähnt, ohne detailliert darauf einzugehen.
Schlüsselwörter
Konstantin der Große, Licinius, Dyarchie, Tetrarchie, Römisches Reich, Religionspolitik, Machtpolitik, militärische Konflikte, Quellenkritik, Laktanz, Eusebius von Caesarea, Zosimus, Milvische Brücke.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Die "Dyarchie" Konstantins und Licinius
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entstehung, den Verlauf und das Zerbrechen der „Dyarchie“ zwischen Konstantin dem Großen und Licinius, zwei Soldatenkaiser des späten Römischen Reiches. Ein besonderer Fokus liegt auf den religiösen und politischen Konflikten, die zum Zerbrechen des Bündnisses und zur Alleinherrschaft Konstantins führten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung des Bündnisses zwischen Konstantin und Licinius, die politischen und religiösen Konflikte zwischen beiden Kaisern, die unterschiedlichen Darstellungen Konstantins in den Quellen und den Weg Konstantins zur Alleinherrschaft. Sie analysiert die Mailänder Vereinbarung und die Rückkehr zum Zweikaisertum, die machtpolitischen Konflikte inklusive des ersten Krieges zwischen den ehemaligen Verbündeten, und die Erringung der Alleinherrschaft durch Konstantin.
Welche Quellen werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert unterschiedliche Quellen, um ein differenziertes Bild der beiden Kaiser und ihrer Beziehung zu zeichnen. Explizit erwähnt werden Laktanz, Eusebius von Caesarea und Zosimus.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Der Hauptteil beschreibt die Entstehung und den Verlauf der Dyarchie, die Konflikte zwischen den Kaisern und die Auflösung der Dyarchie. Die Kapitel werden durch Zusammenfassungen begleitet. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Schlüsselbegriffe sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis der Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Konstantin der Große, Licinius, Dyarchie, Tetrarchie, Römisches Reich, Religionspolitik, Machtpolitik, militärische Konflikte, Quellenkritik, Laktanz, Eusebius von Caesarea, Zosimus, Milvische Brücke.
Welche Rolle spielt die Religion in der Hausarbeit?
Die religiösen Differenzen zwischen Konstantin und Licinius spielen eine zentrale Rolle beim Zerbrechen der „Dyarchie“. Die Hausarbeit untersucht, wie die Religionspolitik die politischen Konflikte beeinflusste und zum Ende des Bündnisses beitrug. Die Interpretation der Vision Konstantins vor der Schlacht an der Milvischen Brücke wird kurz erwähnt.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist es, die Entstehung und den Verlauf der „Dyarchie“ zwischen Konstantin und Licinius zu untersuchen und die Faktoren zu analysieren, die zum Zerbrechen des Bündnisses und zur Alleinherrschaft Konstantins führten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Quellen.
- Arbeit zitieren
- Stefan Behm (Autor:in), 2006, Konstantin der Große und Licinius, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89336