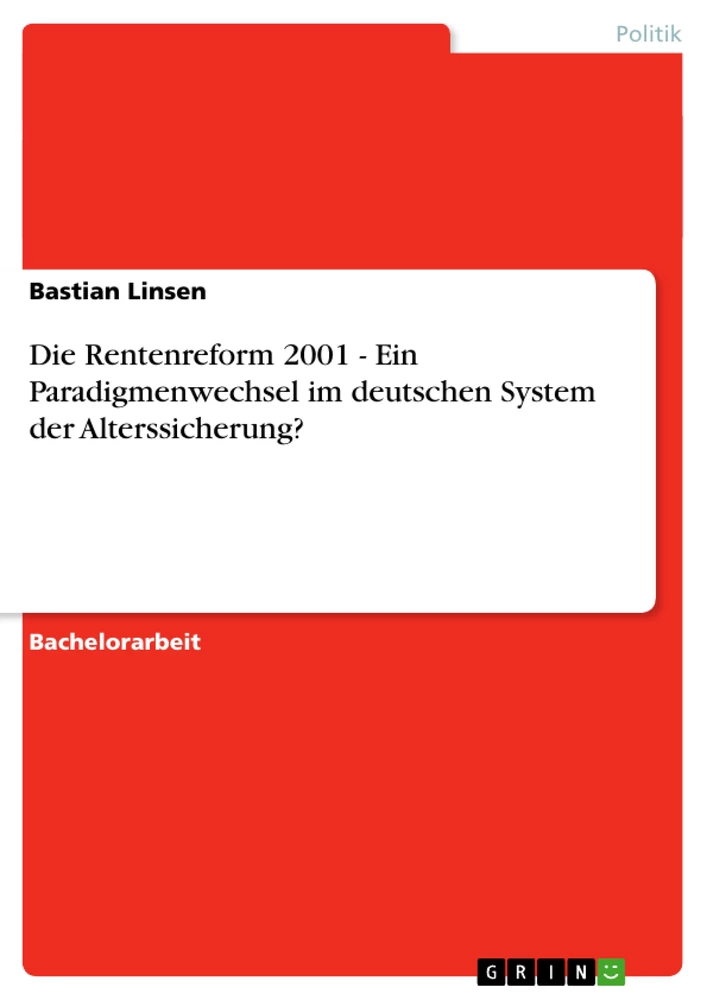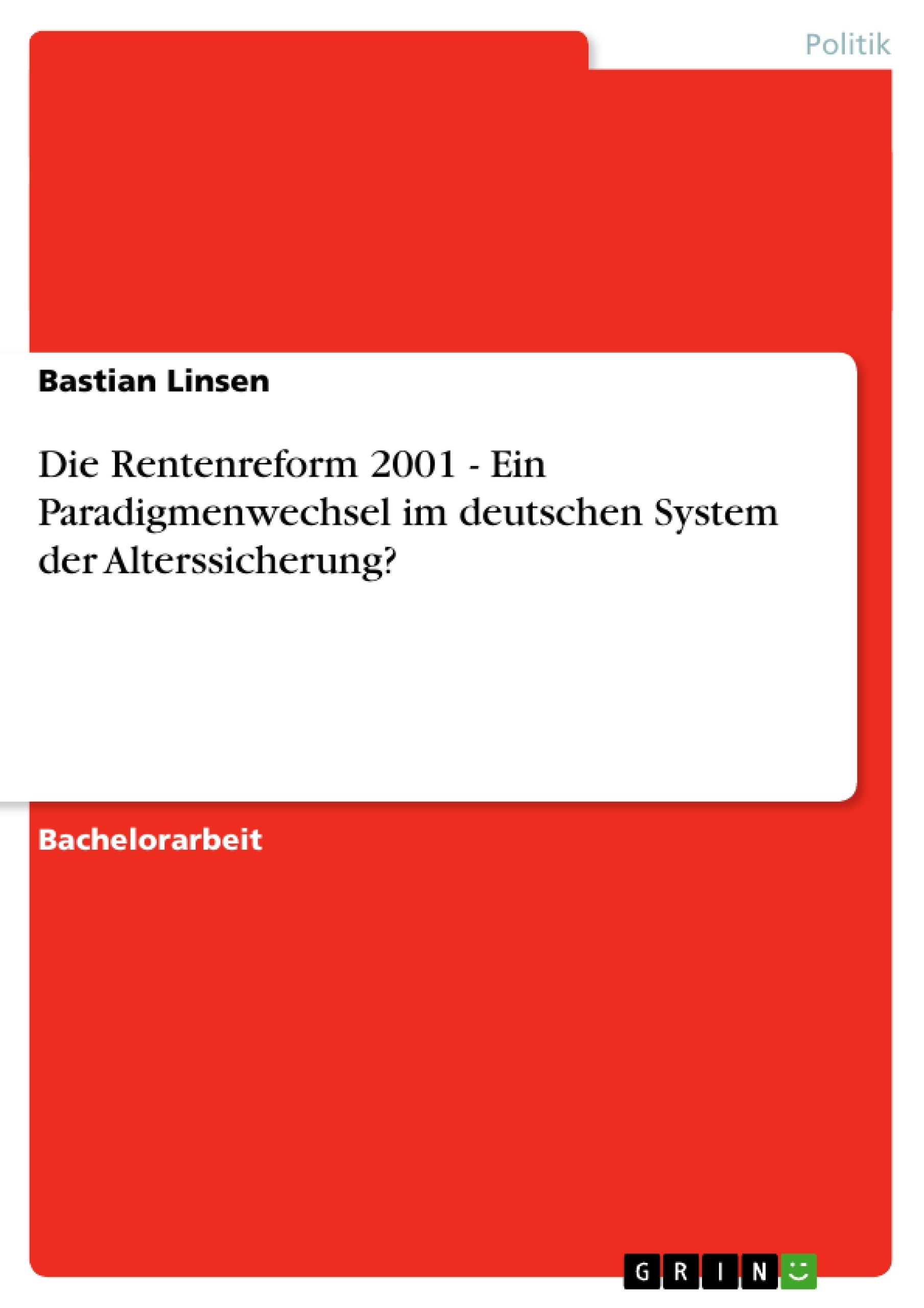„Deswegen ist diese Reform die größte Sozialreform, die in der Nachkriegsgeschichte gemacht wurde“ (Walter Riester in der Frankfurter Rundschau vom 27.01.2000).
„Jeder siebte Deutsche hält „Riester“ für ein Computerprogramm zur Pensionsberechnung“ (Rheinische Post vom 07.11.2006).
Walter Riester, der ehemalige Arbeitsminister in der ersten Regierung Gerhard Schröders, würde die erste Äußerung mit großer Wahrscheinlichkeit auch heute noch so tätigen, über das Ergebnis der Umfrage jedoch zumindest die Stirn runzeln. Und dennoch kann man sich vorstellen, dass die Ambivalenz von „Jahrhundertreform“ auf der einen und „mangelnder Bekanntheit“ auf der anderen Seite eine weit verbreitete Wahrnehmung in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre sechs nach Inkrafttreten eines Rentenreformwerkes ist, dessen Name für alle Ewigkeit mit seinem „politischen Vater“ in Verbindung gebracht werden wird: Die Riester-Rente. Während das Ergebnis der Umfrage eher ein Fall für Regierungsberater und PR-Strategen darstellt, so ist die Frage nach einer „Jahrhundertreform“ durchaus dafür geeignet, einer näheren wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen zu werden.
Die Tatsache, dass Akteure im politischen System zur Anpreisung ihrer Tätigkeiten bzw. zur Diffamierung der Opposition des Öfteren zu einer Hyperbel greifen, kann nicht davon abhalten, zu fragen, warum es die damalige Regierung als unumgänglich ansah, die „größte Sozialreform“ im Nachkriegsdeutschland auf den Weg zu bringen. War das 1889 durch das Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung geschaffene System deutscher Alterssicherung, welches durch die Rentenreform 1957 seinen auf die gesetzliche Rentenversicherung (gRV) fixierten, „öffentlichen, umlagefinanzierten, lohn- und beitragsbezogenen“ (Hinrichs 2000, S. 291) Charakter bekam und zum Sinnbild des bundesrepublikanischen Sozialstaats wurde, Mitte der 90-er Jahre des vorherigen Jahrhunderts am Ende?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Policy-Change 1., 2. oder 3. Ordnung? – Zum theoretischen Analyserahmen des Reformprozesses nach Hall.
- 3. Historische Entwicklung des deutschen Alterssicherungssystems und seiner zentralen Policy Prinzipien bis 1997 - Von Bismarck zu Kohl
- 3.1. Phase 1 - Von der Gründung bis zu Adenauer
- 3.2. Phase 2 Von der Rentenreform 1957 bis Mitte der 70-er Jahre.
- 3.2.1. Die Begründung zentraler Policy Prinzipien in der zweiten Phase
- 3.2.2. Fazit.
- 3.3. Die dritte Phase bis 1997 – Reformen 1. und 2. Ordnung
- 3.4. Zusammenfassung.
- 4. Der Zeitraum von 1997 bis 2001 Ein Paradigmenwechsel in der deutschen Alterssicherungspolitik
- 4.1. Die Reformmaßnahmen der Jahre 1997 bis 1999.
- 4.2. Die Riester - Reform 2001 und Folgegesetze.
- 4.3. Die einzelnen Ebenen des Paradigmenwechsels.
- 4.4. Zusammenfassung....
- 5. Heureka, ein Paradigmenwechsel! - Wie konnte es dazu kommen?
- 5.1 Sieben Faktoren auf dem Weg zum Paradigmenwechsel
- 6. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rentenreform von 2001, die von Walter Riester initiiert wurde, und analysiert, ob sie tatsächlich einen Paradigmenwechsel im deutschen Alterssicherungssystem darstellt. Dabei wird die historische Entwicklung des Systems bis 1997 beleuchtet und die Reform im Kontext der damaligen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet.
- Historische Entwicklung des deutschen Alterssicherungssystems
- Analyse des Reformprozesses nach Hall
- Identifizierung von Faktoren, die zum Paradigmenwechsel führten
- Bewertung der Rentenreform 2001 als "Jahrhundertreform"
- Bewertung der Auswirkungen der Reform auf die deutsche Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung der Rentenreform 2001 als "Jahrhundertreform" in den Vordergrund.
- Kapitel 2: Policy-Change 1., 2. oder 3. Ordnung?: In diesem Kapitel wird der theoretische Analyserahmen des Reformprozesses nach Hall vorgestellt, um die Reform im Kontext der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Strukturen zu betrachten.
- Kapitel 3: Historische Entwicklung des deutschen Alterssicherungssystems: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des deutschen Alterssicherungssystems von seiner Gründung bis 1997. Es wird die Entwicklung der zentralen Policy Prinzipien des Systems und die Bedeutung der verschiedenen Reformschritte betrachtet.
- Kapitel 4: Der Zeitraum von 1997 bis 2001: Dieses Kapitel analysiert die Reformmaßnahmen der Jahre 1997 bis 1999 und konzentriert sich auf die Riester-Reform von 2001. Es werden die einzelnen Ebenen des Paradigmenwechsels im deutschen Alterssicherungssystem untersucht.
- Kapitel 5: Heureka, ein Paradigmenwechsel!: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die zum Paradigmenwechsel führten. Es werden politische, ökonomische und gesellschaftliche Aspekte betrachtet, die die Rentenreform von 2001 beeinflusst haben.
Schlüsselwörter
Rentenreform, Alterssicherung, Deutschland, Paradigmenwechsel, Policy-Change, Riester-Rente, Sozialstaat, Generationenvertrag, Demographischer Wandel, Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, Frühverrentung, Lebenserwartung.
Häufig gestellte Fragen
War die Rentenreform 2001 ein Paradigmenwechsel im deutschen System?
Ja, die Reform markierte den Übergang von einem rein umlagefinanzierten System hin zu einer ergänzenden privaten Vorsorge (Riester-Rente).
Was ist die Riester-Rente?
Es ist eine staatlich geförderte, kapitalgedeckte Altersvorsorge, die nach dem damaligen Arbeitsminister Walter Riester benannt wurde.
Warum sah die Regierung Schröder die Reform als notwendig an?
Hauptgründe waren der demographische Wandel, die steigende Lebenserwartung und die Notwendigkeit, die Lohnnebenkosten stabil zu halten.
Wie hat sich das deutsche Rentensystem historisch seit Bismarck entwickelt?
Das System entwickelte sich von der Invaliditätsversicherung 1889 über die große Reform 1957 (Lohnbezug) bis hin zu den strukturellen Anpassungen um die Jahrtausendwende.
Welche Rolle spielt der demographische Wandel für die Rentenreform?
Eine alternde Gesellschaft bedeutet, dass immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner aufkommen müssen, was das bisherige Umlagesystem unter Druck setzte.
Was versteht man unter einem Policy-Change 3. Ordnung nach Hall?
Es bezeichnet einen radikalen Wandel, bei dem nicht nur Instrumente angepasst werden, sondern die grundlegenden Ziele und das zugrunde liegende Paradigma der Politik wechseln.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Bastian Linsen (Autor:in), 2007, Die Rentenreform 2001 - Ein Paradigmenwechsel im deutschen System der Alterssicherung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89376