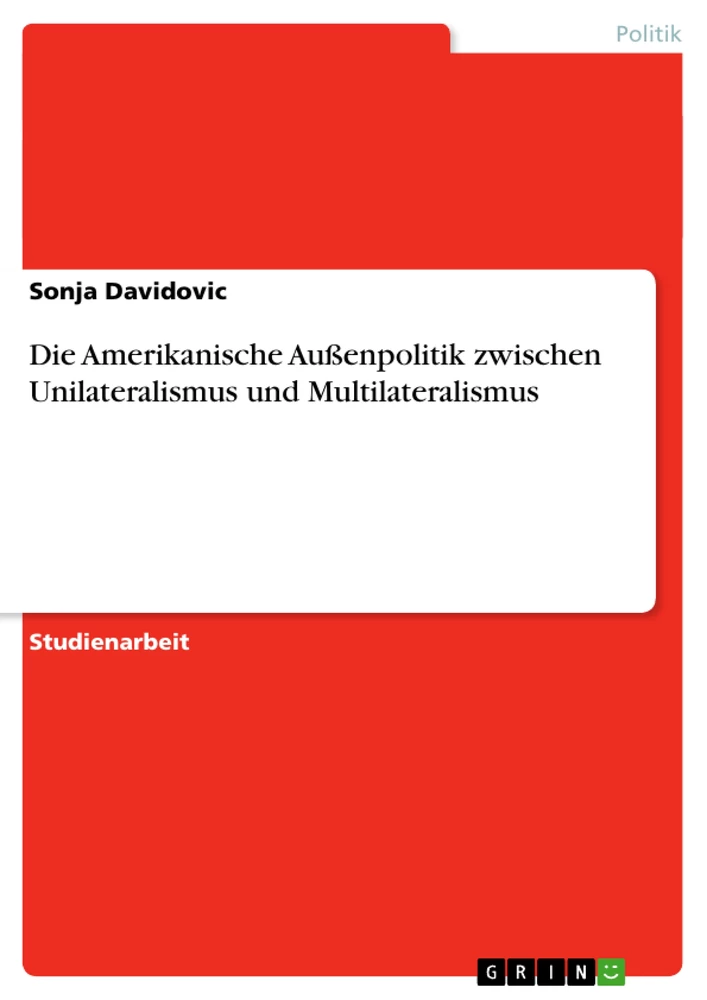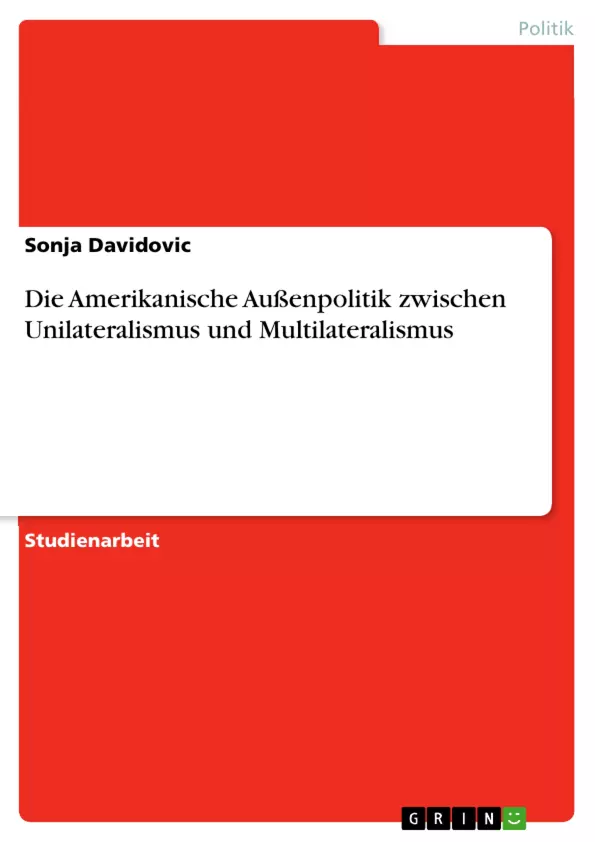[...]
Im Laufe der letzten zehn Jahre haben sich insbesondere zwei miteinander konkurrierende Denkrichtungen durchgesetzt, der Uni- und der Multilateralismus.
Als Akteure auf dem Spielfeld der internationalen Politik haben Nationalstaaten theoretisch immer die Wahl, ob sie sich für ein multilateralistisches oder, falls sich es sich als effizienter und weniger mühselig zu versprechen scheint, ein unilateralistisches Vorgehen zur Verfolgung oder Verteidigung ihrer Interessen entscheiden. Doch die konsequente Umsetzung des uni- oder multilateralistischen Kurses, ist nicht immer so einfach und eindeutig.
[...]
Eben diese Entwürfe und ihre praktische Umsetzung in Rahmen außenpolitischer Bedingungen der 1990er Jahre nehmen in der vorliegenden Untersuchung eine zentrale Stellung ein. Welche Tendenzen weisen die außenpolitischen Handlungen auf? Welche Divergenzen bzw. Parallelen sind bei einer republikanischen und demokratischen Außenpolitik zu konstatieren?
Bevor die inhaltliche Dimension der beiden Ansätze zur Sprache kommt, sollten zunächst die historischen Entwicklungslinien der strategischen Grundorientierung der USA beleuchtet werden. Dies ist insofern bedeutend, als der Uni- und der Multilateralismus nur im Kontext der außenpolitischen Tradition der Vereinigten Staaten zu verstehen sind. Erst dann können die Grundsätze und die Vorstellungen der beiden Ansätze aufgestellt werden. Dabei muss angemerkt werden, daß es unmöglich ist, universell geltende Definitionen zu bestimmen, da die Ansichten der jeweiligen Kontrahenten z.T. einen sehr facettenreichen Charakter aufweisen. Deswegen erscheint es sinnvoll, die jeweiligen Grundstrukturen anhand einiger bestimmter Vertreter herauszuarbeiten. Da der Begriff des Unilateralismus oft mit der Partei der Republikaner assoziiert wird, während der Multilateralismus hingegen mit dem demokratischen Lager in Verbindung gesetzt wird, orientiert sich die Auswahl der Repräsentanten an diesem Schema.
Nachdem die komparative Analyse abgeschlossen und die uni- und multilateralistischen Grundsätze determiniert worden sind, wird deren Verwirklichung in den außenpolitischen Handlungen der Clinton- und Bush-Administration relativ leicht zu prüfen sein.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Zur historischen Entwicklung der Grand Strategies
III. Die theoretische Fundierung
a.) Der Unilateralismus
b.) Der Multilateralismus
IV. Die US-Außenpolitik im Spannungsfeld zwischen Uni- und Multilateralismus
a) Die Clinton-Administration
b.) Die Bush-Administration
Resümee
Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Durch die aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion resultierende Veränderung der globalen Machtstruktur kam den Vereinigten Staaten unweigerlich die Rolle eines „Global Leaders“ zu. Diese neue Position innerhalb der internationalen Gemeinschaft hat amerikanische außenpolitische Theoretiker in den USA vor eine Vielzahl neuer Aufgaben gestellt. Es galt die Positionierung der USA in der modifizierten weltpolitischen Landschaft zu bestimmen und eine geeignete strategische Grundorientierung des außenpolitischen Handelns zu finden.
Im Laufe der letzten zehn Jahre haben sich insbesondere zwei miteinander konkurrierende Denkrichtungen durchgesetzt, der Uni- und der Multilateralismus.
Als Akteure auf dem Spielfeld der internationalen Politik haben Nationalstaaten theoretisch immer die Wahl, ob sie sich für ein multilateralistisches oder, falls sich es sich als effizienter und weniger mühselig zu versprechen scheint, ein unilateralistisches Vorgehen zur Verfolgung oder Verteidigung ihrer Interessen entscheiden. Doch die konsequente Umsetzung des uni- oder multilateralistischen Kurses, ist nicht immer so einfach und eindeutig. Die Führungsposition der Vereinigten Staaten und der sich daraus eröffnende weite, außenpolitische Handlungsspielraum erschweren die Verfolgung einer klaren Linie in der amerikanischen Außenpolitik enorm. Dennoch entwickelten die Vertreter der beiden Denkrichtungen auf der Suche nach einem „blueprint“ für die amerikanische Außenpolitik stichfeste Argumentationslinien zur Bekräftigung ihrer inhaltlichen Konzepte.
Eben diese Entwürfe und ihre praktische Umsetzung in Rahmen außenpolitischer Bedingungen der 1990er Jahre nehmen in der vorliegenden Untersuchung eine zentrale Stellung ein. Welche Tendenzen weisen die außenpolitischen Handlungen auf? Welche Divergenzen bzw. Parallelen sind bei einer republikanischen und demokratischen Außenpolitik zu konstatieren?
Bevor die inhaltliche Dimension der beiden Ansätze zur Sprache kommt, sollten zunächst die historischen Entwicklungslinien der strategischen Grundorientierung der USA beleuchtet werden. Dies ist insofern bedeutend, als der Uni- und der Multilateralismus nur im Kontext der außenpolitischen Tradition der Vereinigten Staaten zu verstehen sind. Erst dann können die Grundsätze und die Vorstellungen der beiden Ansätze aufgestellt werden. Dabei muss angemerkt werden, daß es unmöglich ist, universell geltende Definitionen zu bestimmen, da die Ansichten der jeweiligen Kontrahenten z.T. einen sehr facettenreichen Charakter aufweisen. Deswegen erscheint es sinnvoll, die jeweiligen Grundstrukturen anhand einiger bestimmter Vertreter herauszuarbeiten.[1] Da der Begriff des Unilateralismus oft mit der Partei der Republikaner assoziiert wird, während der Multilateralismus hingegen mit dem demokratischen Lager in Verbindung gesetzt wird, orientiert sich die Auswahl der Repräsentanten an diesem Schema.[2]
Nachdem die komparative Analyse abgeschlossen und die uni- und multilateralistischen Grundsätze determiniert worden sind, wird deren Verwirklichung in den außenpolitischen Handlungen der Clinton- und Bush-Administration relativ leicht zu prüfen sein.
II. Zur historischen Entwicklung der Grand Strategies
In den im Laufe der amerikanischen Geschichte immer wider aufbrechenden Grundsatzdebatten ging es nie nur um die Bestimmung der außenpolitischen Interessen, sondern immer auch um die eigene, nationale Identität.[3] Diese Debatten waren daher untrennbar verwoben mit der amerikanischen politischen Kultur, die den Vereinigten Staaten eine besondere Rolle in der Welt zuweist.
Die Überzeugung der amerikanischen Einzigartigkeit ist tief verwurzelt, wirkte im Inneren, wie nach außen identitätsstiftend und half eine heterogene Gesellschaft zusammenzufügen. Dieses Verständnis über die eigene, bedeutende Rolle in der Welt wird in den Worten von Thomas Paine aus dem Jahre 1776 deutlich: „We have it in power to begin the world all over again“.[4] Der amerikanische Exzeptionalismus war sowohl vereinbar mit der Sicht der USA als leuchtendem Beispiel einer freiheitlich verfaßten Gesellschaft als auch mit der Sicht der USA als eiferndem Veränderer in der Weltpolitik. Das bedeutet, daß er sowohl die Traditionen des Internationalismus wie auch des Isolationismus tragen konnte.[5] Amerikanische Außenpolitik war zwar nie isolationistisch im Sinne weltpolitischer Enthaltsamkeit oder gar des Verzichts auf militärische Interventionen.[6] Doch im Laufe des 19. Jahrhunderts sollte die Unabhängigkeit eines noch schwachen Staates dadurch gesichert werden, indem die Verwicklung in die Konflikte der europäischen Großmächte vermieden wurde. Die Worte Quincy Adams Jones bekräftigen diese isolationistische Grundorientierung der amerikanischen Außenpolitik des 19. Jahrhunderts: “Wherever the standard of freedom and independence has been or shall be unfurled, there will be America’s heart her benediction, and her prayers. But she goes not abroad in search of monsters to destroy. She is the well-wisher to the freedom and independence of all. She is the champion and vindicator only of her own. She will recommend the general cause by the countenance of her voice, and by the benignant sympathy of her example. She well knows that by once enlisting under other banners than her own, were they even banners of foreign independence, she would involve herself beyond the power of extrication, in all the wars of interest and intrigue of individual avarice, envy and ambition, which assume the colors and usurp the standards of freedom…She might become the dictatress of the world. She would no longer be the ruler of her won spirit”.[7]
Diese Tradition prägte sich im Laufe der amerikanischen Geschichte unterschiedlich aus, ihre entscheidenden Facetten bleiben jedoch konstant: die Idee der Bündnisfreiheit, wie sie in George Washingtons Warnung vor den „permanent alliances“ und der Thomas Jeffersons vor den „entangling alliances“[8] zum Ausdruck kam; die Nichtteilnahme an Kriegen anderer Staaten; die Betonung nationaler Souveränität und eines größtmöglichen Maßes an Entscheidungsfreiheit und daraus sich ergebend ein ausgeprägter Unilateralismus. Bei allen Gemeinsamkeiten bestanden hier jedoch Unterschiede zwischen rechten und linken Isolationisten: konservative Isolationisten waren besorgt, eine aktive internationalistische Politik könnte die kapitalistische Ordnung der USA gefährden; liberale Isolationisten dagegen trieb die Furcht, die soziale Reformpolitik könnte untergraben werden. Gleich, ob sie einen ungeregelten Kapitalismus oder einen ausgebauten Sozialstaat im Sinne hatten- Isolationisten setzen auf die Kraft des amerikanischen Vorbilds auf der Welt.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sollte die alte Gleichgewichts- und Machtpolitik überwunden und eine neue Weltordnung demokratischer Staaten geschaffen werden.[9] „Wilsonianism“, die mit dem Namen von Woodrow Wilson untrennbar verbundene liberal-internationalistische Orientierung schuf den ideologischen Rahmen für die Bestimmung der amerikanischen Führungsrolle. Das internationalistisches Gedankengut ist schon früh in der amerikanischen Geschichte zu finden, Benjamin Franklin und Thomas Paine hegten Sympathie für die Gründung einer internationalen Organisation. Doch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann sich in den USA eine internationalistische Bewegung herauszubilden, die eine auf die aktive Gestaltung der internationalen Umwelt zielende Politik propagierte. Die internationalistische Orientierung hatte von ihren Anfängen an zwei Spielarten. Die Differenzen zwischen beiden wurden lediglich in den beiden ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vom Konsens des Kalten Krieges überdeckt. Die Wurzeln der Spaltung in einen konservativen und einen liberalen oder „progressiven“ Internationalismus reichen in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück. Die Vertreter eines progressiven Liberalismus –Liberale, Sozialreformer, Sozialisten, Pazifisten, waren der Überzeugung, daß Amerika durch einen andauernden Krieg in Europas unweigerlich hineingezogen würde und dadurch die Reformpolitik der USA gefährdet wäre. Um dies zu verhindern, sollten die USA eine aktive Rolle als Vermittler und Gestalter eines Friedens in Europa der nicht auf Gleichgewichtspolitik beruhen sollte, sondern auf demokratischer Kontrolle der Außenpolitik, Selbstbestimmung, Freihandel, Abrüstung und einer internationalen Organisation. Die Vertreter des konservativen Internationalismus verurteilten die Neutralitätspolitik und traten für die Gründung einer internationalen Organisation und die amerikanische Beteiligung daran ein. Doch die unilaterale amerikanische Handlungsfähigkeit sollte nicht durch eine solche Organisation eingeschränkt werden. Die politischen und wirtschaftlichen Grundlagen einer Friedensordnung, die im progressiven Internationalismus eine weitaus größere Rolle spielten als die internationale Organisation, waren kein besonderes Anliegen des konservativen Internationalismus. Ihm ging es um die Ordnung zwischen den Staaten, nicht so sehr um die innerstaatliche Ordnung als Voraussetzung einer Friedensordnung.
Die Idee des Völkerbundes war, wenngleich ihre Wurzeln weit in die Geschichte zurückreichen, ein Produkt dieses neuen internationalistischen Denkens, das die amerikanische Außenpolitik mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zunehmend erfaßte: “The question upon which the whole future peace and policy of the world depends is this: Is the present war a just and secure peace, or only for a new balance of power?…There must be, not a balance of power; not organized rivalries, but an organized common peace”.[10]
Zur traditionellen Sorge um die strategische Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit der USA kam noch die Kritik an der in der Satzung des Völkerbundes enthaltenen Beistandsverpflichtung hinzu.[11] Das Recht über Krieg und Frieden zu entscheiden sollte, verfassungskonform, nur dem Kongresses vorbehalten sein. Die USA traten zwar nicht in den Völkerbund ein, zogen sich aber auch nicht aus der Weltpolitik zurück. Die Zwischenkriegsjahre waren keineswegs durch einen totalen weltpolitischen Rückzug der USA geprägt, also keine Zeit des reinen Isolationismus, sondern eines Semi-Internationalismus.[12] Dennoch erlebte der Isolationsmus infolge der Großen Depression in der ersten Hälfte der 1930er einen Höhepunkt. Die drohende Hegemonie Deutschlands und der Angriff auf Pearl Harbor 1941 zerstörten seine Grundlagen endgültig. Amerika konnte sich nicht mehr hinter dem Schutzschild der beiden Ozeane sicher wissen. Der Gegenentwurf zum Isolationismus – der Internationalismus- wurde jetzt endgültig zur dominierenden Muster für die Bestimmung der amerikanischen Rolle in der Welt. Amerikanische Politiker der Nachkriegszeit wurden bewußt, daß eine multilaterale Handelsordnung nicht nur den wirtschaftlichen Interessen der Amerikaner dienen, sondern auch die Bildung geschlossener Machtblöcke verhindern würde, die eine sicherheitspolitische Bedrohung für die USA darstellen könnten. Die Schaffung einer liberal-kapitalistischer Weltordnung demokratischer Staaten, die sich mit einer geopolitischen-strategischen[13] Leitlinie der Verhinderung sowjetischer Hegemonie über Europa verband, entwickelte sich zum Kern der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten.[14] Diese Orientierung sollte in den Jahren des Kalten Krieges keine wesentliche Veränderung erfahren.
Was die außenpolitische Diskussion der 1990er Jahre angeht, so sind drei Kategorien für die Unterscheidung der großen strategischen Orientierungen von Bedeutung.[15] Erstens ist es die Sicht der internationalen Rolle der USA, ob Hegemonie-, Konzert-, oder Gleichgewichtspolitik.[16] Zweitens lassen sich die strategischen Grundorientierungen danach unterscheiden, welche Ordnungsvorstellung leitend ist: die einer auf der institutionalisierten Kooperation demokratischer Rechtsstaaten beruhenden Weltordnung (in der liberalen Tradition internationaler Politik) oder die einer internationaler Ordnung auf der Grundlage eines machtpolitisch garantierten zwischenstaatlichen Friedens (im Sinne der realistischen Tradition). Drittens unterscheiden sich die Grand strategies in ihrer Haltung zum Multilateralismus oder Unilateralismus, also in den Modi des internationalen Engagements.
[...]
[1] Der Unilateralismus wird vertreten durch Condoleezza Rice, Robert B. Zoellick, Charles Krauthammer und John J. Mearsheimer. Die Repräsentanten des multilateralistischen Ansatzes sind: Hugh De Santis, Bowman Cutter, Joan Spero, Laura D’ Andrea Tyson und Richard Haas.
[2] Siehe Conry, Barbara: U.S. “Global Leadership”: a Euphemism for world policeman, Cato Policy Analysis No. 267, February 5, 1997, unter: www.cato.org/pubs/as/pa-267.html
[3] Zur historischen Entwicklung, soweit nicht anders gekennzeichnet, siehe: Rudolf, Peter: New Grand Strategy? Zur Entwicklung des außenpolitischen Diskurses in den USA, in: Medick-Krakau, Monika (Hrsg.): Außenpolitischer Wandel in theoretischer und vergleichender Perspektive: Die USA und die Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden, 1999, S. 69-86.
[4] Rudolf, S. 72
[5] Ebd.
[6] Zur Entwicklung des Isolationismus, siehe Rudolf, S. 74f.
[7] Kissinger, Henry: Does America Need a Foreign Policy: Toward a Diplomacy for the 21st Century, New York, 2001, S. 238
[8] Rudolf, S. 74.
[9] Zur Entwicklung des Internationalismus, siehe: Rudolf, S. 75f.
[10] Woodrow Wilson, in: Kissinger, S. 243.
[11] Rudolf, S. 76.
[12] Ebd.
[13] Der geopolitische Realismus ist ein Ansatz, der die machtpolitische Bedeutung bestimmter geographischer Regionen und insbesondere die daraus resultierenden sicherheitspolitischen Konsequenzen in den Mittelpunkt stellt. Nach Mackinder, einer seiner wichtigsten Vertreter sollte die Macht, die Euroasien kontrollierte die Weltherrschaft erlangen. In Anbetracht der Eroberungspolitik des nationalsozialistischen Deutschlands, wurde diese Einsicht aktualisiert. In: Rudolf, S.76f.
[14] Rudolf, S.77.
[15] Unterscheidung nach Rudolf, S. 79.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert die US-Außenpolitik im Spannungsfeld zwischen Unilateralismus und Multilateralismus.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen sind die historische Entwicklung der Grand Strategies, die theoretische Fundierung des Uni- und Multilateralismus, die US-Außenpolitik im Spannungsfeld dieser beiden Denkrichtungen (insbesondere unter den Clinton- und Bush-Administrationen) und die Rolle der USA als "Global Leader".
Was versteht man unter "Grand Strategies" im Kontext dieses Dokuments?
"Grand Strategies" bezieht sich auf die strategische Grundorientierung der US-Außenpolitik, die die Positionierung der USA in der Welt und die Verfolgung oder Verteidigung ihrer Interessen bestimmt. Die Analyse konzentriert sich auf den Uni- und Multilateralismus als konkurrierende Denkrichtungen.
Was ist der Unterschied zwischen Unilateralismus und Multilateralismus in der US-Außenpolitik?
Unilateralismus beschreibt einen Ansatz, bei dem die USA ihre Interessen ohne oder mit minimaler Beteiligung anderer Staaten verfolgt. Multilateralismus hingegen betont die Zusammenarbeit und Koordination mit anderen Ländern und internationalen Organisationen zur Erreichung gemeinsamer Ziele.
Welche historischen Entwicklungslinien werden bezüglich der Grand Strategies der USA beleuchtet?
Die historische Entwicklungslinien umfassen die amerikanische Tradition der Bündnisfreiheit, die Warnung vor "permanent alliances" und "entangling alliances", die Betonung nationaler Souveränität und Entscheidungsfreiheit sowie die Konzepte des Isolationismus, Semi-Internationalismus und des Wilsonianismus.
Welche Rolle spielt der amerikanische Exzeptionalismus?
Der amerikanische Exzeptionalismus, die Überzeugung der amerikanischen Einzigartigkeit, ist tief verwurzelt und beeinflusst die US-Außenpolitik. Er kann sowohl mit einer isolationistischen als auch mit einer internationalistischen Haltung vereinbar sein.
Welche Administrationen werden im Hinblick auf ihre Außenpolitik untersucht?
Die Außenpolitik der Clinton- und Bush-Administrationen wird untersucht, um Tendenzen, Divergenzen und Parallelen in Bezug auf Uni- und Multilateralismus zu identifizieren.
Wer sind die wichtigsten Vertreter des Uni- und Multilateralismus, die in dem Dokument genannt werden?
Als Vertreter des Unilateralismus werden Condoleezza Rice, Robert B. Zoellick, Charles Krauthammer und John J. Mearsheimer genannt. Die Repräsentanten des Multilateralismus sind Hugh De Santis, Bowman Cutter, Joan Spero, Laura D’ Andrea Tyson und Richard Haas.
Welche drei Kategorien sind für die Unterscheidung der strategischen Orientierungen von Bedeutung?
Die drei Kategorien sind: die Sicht der internationalen Rolle der USA (Hegemonie-, Konzert- oder Gleichgewichtspolitik), die Ordnungsvorstellung (auf institutionalisierter Kooperation demokratischer Rechtsstaaten beruhende Weltordnung vs. machtpolitisch garantierter zwischenstaatlicher Frieden), und die Haltung zum Multilateralismus oder Unilateralismus.
- Quote paper
- Sonja Davidovic (Author), 2005, Die Amerikanische Außenpolitik zwischen Unilateralismus und Multilateralismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89481