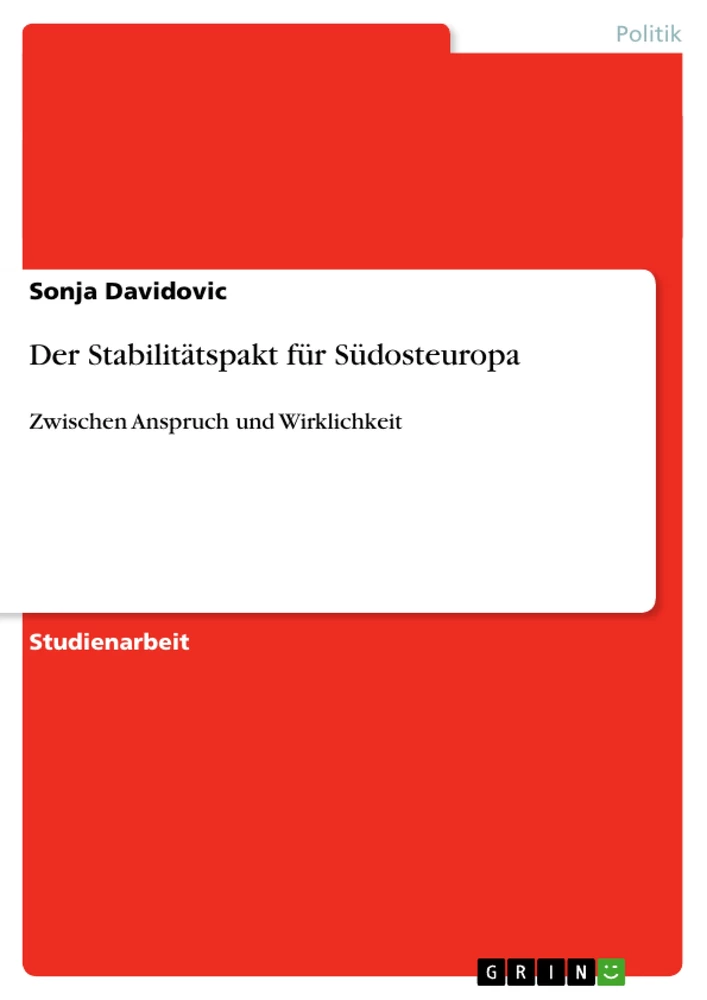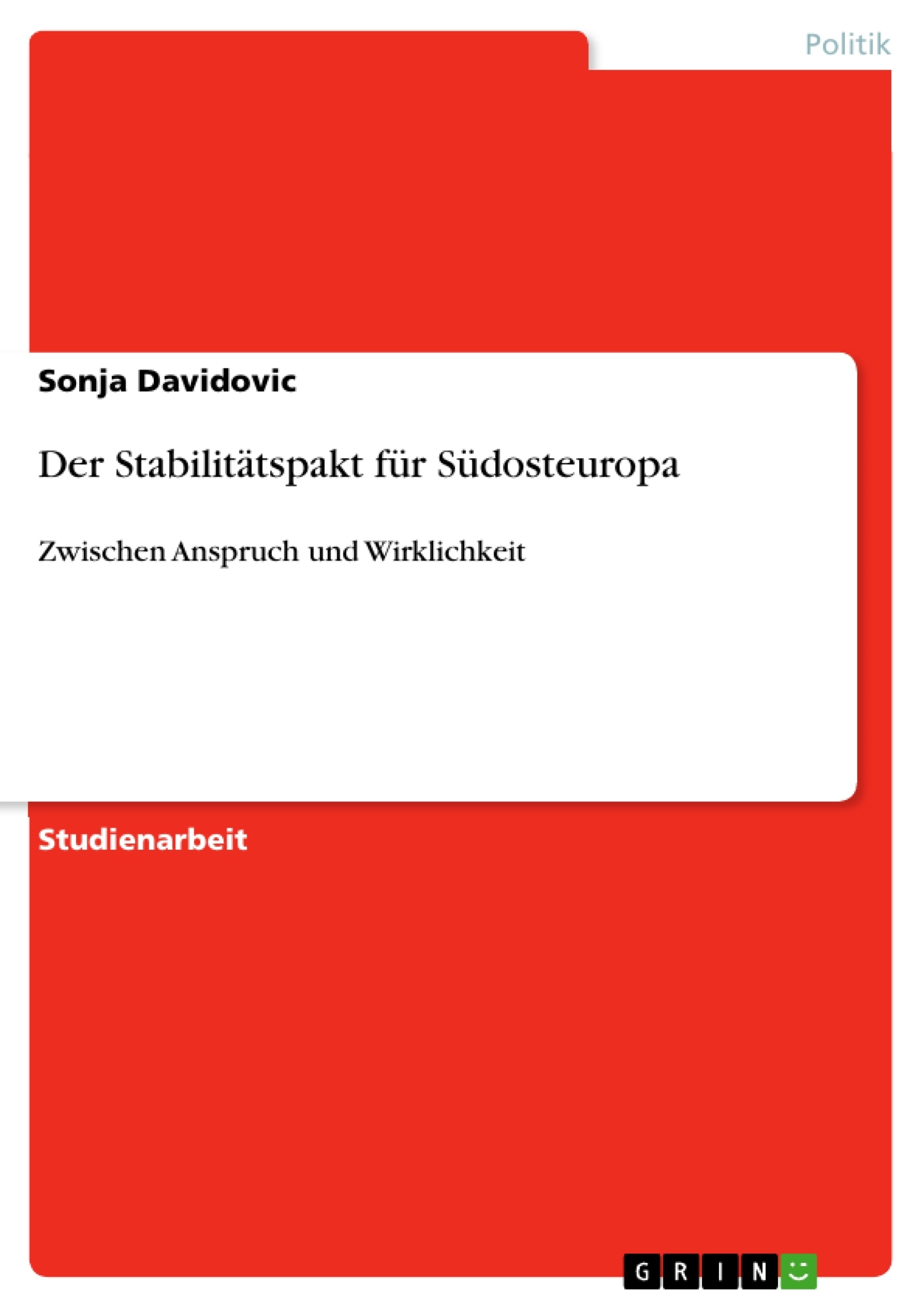Einleitung
[...]
Gegenstand der vorliegenden Arbeit wird es sein, eben dieses „Kapitel der erfolgreichen eu-ropäischen Integration“ zu untersuchen. [...]
Als Erstes gilt es, die Ergründung der theoretischen Aspekte des Stabilitätspaktes zu vollzie-hen, um eine solide Verständnisgrundlage für die weitere Untersuchung zu schaffen. Doch bevor der Pakt als solcher in Augenschein genommen wird, soll vorab die Geschichte der Balkanstrategie der EU kurz angerissen werden, um der Frage nach der Besonderheit des Sta-bilitätspaktes nachzukommen. In einem fließenden Übergang wird dann die Darstellung des politischen Szenarios erfolgen, an welches die Entstehung und Implementierung dieses Pro-jektes unmittelbar geknüpft sind. Eine zentrale Stellung innerhalb dieses Abschnitts wird der im letzten Teilabschnitt behandelten Erörterung der gesetzten Zielvorgaben und der konkrete Vorgehensweise bei ihrer Umsetzung gewährt.
Nachdem die institutionelle Struktur des Paktes klar umrissen wurde, ist es notwendig, direkt im Anschluss auf die praktische Realisierung der gesetzten Ziele zu blicken. Zur Verdeutli-chung der Arbeitsmechanismen des Konzeptes sollte die Aufmerksamkeit zunächst dem Imp-lementierungsprozess und der Aufnahme der Aktivitäten gelten. Weiterhin konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Art und Wirkungsweise der an die jeweiligen Arbeitstische gebunde-nen Projekte. Dadurch sollen vor allem die speziellen Tätigkeitsfelder beleuchtet und die am Pakt beteiligten Parteien sowie ihre jeweilige Rolle aufgezeigt werden, um letztendlich die Einordnung in das Gesamtkonzept zu erschließen.
Schließlich wird im letzten Teil die m.E. aufschlussreichste Frage nach den Erfolgen und Er-gebnissen der Projekte gestellt. Für den Stabilitätspakt als einem auf längere Sicht hin ange-legten Unterfangen ist die Meßlatte des Erfolges natürlich schwierig zu bestimmen. Im Grun-de kann erst nach Jahren, wenn nicht so gar Jahrzehnten von eindeutigen Ergebnissen gespro-chen werden. Dennoch wird es anhand einiger ausgesuchter Beispiele möglich sein erfolgrei-che Initiativen zu benennen und näher darzustellen. Dass die in den Berichten des Sonderko-ordinators des Stabilitätspaktes so hochgelobten Projekte mit einer gewissen Problematik und Schwachstellen behaftet sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Für ein fundiertes Urteil ist es geboten, auch diese Kehrseite genauer zu betrachten. [...]
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
I. Die theoretische Grundlage
a) Die Anfänge der europäischen Balkanpolitik
b) Die politische Ausgangssituation und die Gründung des Stabilitätspaktes
c) Angestrebte Ziele und Strategien
II. Die praktische Umsetzung
a) Der Implementierungsprozess
b) Die konkrete Ausgestaltung der Projekte, ihre Finanzierung und beteiligte Parteien
III. Eine Evaluation
a) Die ersten sichtbaren Erfolgstendenzen
b) Problembereiche, Schwachstellen, Hindernisse
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Einleitung
In der letzten Dekade führten die jugoslawischen Nachfolgekriege nicht nur zur ökonomischen und politischen Desintegration der Teilrepubliken der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien,[1] sondern die gesamte Region Südosteuropas wurde in den Strudel der Krise hineingezogen. Die dadurch verursachte Deflation und der Anstieg der Armutsrate[2] zogen die Schere zwischen den Volkswirtschaften der Balkanländer und denen der Europäischen Union weiter auseinander und drohten die ohnehin schon zerrüttete Region langfristig auf ein historisches Abstellgleis zu steuern.
Mit dem Entwurf eines ganzheitlichen Stabilitätskonzepts gab die Regierung der Bundesrepublik Deutschland einen entscheidenden Impuls zur Befriedung und langfristigen Integration dieses europäischen Krisengebietes. Die Bezeichnung „der zweite Marshall Plan“ fand ihren Eingang in das Vokabular der internationalen Politik und Pressevertretung.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit wird es sein, eben dieses „Kapitel der erfolgreichen europäischen Integration“[3] zu untersuchen. Der Stabilitätspakt für Südosteuropa ist ein äußerst komplexes und umfassendes Projekt, das eine ebenso umfassende Perspektive bei seiner Analyse abverlangt. Offensichtlich muss weit mehr berücksichtigt und einbezogen werden als der bloße Wortlaut des Vertrages oder die Äußerungen und Ankündigungen unterschiedlicher Politiker. Der Problemgegenstand wird daher in drei Bereiche gegliedert betrachtet.
Als Erstes gilt es, die Ergründung der theoretischen Aspekte des Stabilitätspaktes zu vollziehen, um eine solide Verständnisgrundlage für die weitere Untersuchung zu schaffen. Doch bevor der Pakt als solcher in Augenschein genommen wird, soll vorab die Geschichte der Balkanstrategie der EU kurz angerissen werden, um der Frage nach der Besonderheit des Stabilitätspaktes nachzukommen. In einem fließenden Übergang wird dann die Darstellung des politischen Szenarios erfolgen, an welches die Entstehung und Implementierung dieses Projektes unmittelbar geknüpft sind. Eine zentrale Stellung innerhalb dieses Abschnitts wird der im letzten Teilabschnitt behandelten Erörterung der gesetzten Zielvorgaben und der konkrete Vorgehensweise bei ihrer Umsetzung gewährt.
Nachdem die institutionelle Struktur des Paktes klar umrissen wurde, ist es notwendig, direkt im Anschluss auf die praktische Realisierung der gesetzten Ziele zu blicken. Zur Verdeutlichung der Arbeitsmechanismen des Konzeptes sollte die Aufmerksamkeit zunächst dem Implementierungsprozess und der Aufnahme der Aktivitäten gelten. Weiterhin konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Art und Wirkungsweise der an die jeweiligen Arbeitstische gebundenen Projekte. Dadurch sollen vor allem die speziellen Tätigkeitsfelder beleuchtet und die am Pakt beteiligten Parteien sowie ihre jeweilige Rolle aufgezeigt werden, um letztendlich die Einordnung in das Gesamtkonzept zu erschließen.
Schließlich wird im letzten Teil die m.E. aufschlussreichste Frage nach den Erfolgen und Ergebnissen der Projekte gestellt. Für den Stabilitätspakt als einem auf längere Sicht hin angelegten Unterfangen ist die Meßlatte des Erfolges natürlich schwierig zu bestimmen. Im Grunde kann erst nach Jahren, wenn nicht so gar Jahrzehnten von eindeutigen Ergebnissen gesprochen werden. Dennoch wird es anhand einiger ausgesuchter Beispiele möglich sein erfolgreiche Initiativen zu benennen und näher darzustellen. Dass die in den Berichten des Sonderkoordinators des Stabilitätspaktes so hochgelobten Projekte mit einer gewissen Problematik und Schwachstellen behaftet sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Für ein fundiertes Urteil ist es geboten, auch diese Kehrseite genauer zu betrachten. Seit Bestehen des Stabilitätspaktes zeigen sich problematische Aspekte sowohl auf der Empfänger- wie auch auf der Geberseite auf. Immer wieder drohen ernüchternde Vorfälle die fundamentalen Grundsätze der europäischen Balkanpolitik zu erschüttern und stellen somit Stolpersteine auf dem Weg der langfristigen und dauerhaften Integration der gesamten Region dar.
I. Die theoretische Grundlage
a) Die Anfänge der europäischen Balkanpolitik
Die Europäische Union hat lange Zeit hilflos auf das gewaltsame Auseinanderbrechen des früheren Jugoslawien reagiert. Das war nicht zuletzt die Folge erheblicher Differenzen zwischen wichtigen Mitgliedsstaaten über die Lagebeurteilung in der Region und die daraus zu ziehenden politischen Schlussfolgerungen. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) hat bei dieser ersten richtigen Bewährungsprobe nach dem Ende des Kalten Krieges versagt.
Die Vorläufer des Stabilitätspaktes[4] bzw. die erste Phase einer ersten gemeinsamen, regionalen Balkanstrategie beginnt mit der so genannten Royaumont-Initiative 1995.[5] Der hauptsächlich auf französisches und deutsches Betreiben ins Leben gerufene Prozess sollte die Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton in der Weise begleiten, dass er in den Rahmen der Förderung von Stabilität und gutnachbarschaftlicher Beziehungen in der gesamten Region Südosteuropa gestellt wird, insbesondere durch die Förderung von Dialog, Kontakten und Zusammenarbeit auf allen Ebenen der zivilen Gesellschaft. Obwohl auf parlamentarischer Ebene alljährlich Treffen stattfanden und zahlreiche Projekte in den Bereichen der Zivilgesellschaft, Kultur und Menschenrechte vor allem auf Vorschlag der NGOs[6] ins Leben gerufen wurden, kam der Prozess aufgrund seiner dezentralen Organisation und Koordinierungsdefizite insgesamt schleppend voran. Bis zur Berufung des Koordinators fehlte es an Unterstützung von Seiten der westlichen Regierungen, und die Tatsache, dass die Initiative nicht über eigene Finanzmittel verfügte,[7] schränkte die Wirksamkeit ein. Nichtsdestotrotz ist seit 1998, vor allem durch die Einbeziehung der NGOs, Bewegung entstanden. Ein wichtiges Ergebnis ist nach wie vor, dass durch den Prozess eine Art Plattform für eine große Anzahl von Teilnehmern geschaffen wurde. Von besonderer Bedeutung ist, dass Royaumont auch der Bundesrepublik Jugoslawien ein Forum zur regionalen Zusammenarbeit eröffnet hat. Bei dem Treffen der Außenminister der am Stabilitätspakt für Südosteuropa beteiligten Staaten in Köln am 10.Juli 1999 wurde die bedeutende Rolle des Prozesses als regionale Initiative im Rahmen des Paktes erneut hervorgehoben. Vor allem was die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Demokratie und Bürgergesellschaft betrifft, wird dem Royaumont Prozess offiziell eine Schlüsselrolle zugesprochen.[8]
Erst 1996 setzt mit der Verabschiedung des Regionalansatzes ein Wandel ein.[9] Erstmals wird damit der Versuch unternommen, in der EU-Politik dem komplexen Geflecht der regionalen Entwicklung jenseits der bilateralen Ebene gerecht zu werden. Der Regionalansatz[10] wird vom Grundsatz geleitet, dass der Stand der Beziehungen zu den jeweiligen Ländern in der Region vom Stand der Beziehungen dieser Länder zu ihren regionalen Nachbarn abhängig ist. Außerdem hat die EU eine ganze Reihe von politischen und wirtschaftlichen Bedingungen für den Fortschritt bei der demokratischen und marktwirtschaftlichen Transformation formuliert, die ebenfalls Form und Intensität der Beziehungen bestimmen sollen. Auf Basis dieses Konditionalitätsprinzips soll die Eigenverantwortung der betroffenen Länder durch ein System positiver und negativer Anreize gefördert werden, wonach jede Unterstützung an die Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft ist[11]. Zu diesem Zweck wurde eine ganze Reihe von Instrumenten eingesetzt, so z.B. finanzielle Unterstützung im Rahmen der PHARE und OBNOVA[12] Programme, autonome Handelspräferenzen und das Angebot von Kooperationsabkommen mit den Staaten, die nachweislich positiv zur Stabilisierung der Region beigetragen.
Doch der Begriff Regionalansatz ist insofern irreführend, als damit weder ein Konzept für eine den ganzen Balkanraum umfassende Politik gemeint ist, noch ein multilateraler Politikansatz. Das vorherrschende Beziehungsmuster ist vorwiegend bilateral strukturiert. Ferner sind Rumänien, Bulgarien und Slowenien aus diesem Ansatz praktisch ausgeklammert. Bei der EU wird deswegen auch zunehmend vom „Westbalkan“ gesprochen, für den der Regionalansatz konzipiert wurde,. Es handelt sich bei der Region also um den Raum des früheren Jugoslawien ohne Slowenien plus Albanien. Dieses vom Rat der EU 1996 formuliertes Konzept bildet also lediglich einen Rahmen für die Entwicklung der Beziehungen der EU zu den fünf Ländern für welche sie noch nicht zu Verhandlungen über den Abschluss von Assoziationsabkommen[13] bereit war. Außerdem konkurrierte der Regionalansatz mit dem Royaumont-Prozeß und der amerikanischen South East European Cooperation Initiative (SECI),[14] was die Kohärenz und Wirksamkeit der internationalen Präventionsbemühungen nachhaltig schwächte. Schließlich fehlte dem Regionalansatz die Rückendeckung und Aufmerksamkeit, die nötig gewesen wäre, um in dieser spannungsgeladenen Region Konfliktpotentiale tatsächlich substantiell abbauen zu können. Nach Dayton wandten sich die Europäer erleichtert und noch einmal mehr voreilig vom Balkan ab, in der trügerischen Hoffnung, alle Probleme der Region seien geregelt.[15] Es wird also deutlich, dass erst unter dem Eindruck der Folgen des gewaltsamen Zerfalls der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien die EU-Balkanpolitik eine spezielle Kontur annahm. Doch, wie es der deutsche Außenminister Joschka Fischer in seiner Rede zur Gründung des Stabilitätspaktes betonte, verfolgte die europäische Staatengemeinschaft bis dahin eine defizitäre Politik: „Sie behandelte die Folgen anstatt der Ursachen der Konflikte, und sie widmete sich den Problemen der Region isoliert voneinander und getrennt von denen des übrigen Europas.“[16]
b) Die politische Ausgangssituation und die Gründung des Stabilitätspaktes
Die Beendigung des Krieges in Bosnien mit dem Vertrag von Dayton ließ die europäischen Staats- und Regierungschefs glauben, nach einer hoffnungsvollen Wende sei ein Zeitalter des Friedens auf dem Balkan eingetreten. Allzu schnell wurde die Aufmerksamkeit auf andere Krisenzonen gerichtet. Die verbleibenden Krisenherde, wie etwa der anschwellende Kosovo-Konflikt seit dem Aufkommen der UCK 1996 wurden dabei „übersehen“. Selbst nach dem Drenica-Massaker im März 1998 dauerte es noch einen Sommer bis die Europäische Union begriff, dass sie im eskalierenden Konflikt selbst Verantwortung übernehmen muss.[17] Nach Jahren des reaktiven Krisenmanagements und vernachlässigter Initiativen wuchs die Erkenntnis, dass es eines Paradigmenwechsels in der Balkanpolitik bedarf.[18]
Die Idee zur Gründung eines Stabilitätspaktes war der erste ernsthafte Versuch der Staatengemeinschaft, eine langfristig angelegte Politik der Konfliktprävention zu entwickeln.[19] Diese Idee entstand bereits Ende des Jahres 1998, ist also älter als der Kosovo-Krieg. Doch hat der Einsatz der NATO als „Katalysator“ gewirkt,[20] um international den politischen Willen zu einem koordinierten und vorausschauenden Vorgehen in der Region zu stärken.
Das gemeinsame EU-Stabilitätskonzept für den Balkan basiert auf den Lehren aus weltweitem internationalen Krisenmanagement, vor allem in den Handlungsfeldern präventiver Diplomatie und Friedenskonsolidierung.[21] Für seine Entstehung werden exogene wie endogene Faktoren angesetzt.[22] Die tragischen Ereignisse des Kosovo-Krieges wie Menschenrechtsverletzungen, Flüchtlingsströme und die Gefahr der Ausweitung des Konflikts in die benachbarten Länder Mazedonien und Albanien erzeugten enormen Handlungsdruck auf die europäischen Staats- und Regierungschefs, vor allem vor dem Hintergrund der gescheiterten diplomatischen Präventionsbemühungen der EU zur Lösung des Konflikts.[23] Während des militärischen Einsatzes der NATO wuchs dieser Druck noch mehr und die Notwendigkeit einer Gesamtstrategie gewann an Dringlichkeit. Finanziell forderten die Flüchtlingshilfe und die Luftoperation zusätzliche Mittel aus den ohnehin schon strapazierten Haushalten der Mitgliedsländer. Zusätzlich drohten die immer wieder auftretenden „Kolleteralschäden“ nicht nur das Verhältnis zu China zu erschüttern,[24] sondern auch zunehmend die Glaubwürdigkeit und moralische Integrität der westlichen Politik in Frage zu stellen.[25] Die europäischen Staaten gerieten zunehmend in innere und äußere Legitimierungsnot.
Hinsichtlich der endogenen Bedingungen, die für den Entwurf des Stabilitätspaktes verantwortlich sind, sollte daran erinnert werden, dass auf Basis der Vertragsbestimmungen zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik des Amsterdamer Vertrages von 1997, der ab Mai 1999 in Kraft treten sollte, eine Initiative diesem Bereich geplant war. Insgesamt deutete sich in dieser Zeit eine Aufwertung des europäischen Profils in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.[26]
[...]
[1] Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Serbien und Mazedonien.
[2] Siehe dazu den Bericht der Weltbank: „The Road to Stability and Prosperity in Southeastern Europe“ unter: www.seerecon.org/Regionalität...WBRegionalstrategy.htm
[3] So Joschka Fischer in: der Spiegel, #24/1999.
[4] Vorgeschichte und Vorläufer des Stabilitätspaktes für Südosteuropa ausführlich in: Kramer, Heinz / Abali, Oya S.: Stabilisierung des Balkans: Herausforderung für die EU und die internationale Gemeinschaft, Ebenhausen, 2000.
[5] Ausführliche Informationen zum Royaumont Prozess: www.royaumont.org
[6] Alle wichtigen Abkürzungen sind auf einen Blick im Anhang dieser Arbeit zu ersehen.
[7] Zur Finanzierung der Projekte hat der Rat der EU am 9. November 1998 in einem gemeinsamen Standpunkt festgelegt, dass einige Projekte aus den Haushaltsmitteln der GASP finanziert werden. Bis dahin kamen hierfür nur Mittel aus dem PHARE- Programm in Frage.
[8] Punkt 34 des Stabilitätspaktes für Südosteuropa, in: Hollstein, Miriam: Dokumente zum Stabilitätspakt für Südosteuropa, in: Internationale Politik, Dokumentation, 8/1999, S. 127.
[9] Kramer / Abali : Stabilisierung des Balkans, S. 7.
[10] Näheres über den Regionalansatz in: Kramer /Abali: Stabilisierung des Balkans, S. 40-43.
[11] Ehrhart, Hans-Georg: Der Stabilitätspakt oder Frieden durch Integration, in: Lutz, Dieter S.: Der Krieg im Kosovo und das Versagen der Politik, Baden-Baden 2001, S. 916.
[12] Ausführlich über die PHARE- und OBNOVA-Programme unter: www.europa.eu.int/dgla/phare bzw. www.europa.eu.int/dgla/obnova
[13] Zum Assoziationsabkommen siehe Teil I.c dieser Arbeit.
[14] Diese Initiative wird in dieser Arbeit ausgeklammert, ausführliche Informationen sind unter: www.unece.org/seci oder in: Kramer /Abali: Stabilisierung des Balkans, S. 35ff wiederzufinden.
[15] Biermann, Rafael: die europäische Perspektive für den westlichen Balkan: die EU im Zwiespalt, in: Osteuropa, Sonderdruck, 8/2001, S. 924
[16] So Außenminister Fischer in seiner Rede auf der EU-Außenministerkonferenz zum Stabilitätspakt für Südosteuropa, Köln, 10. Juli 1999, in: Hollstein: Dokumente zum Stabilitätspakt für Südosteuropa, S. 131. Dazu insbesondere: Mintchev, Emil: Friedensordnung nach dem Kosovo-Krieg: eine integrative Strategie für den Balkan, in: Internationale Politik, 5/1999, S. 55ff.
[17] Biermann: Die europäische Perspektive für den Balkan, S. 924ff.
[18] Biermann, Rafael: Südosteuropa am Scheidepunkt? Der Stabilitätspakt, das Ende der Milošević-Ära und die aufbrechende „albanische Frage“, unveröffentlichte Ausgabe, 2002, S. 1
[19] Calic, Marie-Janine: der Stabilitätspakt für Südosteuropa: eine erste Bilanz, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 13-14/2001, S. 9.
[20] www.stabilitypact.org/stabilitypactcgi/catalog/cat_descr.cgi?prod_id=1806
[21] Fischer, Joschka: ein Jahr Stabilitätspakt für Südosteuropa – eine erste Bilanz, in: Südosteuropa Mitteilungen, Nr.3, 2000, S. 205ff.
[22] Biermann: Südosteuropa am Scheidepunkt, S. 2ff.
[23] Wie etwa das Scheitern der Milošević-Holbrooke Vereinbarung und der Verhandlungen von Rambouillet. Ausführlich dazu: Loquai, Heinz: Der Kosovo-Konflikt: Wege in einen vermeidbaren Konflikt, Baden-Baden, 2001, S. 76.
[24] Eines der „Kolleteralschäden“ war u.a. auch die chinesische Botschaft in Belgrad.
[25] Vergleiche dazu die völkerrechtliche Diskussionen um die Rechtmäßigkeit einer humanitären Intervention. Im Falle Deutschlands, insbesondere die innerparteiliche Auseinandersetzung innerhalb der Grünen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Stabilitätspakt für Südosteuropa?
Der Stabilitätspakt für Südosteuropa ist ein umfassendes Konzept zur Befriedung und langfristigen Integration der Region Südosteuropa, das von der Bundesrepublik Deutschland initiiert wurde. Er soll die ökonomische und politische Desintegration der Region, die durch die Jugoslawienkriege verursacht wurde, überwinden.
Was waren die Ziele des Stabilitätspaktes?
Die Ziele umfassten die Förderung von Stabilität, gutnachbarschaftlichen Beziehungen, Demokratie, Marktwirtschaft und die Integration der Balkanländer in Europa. Er sollte die Ursachen der Konflikte bekämpfen und die Region nicht isoliert, sondern im Kontext des restlichen Europas betrachten.
Wie wurde der Stabilitätspakt umgesetzt?
Die Umsetzung erfolgte durch die Implementierung verschiedener Projekte, die durch internationale Organisationen und Geberländer finanziert wurden. Der Pakt umfasste verschiedene Arbeitsbereiche und involvierte zahlreiche Parteien.
Was war der Regionalansatz der EU?
Der Regionalansatz der EU war ein Versuch, die komplexen regionalen Entwicklungen auf dem Balkan zu berücksichtigen. Er basierte auf dem Grundsatz, dass die Beziehungen zu den einzelnen Ländern von ihren Beziehungen zu ihren Nachbarn abhängen. Die EU formulierte politische und wirtschaftliche Bedingungen für die Transformation, die an positive und negative Anreize geknüpft waren.
Was war die Royaumont-Initiative?
Die Royaumont-Initiative war ein Vorläufer des Stabilitätspaktes, der 1995 ins Leben gerufen wurde, um die Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton zu begleiten und Stabilität und gutnachbarschaftliche Beziehungen zu fördern. Obwohl sie anfangs langsam vorankam, schuf sie eine Plattform für die regionale Zusammenarbeit und bezog NGOs ein.
Welche Rolle spielte der Kosovo-Krieg bei der Gründung des Stabilitätspaktes?
Der Kosovo-Krieg wirkte als Katalysator für die Gründung des Stabilitätspaktes. Die tragischen Ereignisse des Krieges, wie Menschenrechtsverletzungen und Flüchtlingsströme, erzeugten enormen Handlungsdruck auf die europäischen Staats- und Regierungschefs.
Was waren die Kritikpunkte am Regionalansatz?
Der Begriff Regionalansatz war irreführend, da er weder ein umfassendes Konzept für den gesamten Balkanraum noch einen multilateralen Politikansatz darstellte. Er konkurrierte mit anderen Initiativen und verfügte nicht über die notwendige Rückendeckung, um Konfliktpotentiale substantiell abzubauen.
Welche Faktoren führten zur Gründung des Stabilitätspaktes?
Exogene Faktoren waren die tragischen Ereignisse des Kosovo-Krieges, die den Handlungsdruck auf die europäischen Staats- und Regierungschefs erhöhten. Endogene Faktoren umfassten die Bestimmungen zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik des Amsterdamer Vertrages.
Welche Länder gehörten zum "Westbalkan" im Kontext des Regionalansatzes?
Der "Westbalkan" umfasste das Gebiet des ehemaligen Jugoslawien ohne Slowenien sowie Albanien.
Wie bewertete Joschka Fischer die bisherige EU-Balkanpolitik vor dem Stabilitätspakt?
Joschka Fischer kritisierte, dass die EU-Balkanpolitik defizitär war, weil sie die Folgen anstatt der Ursachen der Konflikte behandelte und die Probleme der Region isoliert von denen des übrigen Europas betrachtete.
- Quote paper
- Sonja Davidovic (Author), 2002, Der Stabilitätspakt für Südosteuropa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89484