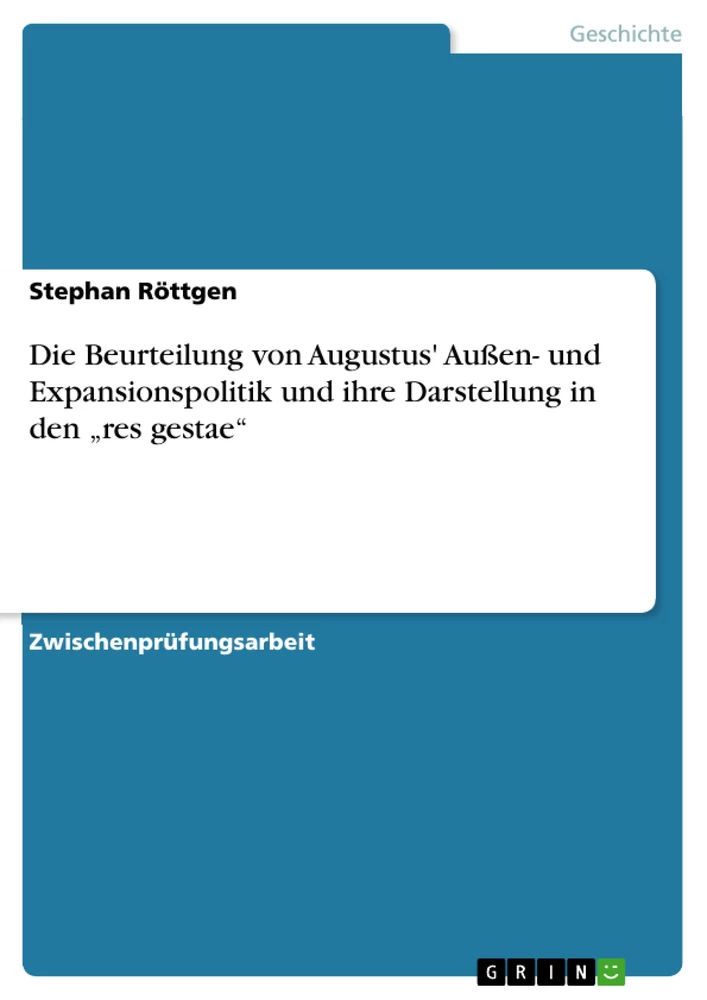In der Geschichtsschreibung wird Augustus als der erste römische Kaiser benannt, obwohl er sich selbst niemals als solcher gesehen hat. Als Oktavian (63 v. Chr.- 14 n. Chr.), dem Sieger des zweiten Bürgerkrieges und Adoptivsohn Caesars, im Jahre 27 v. Chr. der Ehrentitel Augustus verliehen wurde, war zwar die Republik praktisch am Ende, jedoch wurde Rom von da an nicht vom Kaiser Augustus, sondern vom Princeps Augustus regiert. Augustus bekleidete während seiner gesamten politischen Laufbahn lediglich republikanische Ämter und als Konsul war ihm immer, wie es die Verfassung vorsah, ein Amtskollege gleichgestellt. Das Amt der Diktatur wie auch das Konsulat auf Lebenszeit lehnte er ab, da er nicht mit dem Diktator Caesar in Verbindung gebracht werden wollte. Auch die staatliche Allgewalt, die ihm nach dem Bürgerkrieg zugefallen war, gab er vorschriftsmäßig im Jahr 27 v. Chr. an Senat und Volk zurück . Betrachtet man diese Ereignisse, stellt sich die Frage, wie der scheinbar republiktreue Augustus ohne offiziell die staatliche Allgewalt zu besitzen, diese jedoch auszuüben vermochte? Wie war es ihm möglich, seine Alleinherrschaft zu etablieren, ohne in den Ruf eines Diktators zu gelangen?
Anders formuliert, stellt sich hier die Frage nach der Legitimation des augusteischen Herrschaftssystems. Denn wenn er seinen Führungsanspruch nicht auf die ihm angebotenen Ämter zurückführen wollte, worauf dann?
Zur Beantwortung dieser Frage könnte man etliche Bücher über das Ende der römischen Republik heranziehen, in denen detailliert beschrieben wird, wie sich Augustus die republikanischen Institutionen gefügig machte, ohne sie jedoch zu zerstören und so zum Lenker eines Schattenregimes wurde. Da jedoch die Legitimation seiner Herrschaft im Vordergrund dieser Arbeit stehen soll, bietet sich die Selbstdarstellung des Princeps als Grundlage der Untersuchung an; die „res gestae“. Diese wurde nach dem Tod des Augustus auf zwei Bronzeplatten an dessen Mausoleum auf dem Marsfeld angebracht. Der erste Fund dieser Selbstbeschreibung des Augustus wurde jedoch 1555 im Romatempel in Ankara gemacht. Das Werk ist ideal für die Beantwortung der Fragestellung zu gebrauchen, da Augustus in diesem nicht nur sein politisches Wirken für die Nachwelt festhielt, sondern auch indirekt seine Herrschaft legitimieren wollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frage der Legitimation der augusteischen Herrschaft
- Vorstellung der „, res gestae\" zur Untersuchung der Legitimationsfrage
- Ausarbeitung der Fragestellung
- Vorgehen zur Bearbeitung der Fragestellung
- Der Sizilianische Krieg
- Situation nach Caesars Tod
- Gründung des 2. Triumvirats
- Interessenkonflikt zwischen Pompeius und Octavian
- Schilderung des sizilianischen Krieges
- Kampf gegen Pompeius
- Kampf gegen Lepidus
- Situation nach dem sizilianischen Krieg
- Octavian wird Herrscher des Westens
- Vergleich der Ereignisse mit der „res gestae“
- Krieg gegen Seeräuber oder Bürgerkrieg?
- Der Ptolemäische Krieg
- Entstehung des ptolemäischen Krieges
- Situation des Antonius nach dem sizilianischen Krieg
- Propagandafeldzug gegen Antonius
- Der Bruch zwischen Octavian und Antonius
- Verlauf des ptolemäischen Krieges
- Vergleich der Ereignisse mit der „, res gestae“
- Eroberung Ägyptens für Rom oder Bürgerkrieg?
- Verschweigen des Pompeius, Lepidus und Antonius in der „, res geatae“
- Ägypten, Arabien und Äthiopien
- „Kronprovinz“ Ägypten
- Status Ägyptens
- Der Fall Cornelius Gallus
- Der Arabien- und Äthiopienfeldzug
- Darstellung der Arabien- und Äthiopienfeldzüge in der „, res gestae“
- Der Kantabrische Krieg
- Situation nach dem ptolemäischen Krieg
- Machtsicherung des Augustus und „,Wiederherstellung“ der „, res publica“
- Verhältnis zwischen römischen Außen- und Innenpolitik
- Verlauf des kantabrischen Krieges
- Augustus Feldzug
- Agrippas Vorgehen zur Befriedung Spaniens
- Vergleich der Ereignisse mit der „, res gestae“
- Feldherren unter Augustus Oberbefehl
- Das,, imperium\" als Kriegsgrund
- Der Konflikt mit den Parthern
- Die Entstehung des römisch - parthischen Konflikts
- Augustus Gründe für ein Vorgehen gegen die Parther
- Rächung der „, Schmach von Carrhae“
- Roms Selbstverständnis
- Caesars geplanter Partherfeldzug als Vorbild für Augustus
- Sicherung der Ostprovinzen
- Augustus Vorgehen gegen die Parther
- Militärische oder diplomatische Lösung?
- Machtausbau in Galatien, Kappadokien und Pontos
- Streitfall Armenien
- Annexion Armeniens oder Gründung eines Klientelkönigtums?
- Die diplomatische Vereinbarung mit den Parthern und die Darstellung der römischen Ostpolitik in der „, res gestae“
- ,,Kalter Krieg\" in Armenien
- Sieg über die Parther?
- Die Machtsicherung und Eroberung im Westen
- Neuausrichtung der römischen Außenpolitik
- Die Befriedung Galliens und Errichtung der Rheingrenze
- Die Eroberung des Alpen und Donauraums
- Offensive oder defensive Expansion
- Die Germanienfeldzüge
- Die Drususfeldzüge: offensiv oder defensiv?
- Die Elblinie
- Beginnende Provinzbildung in Germanien
- Die Tiberiusfeldzüge: Machtfestigung in Germanien
- Kooperation und Umsiedlungspolitik
- Unruhen und Erneute Eroberung
- Verfall der römischen Herrschaft in Germanien
- Das Markomannenreich
- Der Pannonische Aufstand
- Die Varuskatastrophe
- Die Darstellung der Germanienpolitik in der „,res gestae“
- Germanien oder „Provinz“ Germanien?
- Die Aufgabe Germaniens und Proklamation der Weltherrschaft
- Schluss
- Definition des Prinzipats
- Die,,potestas“
- Die,, auctoritas“
- Unterscheidung zwischen Princeps und Kaiser
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Legitimation der augusteischen Herrschaft und untersucht, wie Augustus seine Alleinherrschaft etablierte, ohne in den Ruf eines Diktators zu gelangen. Die Analyse konzentriert sich auf die Selbstdarstellung des Augustus in den „res gestae“, insbesondere auf die Darstellung seiner Außen- und Expansionspolitik. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des augusteischen Herrschaftssystems und untersucht die Methoden, die Augustus zur Legitimation seiner Herrschaft einsetzte.
- Die Legitimation der augusteischen Herrschaft
- Die Darstellung der Außen- und Expansionspolitik in den „res gestae“
- Die Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit der Ausführungen in den „res gestae“
- Der Vergleich der augusteischen Selbstdarstellung mit dem heutigen Wissensstand
- Die Methoden des Augustus zur Legitimation seiner Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Fragestellung der Arbeit ein und erklärt die Relevanz der „res gestae“ für die Untersuchung der Legitimation der augusteischen Herrschaft. Kapitel 2, 3 und 5 untersuchen die römischen Eroberungen unter Augustus in Sizilien, Ägypten und Spanien. Die Kapitel beleuchten die jeweiligen Konflikte, die Rolle des Augustus in den Kriegen und die Darstellung dieser Ereignisse in den „res gestae“. Kapitel 4 befasst sich mit der Eroberung Ägyptens und der weiteren Ausdehnung des römischen Reiches in Arabien und Äthiopien. Die Darstellung der Arabien- und Äthiopienfeldzüge in den „res gestae“ wird ebenfalls analysiert. Kapitel 6 untersucht den Konflikt mit den Parthern und die Strategien des Augustus im Umgang mit dem Partherreich. Kapitel 7 befasst sich mit der Machtsicherung und Eroberung im Westen, der Befriedung Galliens und der Germanienfeldzüge. Die Darstellung der Germanienpolitik in den „res gestae“ wird kritisch hinterfragt. Das Kapitel „Schluss“ fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und analysiert die Methoden des Augustus zur Legitimation seiner Herrschaft im Spiegel der gesamten „res gestae“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie der Legitimation, der Außen- und Expansionspolitik, der Selbstdarstellung, der römischen Republik und dem Imperium, sowie dem Princeps Augustus und seinen Methoden zur Machtsicherung. Die „res gestae“ als zentrales Quellenmaterial liefert Einblicke in die Strategien des Augustus und die Darstellung seiner politischen Aktivitäten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die „Res Gestae“ des Augustus?
Die „Res Gestae Divi Augusti“ ist ein Tatenbericht, in dem Kaiser Augustus sein politisches Wirken und seine militärischen Erfolge für die Nachwelt festhielt und seine Herrschaft legitimierte.
Wie legitimierte Augustus seine Alleinherrschaft?
Augustus vermied den Titel eines Diktators und behauptete, die Republik wiederhergestellt zu haben. Er stützte seine Macht auf seine „Auctoritas“ (Ansehen) und die Übernahme republikanischer Ämter.
Welche Ziele verfolgte Augustus in seiner Außenpolitik?
Augustus verfolgte eine Mischung aus defensiver Grenzsicherung und offensiver Expansion, um das Römische Reich zu stabilisieren und seine Macht durch militärische Siege zu festigen.
Wie wird der Konflikt mit den Parthern in den Res Gestae dargestellt?
Augustus stellte die diplomatische Rückgabe der römischen Feldzeichen durch die Parther als einen großen militärischen und prestigeträchtigen Sieg dar.
Was war die Bedeutung der Germanienfeldzüge?
Die Feldzüge dienten der Erweiterung des Reiches bis zur Elbe, endeten jedoch nach der Varuskatastrophe mit einem Rückzug auf die Rheingrenze, was in den Res Gestae beschönigt wird.
- Arbeit zitieren
- Stephan Röttgen (Autor:in), 2004, Die Beurteilung von Augustus' Außen- und Expansionspolitik und ihre Darstellung in den „res gestae“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89517