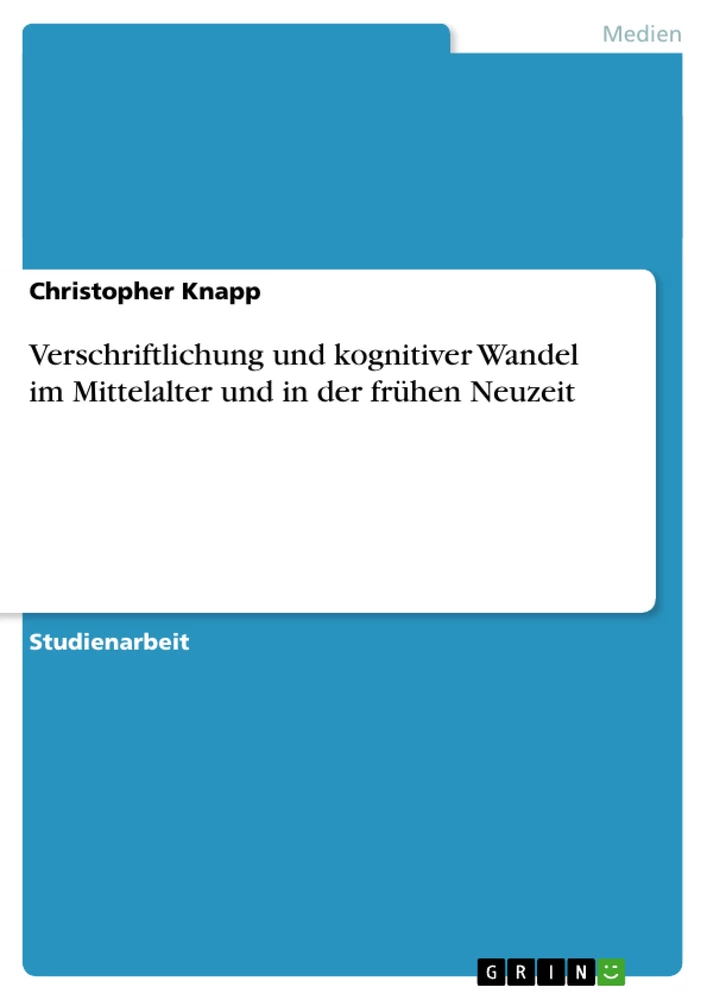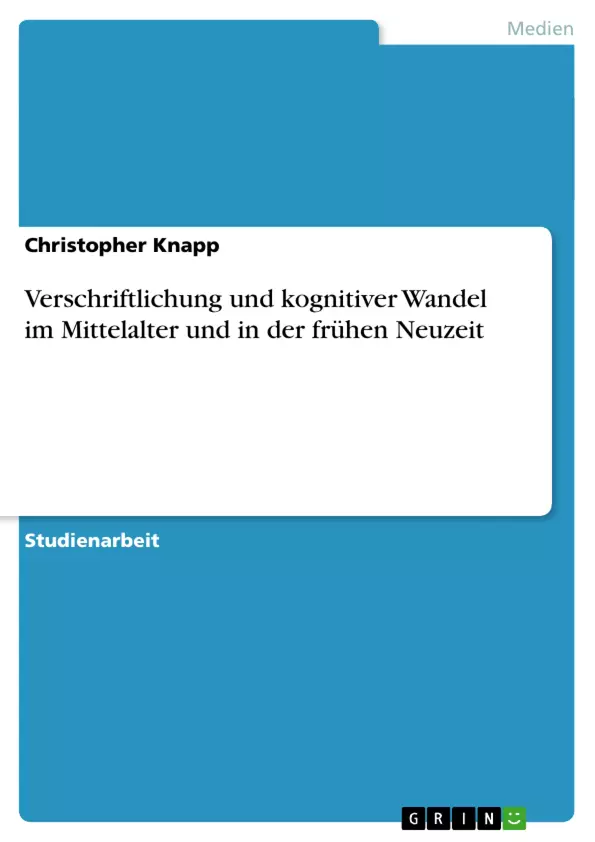In dieser Arbeit wird die Bedeutung der mit dem Druck verbundenen zunehmenden Verschriftlichung als historische Wurzel der Entwicklung zur Moderne genauer untersucht. Angeregt durch die Thesen Mc Luhans, der den Entwicklungen der Medien eher die mit ihnen verbundenen kognitiven Wirkungen auf individueller Ebene als die gesamtgesellschaftlichen Wirkungen gegenüberstellt, werden dabei weniger die von anderen historischen Kausalitäten schwerer zu trennenden gesellschaftlichen Wirkungen als vielmehr die möglichen Änderungen am Einzelnen untersucht. Nach einer kurzen einleitenden Reflexion über die Grundbegriffe sollen dazu im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die Entwicklung der Schriftmedien vermuteten oder vermutbaren kognitiven Folgen gegenübergestellt werden; vor jedem der beiden Abschnitte soll der historische Kontext kurz umrissen werden. Als eine der gesellschaftlich prägenden technischen Entwicklungen in der Geschichte der abendländischen Kultur wird häufig der mit dem Namen Gutenberg verbundene Buchdruck betrachtet. Auch in wissenschaftlichen Betrachtungen (z.B. Hirner 1997) wird häufig von der „Erfindung des Buchdrucks“ und einer damit verbundenen „Revolution“ gesprochen und damit ganze Epochen charakterisiert, wie etwa in der Medientheorie von Marshall McLuhan, der die frühe Neuzeit bis zum Ende des 20. Jahrhunderts als Zeitalter des Buchdrucks, die „Gutenberg Galaxy“, betrachtet (McLuhan 1962). Ausgelöst durch die in der Vorlesung „Postmoderne, Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft“ mit der Moderne assoziierten Schlagwörtern wie „Zweckrationalisierung“ und „Entzauberung“, möchte ich in dieser Arbeit die Bedeutung der mit dem Druck verbundenen zunehmenden Verschriftlichung als historische Wurzel der Entwicklung zur Moderne genauer untersuchen. Angeregt durch die Thesen Mc Luhans, der den Entwicklungen der Medien eher die mit ihnen verbundenen kognitiven Wirkungen auf individueller Ebene als die gesamtgesellschaftlichen Wirkungen gegenüberstellt, sollen dabei weniger die von anderen historischen Kausalitäten schwerer zu trennenden gesellschaftlichen Wirkungen als vielmehr die möglichen Änderungen am Einzelnen untersucht werden. Nach einer kurzen einleitenden Reflexion über die Grundbegriffe sollen dazu im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die Entwicklung der Schriftmedien vermuteten oder vermutbaren kognitiven Folgen gegenübergestellt werden; vor jedem der beiden Abschnitte soll der historische Kontext kurz umrissen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Vorüberlegungen
- Medien und Verschriftlichung
- Kognition und Kognitiver Wandel
- Untersuchung: Verschriftlichung und kognitiver Wandel
- Verschriftlichung und Kognitiver Wandel im Mittelalter
- Vorbemerkungen und Kontext
- Verschriftlichung, Medien und Medienwandel im Mittelalter
- Kognitiver Wandel im Mittelalter
- Verschriftlichung und kognitiver Wandel in der frühen Neuzeit
- Vorbemerkungen
- Medien und Medienwandel in der frühen Neuzeit
- Kognitiver Wandel in der frühen Neuzeit
- Verschriftlichung und Kognitiver Wandel im Mittelalter
- Nachwort und Resümee
- Verwendete Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Bedeutung der zunehmenden Verschriftlichung, die mit dem Buchdruck einherging, als historische Wurzel der Entwicklung zur Moderne. Im Fokus steht dabei nicht die gesellschaftliche Wirkung der Verschriftlichung, sondern die möglichen Auswirkungen auf den Einzelnen, insbesondere im Kontext des kognitiven Wandels. Die Untersuchung untersucht, inwiefern die Entwicklung von Schriftmedien im Mittelalter und der frühen Neuzeit zu Veränderungen in den kognitiven Fähigkeiten des Individuums geführt haben könnten.
- Die Rolle des Buchdrucks in der Entwicklung zur Moderne
- Die Auswirkungen der Verschriftlichung auf den kognitiven Wandel
- Der Einfluss von Medien auf die individuelle Denkweise
- Die Entwicklung von Schriftmedien im Mittelalter und der frühen Neuzeit
- Die Relevanz des historischen Kontextes für den kognitiven Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Buchdrucks als einer gesellschaftlich prägenden technischen Entwicklung und setzt die Arbeit im Kontext der „Gutenberg Galaxy“ und der „Entzauberung“ der Moderne. Die theoretischen Vorüberlegungen definieren die zentralen Begriffe „Medien“ und „Verschriftlichung“ und legen den Fokus auf die individuelle Ebene des kognitiven Wandels.
Der erste Abschnitt der Untersuchung analysiert den kognitiven Wandel im europäischen Mittelalter, wobei die Quellensituation, die demographische Entwicklung und die relevanten Medien in ihrer Entwicklung betrachtet werden. Im Mittelpunkt steht die Analyse der kognitiven Auswirkungen von Verschriftlichung und Medienwandel.
Der zweite Abschnitt widmet sich dem kognitiven Wandel in der frühen Neuzeit. Analog zum ersten Abschnitt werden die relevanten Medien und ihre Entwicklung beleuchtet, um ihre potenziellen kognitiven Auswirkungen auf das Individuum zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Verschriftlichung, kognitiver Wandel, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Medien, Medienwandel, Buchdruck, Gutenberg Galaxy, Entzauberung der Moderne, individuelle Ebene, gesellschaftliche Wirkung.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte der Buchdruck auf die Entwicklung zur Moderne?
Der Buchdruck gilt als historische Wurzel der Moderne, da er die massenhafte Verbreitung von Wissen ermöglichte und kognitive Veränderungen beim Individuum auslöste.
Was versteht Marshall McLuhan unter der „Gutenberg Galaxy“?
McLuhan bezeichnet damit das Zeitalter des Buchdrucks, in dem die Dominanz der Schriftmedien die individuelle Denkweise und die gesellschaftliche Organisation grundlegend veränderte.
Wie veränderte die Verschriftlichung die kognitiven Fähigkeiten des Einzelnen?
Die Arbeit untersucht Thesen, nach denen der Übergang von der Oralität zur Literalität die Abstraktionsfähigkeit, die Zweckrationalisierung und die individuelle Reflexion förderte.
Welche Rolle spielte die Verschriftlichung im Mittelalter?
Obwohl das Mittelalter stark oral geprägt war, legte die beginnende Verschriftlichung in Klöstern und Verwaltungen den Grundstein für spätere kognitive Umbrüche.
Was ist mit der „Entzauberung der Welt“ im Kontext der Moderne gemeint?
Der Begriff beschreibt den Prozess, in dem mystische oder religiöse Weltbilder durch rationale, wissenschaftliche und schriftlich fixierte Erklärungsmodelle ersetzt werden.
Warum fokussiert die Arbeit auf die individuelle statt auf die gesellschaftliche Ebene?
Angeregt durch McLuhan möchte die Arbeit klären, wie Medien direkt auf die Denkstrukturen des Einzelnen wirken, statt nur die schwer trennbaren gesellschaftlichen Folgen zu betrachten.
- Quote paper
- M.A. Christopher Knapp (Author), 2002, Verschriftlichung und kognitiver Wandel im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89797