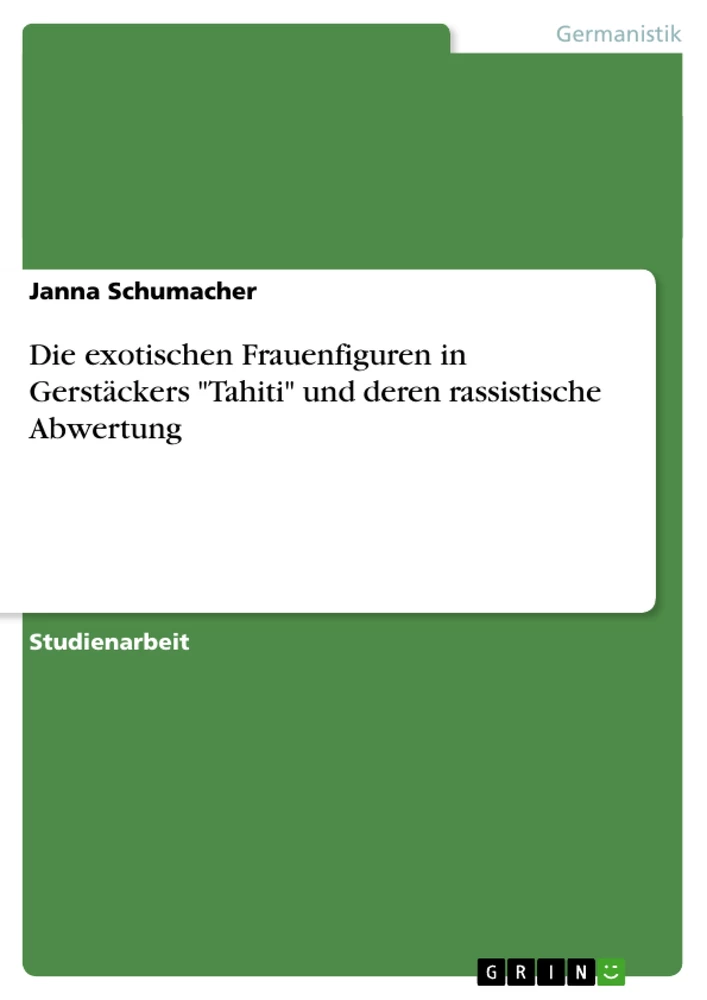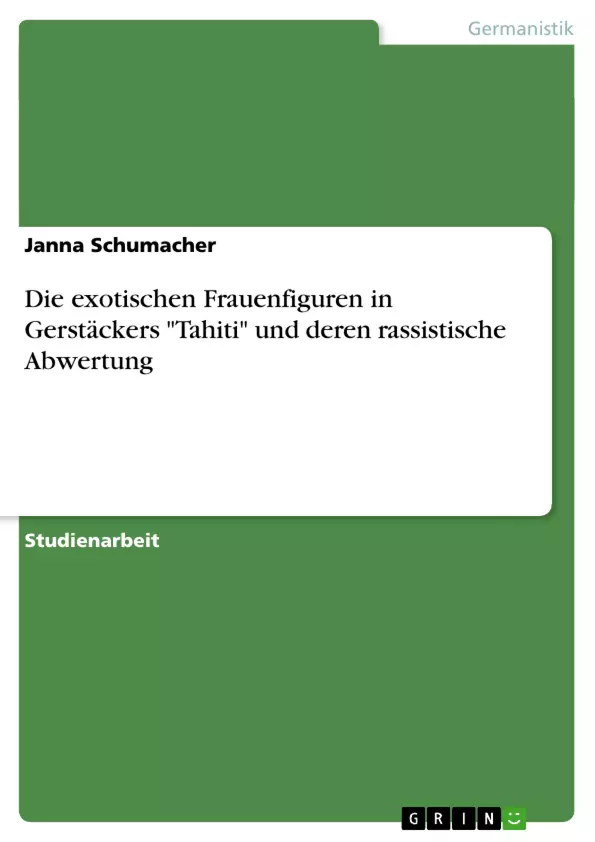Der Roman Gerstäckers reiht sich ein in eine lange europäische Tradition von Südseedarstellungen. Deshalb sollen zunächst in dem ersten Kapitel die Ursprünge der Südseedarstellungen anhand der Reiseberichte Louis Antoine de Bougainvilles und Georg Forsters dargestellt werden. Gerstäckers Tahiti lässt sich zwischen den Schreibstilen ethnographischer Realismus und Südsee-Utopie einordnen. Utopische Südseedarstellungen zeigen bestimmte Strukturen und Funktionen, die eine Schnittstelle von Exotismus, Rassismus und Sexismus bilden. Dies soll außerdem im ersten Kapitel der Arbeit theoretisch analysiert werden. Aus diesen Überlegungen ergeben sich bestimmte Fragen, unter denen der Roman im Folgenden untersucht werden soll. Zunächst soll im zweiten Kapitel an einzelnen Figuren rassistischer Abwertung vor allem der Zusammenhang von Exotismus und Rassismus analysiert werden, dann werden im dritten Kapitel der Hausarbeit die drei zentralen Frauenfiguren des Romans hinsichtlich der besonderen Stellung von Frauen im Rahmen von Kolonialisierung und der Darstellung von Kulturkontakt erläutert.
In dem Südseeroman Tahiti (1854) verliebt sich der Franzose René in die Insulanerin Sadie. Sie heiraten und führen ein abgeschiedenes Familienleben auf der Insel Atiu. Doch dann siedeln sie nach Tahiti über, wo das Paar mit der dortigen europäischen Gesellschaft in Berührung kommt. René verliebt sich in die Amerikanerin Susanne und verlässt Tahiti.
In einem zweiten Erzählstrang werden die politischen Verhältnisse auf Tahiti geschildert. Dort streiten sich die Engländer, vertreten auf der Insel durch protestantische Missionare, mit den katholischen Franzosen um die politische und religiöse Vorherrschaft. Die Engländer ziehen sich letztendlich zurück, die protestantische Königin Pomare flieht. Der folgende Aufstand der Insulaner wird von den Franzosen blutig niedergeschlagen. René kehrt elf Jahre später nach Tahiti zurück. Seine Frau Sadie ist tot, nur noch seine Tochter lebt auf Atiu. René, von Schulgefühlen und enttäuschten Hoffnungen getrieben, verschwindet mit einem Kanu in der Nacht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ethnographischer Realismus und Südsee-Utopie
- Literarische Südseebilder
- Einordnung des Romans Tahiti
- Exotismus und Rassismus
- Die doppelte Kolonialisierung der Frau
- Zwischenergebnis und Fragestellung
- Figuren rassistischer Abwertung in Tahiti
- Die Insulaner als unschuldige Kinder
- Die Frauen als exotisch, sinnliche und (un)moralische Wesen
- Die Insulaner als Müßiggänger und rein sinnliche, geistlose Wesen
- Die Frauenfiguren Sadie, Aumama und Pomare
- Sadie
- Aumama
- Pomare
- Abschließende Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Gerstäckers Roman „Tahiti“ (1854) und untersucht die rassistische Abwertung von Frauenfiguren im Kontext der europäischen Südseedarstellungen. Die Arbeit befasst sich mit den literarischen Traditionen und Klischees der Südsee-Utopie und beleuchtet die Darstellung von Exotismus und Rassismus im Roman.
- Analyse der Darstellung von Südsee-Utopien und deren Verbindung mit Exotismus und Rassismus
- Untersuchung der Figuren des Romans in Bezug auf ihre rassistische Abwertung
- Erläuterung der Rolle von Frauenfiguren im Kontext der Kolonialisierung und des Kulturkontakts
- Behandlung des Zusammenspiels von ethnographischem Realismus und Südsee-Utopie in Gerstäckers Roman
- Analyse der Doppelten Kolonialisierung der Frau im Kontext der europäischen Südseedarstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Südseedarstellungen im 19. Jahrhundert vor und ordnet Gerstäckers Roman „Tahiti“ in diese Tradition ein. Sie behandelt die Entstehung des Südseemythos anhand von Reiseberichten und beschreibt die Verwendung von Klischees und Motiven im Roman.
- Ethnographischer Realismus und Südsee-Utopie: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des literarischen Bildes von Tahiti durch Reiseberichte von Bougainville und Forster. Es analysiert die Entstehung des Exotismus und seine Verknüpfung mit rassistischen Stereotypen.
- Figuren rassistischer Abwertung in Tahiti: Dieses Kapitel befasst sich mit den Insulaner- und Frauenfiguren im Roman und untersucht, wie Gerstäcker diese Figuren anhand rassistischer Stereotype darstellt.
- Die Frauenfiguren Sadie, Aumama und Pomare: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung von Frauenfiguren im Roman. Es beleuchtet die spezifische Rolle von Frauen im Kontext der Kolonialisierung und des Kulturkontakts.
Schlüsselwörter
Südseedarstellungen, Exotismus, Rassismus, Kolonialisierung, Kulturkontakt, Frauenfiguren, Tahiti, Gerstäcker, Ethnographischer Realismus, Südsee-Utopie, Klischees, Motive.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Friedrich Gerstäckers Roman "Tahiti"?
Der Roman von 1854 schildert die Liebesgeschichte zwischen dem Franzosen René und der Insulanerin Sadie sowie die politischen Kämpfe zwischen Engländern und Franzosen auf Tahiti.
Wie werden Frauenfiguren in dem Roman rassistisch abgewertet?
Frauen werden oft als rein sinnliche, exotische und moralisch ambivalente Wesen dargestellt, was sie im Kontext der Kolonialisierung doppelt abwertet.
Was ist der Unterschied zwischen ethnographischem Realismus und Südsee-Utopie?
Die Arbeit zeigt auf, dass Gerstäcker zwar reale Beobachtungen nutzt (Realismus), diese aber mit utopischen Klischees vermischt, die oft rassistische Stereotype bedienen.
Welche zentralen Frauenfiguren werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Figuren Sadie, Aumama und die historische Königin Pomare.
Was ist das Konzept der "doppelten Kolonialisierung" der Frau?
Damit ist gemeint, dass Frauen in Kolonialgebieten sowohl durch die fremde Macht als auch durch patriarchale Strukturen innerhalb der exotisierten Darstellung unterdrückt werden.
- Quote paper
- Janna Schumacher (Author), 2007, Die exotischen Frauenfiguren in Gerstäckers "Tahiti" und deren rassistische Abwertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89810