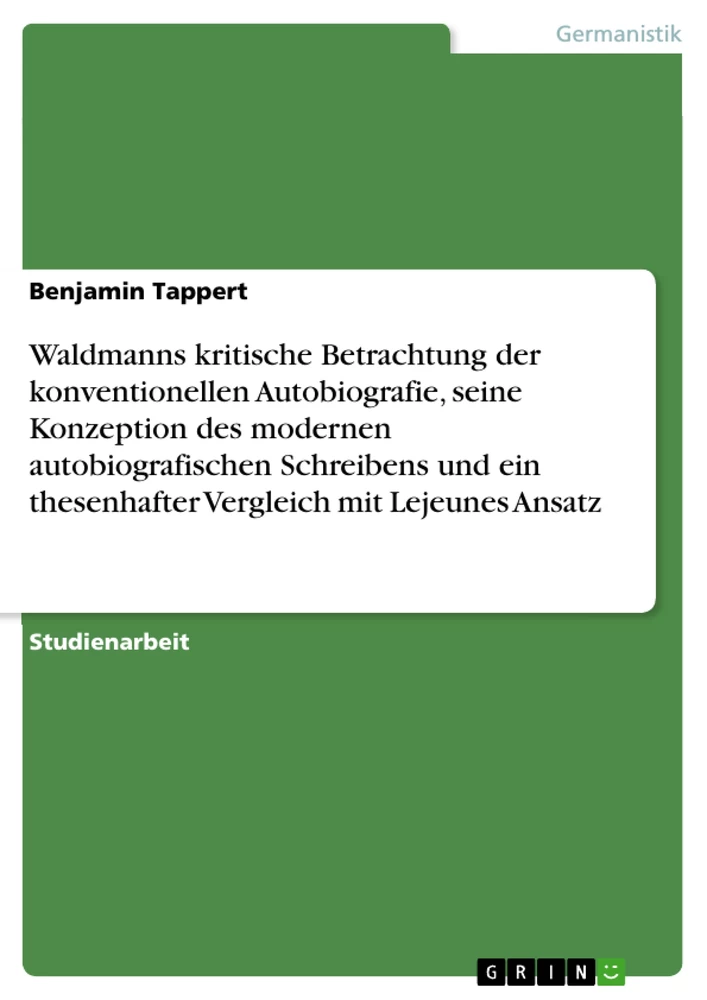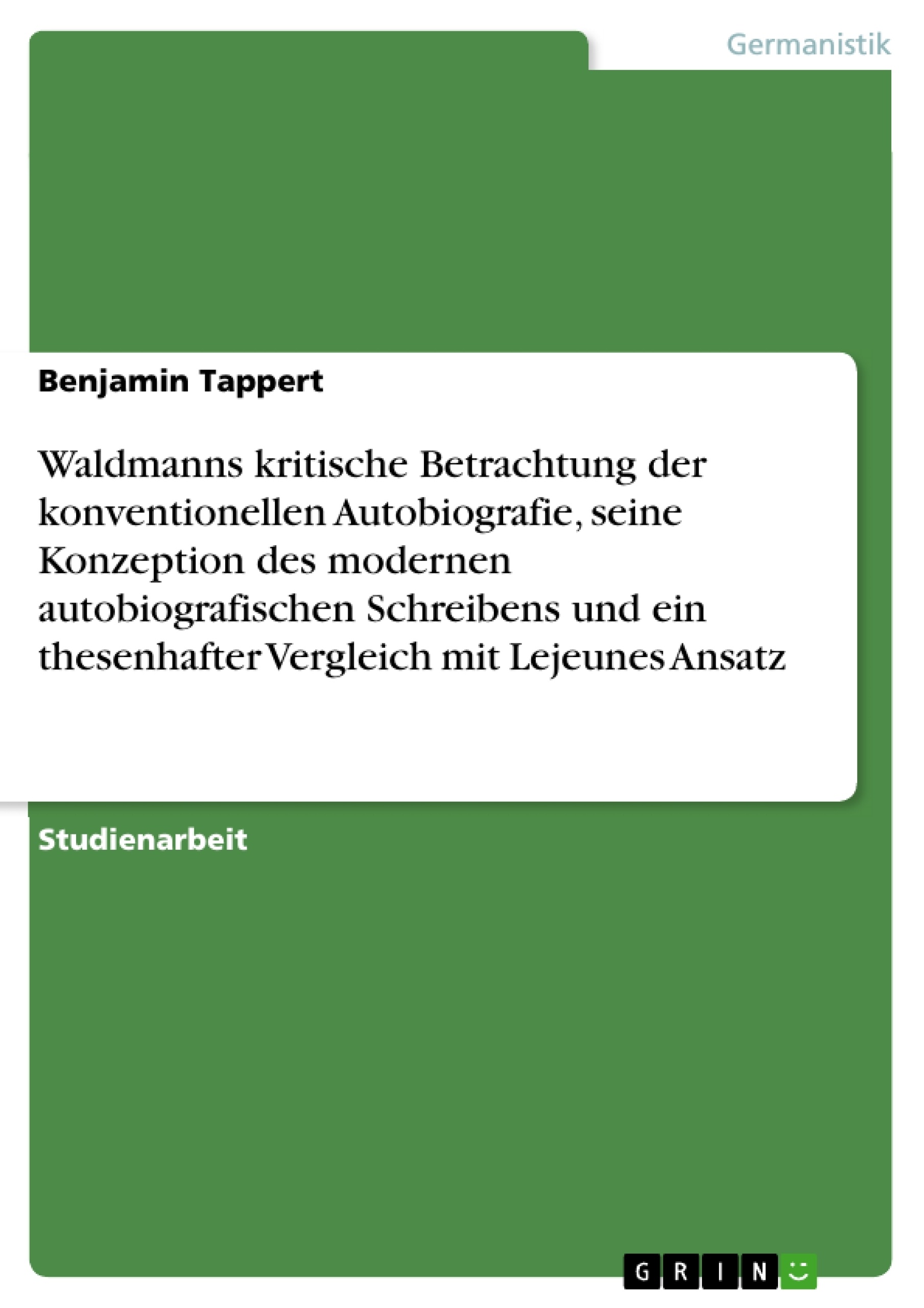Diese Arbeit befasst sich mit der Theorie zu autobiografischem Schreiben von Günter Waldmann und vergleicht diese thesenhaft mit Philippe Lejeunes Ansatz. Waldmanns „Autobiografisches als literarisches Schreiben" wird 2000 und Lejeunes „Der autobiografische Pakt" 1994 veröffentlicht. Beide theoretischen Ansätze gehören zur aktuellen Forschung, da die Autobiografieforschung schon seit vielen Jahrhunderten intensiv betrieben wird. Sie geht beispielsweise bis auf Kaiser Marcus Aurelius Antoninus zurück, der 170 die Autobiografie „Über sich selbst" verfasste. In den letzten Jahrzehnten hat aber die wissenschaftliche Beschäftigung mit und die Veröffentlichung von Autobiografien noch stärker zugenommen. Die Soziologie versucht diese Entwicklung konzeptionell erschließen. Einen wichtigen Einfluss auf die außergewöhnliche Zunahme der Beschäftigung mit Autobiografien hat die erweiterte Differenzierung der modernen Gesellschaft. Das Vorantreiben der Individualisierung des Rollenrepertoires und des Rollenhandelns bewirkt eine zunehmende Komplexität des individuellen Lebens. Durch die Individualisierung des Lebens jedes Einzelnen fallen bestimmte Lebenslaufmuster mit einem Wert- und Normensystem weg, werden aber durch Zwänge wie z. B. Konsumexistenz ersetzt. Ein festes Verlaufsmuster des Lebens durch Institutionen wird aufgelöst und es entsteht eine biografisierte Lebensführung, welche durch immer wieder neue Planungen und Entscheidungen determiniert ist. Eine Identitätsbildung wird durch die Differenzierung der Gesellschaft und die dadurch entstehende Individualisierung der Lebensführung beeinträchtigt und erschwert. Es fehlen feste Normen, Werte und Identitätsvorbilder. Das Individuum hat folglich ein größeres Bedürfnis biografisch tätig zu werden, um sich in einer individualisierten Welt zurecht zu finden und die eigene Lebenskonzeption zu rechtfertigen und zu stützen. Engelhardt fasst dieses Phänomen wie folgt zusammen: „Aus der Geschichte der Moderne läßt sich ein Wandel des Lebenslaufs herauslesen, der auf eine Umstrukturierung der personalen Identität des Menschen hinausläuft. Die Identität des Menschen bedarf immer mehr einer Stützung durch autobiographisches Erzählen.“
Waldmann bezeichnet diese Situation „als Krise des Individuums", da es im Spätkapitalismus keine kollektiven Lebensformen mehr gibt und die Selbstvergewisserung durch die eigene Biografie „gesellschaftliche, kulturelle, religiöse, weltanschauliche Bezugssysteme" ersetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Forschungsstand zur Autobiografie
- Waldmanns kritische Betrachtung des konventionellen autobiografischen Schreibens:
- Geschichtlichkeit des autobiografischen Schreibens
- Literaturwissenschaftliche Betrachtung autobiografischen Schreibens
- Autobiografie als subjektive Konstruktion und Fiktion der Lebensgeschichte
- Psychologische Begründung der subjektiven Konstruktion und Fiktionalität
- Erzähltheoretische Überlegungen zur literarischen Form von Autobiografien
- Philosophische Überlegungen zum Menschen- und Weltbild
- Moderne literarische Erzählformen in Autobiografien:
- Die Ich-Form
- Die Du-Form
- Die Er- bzw. Sie-Form
- Die Ich-Er- bzw. Ich-Sie-Form
- Erinnertes und erinnerndes Ich
- Die diskontinuierliche Form
- Autobiografien mit fiktionalen Teilen
- Autobiografisches Schreiben als Tagebuch-Schreiben
- Philippe Lejeunes gegensätzlicher Ansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich mit der Theorie von Günter Waldmann zum autobiografischen Schreiben auseinander und vergleicht sie thesenhaft mit dem Ansatz von Philippe Lejeune. Die Arbeit analysiert Waldmanns Konzept des modernen autobiografischen Schreibens und untersucht, wie es sich von traditionellen Ansätzen unterscheidet. Insbesondere betrachtet die Arbeit die literarische Form der Autobiografie und ihre Funktion in der Konstruktion von Identität und Selbstverständnis.
- Die Entwicklung des autobiografischen Schreibens im Kontext der Moderne
- Waldmanns Kritik an konventionellen autobiografischen Erzählformen
- Die Rolle der Literatur und literarischer Formen in autobiografischen Texten
- Das Verhältnis von Erinnerung, Fiktion und Realität in der Autobiografie
- Der Vergleich von Waldmanns Theorie mit Lejeunes Konzept des "autobiografischen Pakts"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Autobiografie ein und stellt Waldmanns Theorie und Lejeunes Ansatz im Kontext der Autobiografieforschung vor. Die Bedeutung der Autobiografie in der modernen Gesellschaft wird im Hinblick auf Individualisierung und Identitätsbildung beleuchtet.
Der Forschungsstand zur Autobiografie
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Entwicklung der Autobiografieforschung, beginnend mit klassischen Ansätzen, die die Autobiografie als reines Dokument der Realität sahen, bis hin zu neueren Ansätzen, die die literarischen und konstruktiven Aspekte der Autobiografie betonen.
Waldmanns kritische Betrachtung des konventionellen autobiografischen Schreibens
Dieser Abschnitt erläutert Waldmanns Kritik an traditionellen, chronologischen Ich-Erzählungen und stellt seine Theorie des modernen autobiografischen Schreibens vor. Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte von Waldmanns Theorie, wie z. B. die Bedeutung der literarischen Form, die Rolle von Fiktion und Erinnerung und die philosophischen Implikationen autobiografischen Schreibens.
Philippe Lejeunes gegensätzlicher Ansatz
Dieser Abschnitt stellt Lejeunes Theorie des "autobiografischen Pakts" vor und zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Waldmanns Konzept auf. Die Arbeit beleuchtet Lejeunes Fokus auf die Beziehung zwischen Autor und Leser und die Rolle des Vertrauens in der Konstruktion von Autobiografie.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind: Autobiografie, autobiografisches Schreiben, moderne Autobiografie, literarische Form, Fiktion, Erinnerung, Identität, Individualisierung, Selbstverständnis, Waldmann, Lejeune, autobiografischer Pakt.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Günter Waldmann an der konventionellen Autobiografie?
Waldmann kritisiert die traditionelle, chronologische Ich-Erzählung und betont stattdessen die literarische Konstruktion und Fiktionalität der Lebensgeschichte.
Was ist der "autobiografische Pakt" nach Philippe Lejeune?
Es ist die Übereinkunft zwischen Autor und Leser, dass der Erzähler, die Hauptperson und der reale Autor identisch sind, was Vertrauen in die Authentizität schafft.
Welche Rolle spielt die Individualisierung für das autobiografische Schreiben?
In der modernen Gesellschaft fehlen feste Lebenslaufmuster. Das Individuum nutzt das Schreiben zur Selbstvergewisserung und Identitätsbildung.
Welche modernen Erzählformen nennt Waldmann?
Er nennt unter anderem die Du-Form, die Er/Sie-Form, diskontinuierliche Formen und die Vermischung von Erinnertem mit fiktionalen Teilen.
Ist eine Autobiografie immer die reine Wahrheit?
Laut Waldmann ist jede Autobiografie eine subjektive Konstruktion und enthält zwangsläufig fiktionale Elemente, um dem Leben Sinn zu verleihen.
- Citation du texte
- Benjamin Tappert (Auteur), 2007, Waldmanns kritische Betrachtung der konventionellen Autobiografie, seine Konzeption des modernen autobiografischen Schreibens und ein thesenhafter Vergleich mit Lejeunes Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89830