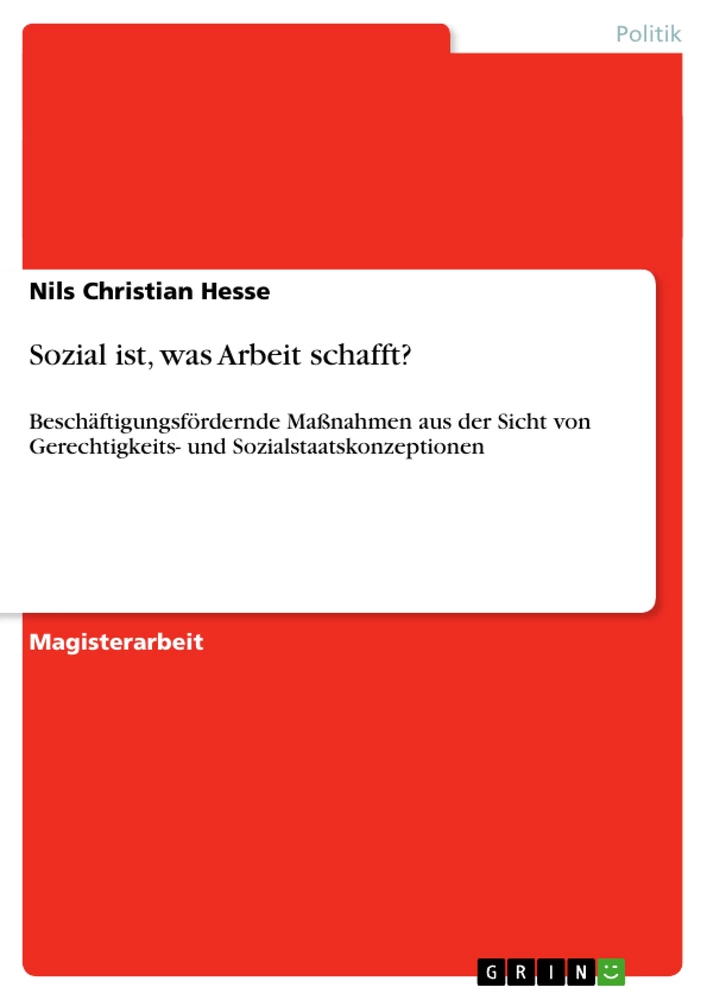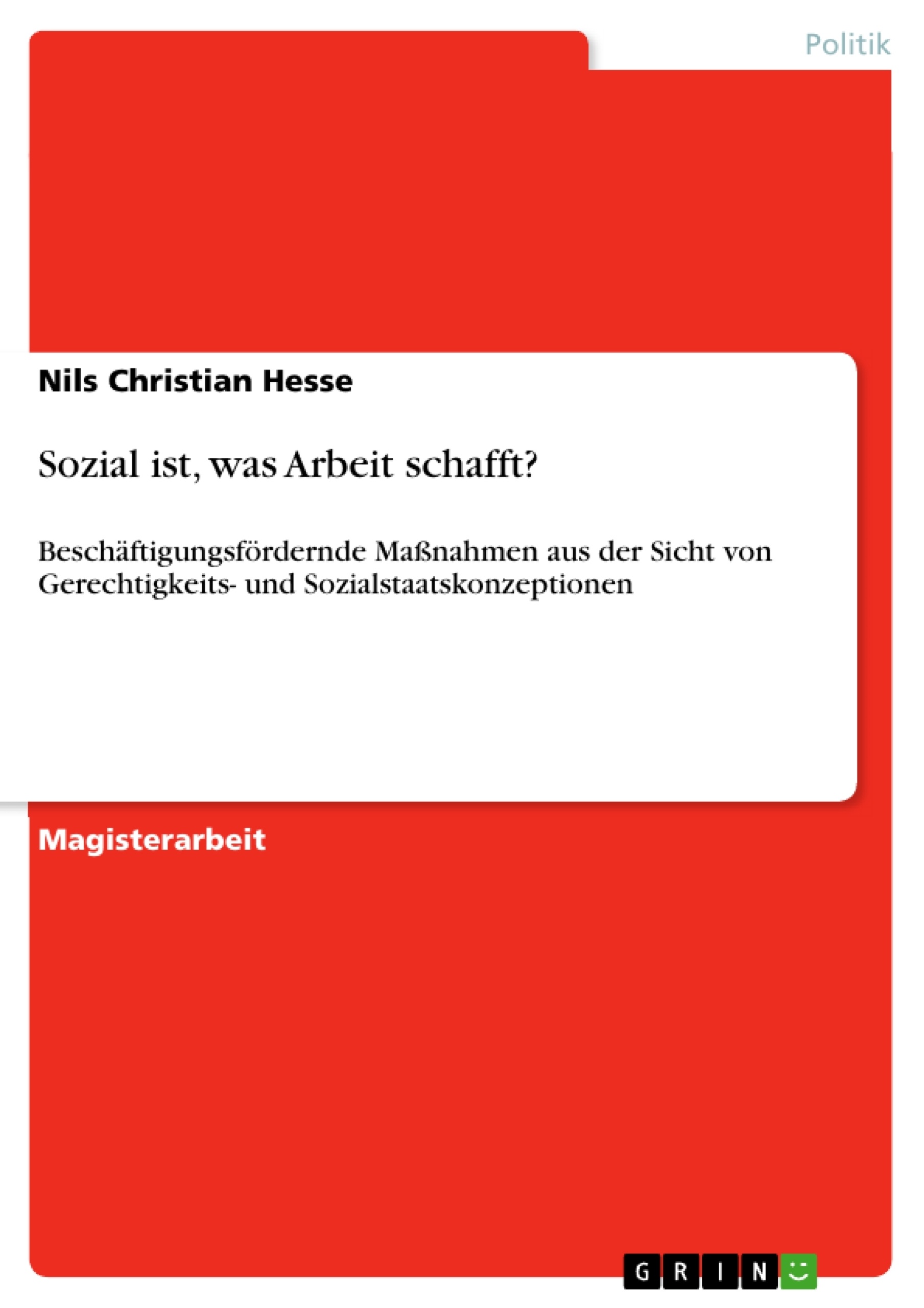Der deutsche Sozialstaat erlebt derzeit eine Finanz- und Legitimationskrise, die droht, sich zu einer politischen und gesellschaftlichen Sinn- und Orientierungskrise auszuweiten. Besonders dem Problem der Massenarbeitslosigkeit steht der deutsche Sozialstaat hilf- und ratlos gegenüber. Schlimmer noch, angesichts der hohen Sozialausgaben wird der Faktor Arbeit zunehmend verteuert. So gilt der Sozialstaat mitverantwortlich für die hohe Arbeitslosigkeit und erweist sich als Hindernis einer möglichst breiten Verteilung des Gutes Arbeit. Obgleich diese Entwicklung bereits seit Jahrzehnten absehbar ist, konnten sich die relevanten Akteure, die Politiker, Journalisten und Interessensgruppenvertreter, lange Zeit nicht auf eine Verständigungsgrundlage und einheitliche Problemwahrnehmung einigen. Erst mit fortschreitender Zuspitzung der Probleme am Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt scheint ein Prinzip auf dem besten Wege, zu einer solchen Verständigungsgrundlage zu avancieren: „Sozial ist was Arbeit schafft“ – im Folgenden mit „SIWAS“ abgekürzt. Es wird vermehrt von der deutschen Politik bemüht, um Reformmaßnahmen zu rechtfertigen. Und auch in der öffentlichen Meinung scheint diese Interpretation von sozial angesichts der Anerkennung von Arbeitslosigkeit als Hauptübel der derzeitigen Wirtschaftsmisere auf Zustimmung zu stoßen. Ob auch aus wissenschaftlicher Sicht SIWAS Geltung erlangen kann wird diese Arbeit klären.
Dazu wird die zentrale Fragestellung - ist sozial was Arbeit schafft? - in drei Unterfragen aufgegliedert: Was ist Sozial? Was schafft Arbeit? Und inwieweit ist beides deckungsgleich? Es gilt somit in einem ersten Schritt theoretisch zu klären, wie Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen aussehen, in die sich eine Handlungsmaxime SIWAS integrieren lassen könnte. In einem zweiten Schritt ist daraufhin zu konkretisieren, worauf der Maßstab der sozialen Gerechtigkeit anzuwenden ist. Wege und Maßnahmen sind zu benennen, mit denen die begründete Hoffnung verbunden wird, dass sie zu mehr Beschäftigung führen. Diese Wege gilt es mit Hilfe der zuvor erarbeiteten Gerechtigkeitskriterien in einem dritten Schritt auf ihre soziale Wirkung hin zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen
- 2.1 EGALITÄRE PERSPEKTIVE
- 2.1.1 Egalitäre Konzeptionen der Gerechtigkeit
- 2.1.2 Egalitäre Konzeptionen des Sozialstaates
- 2.1.3 Kritik am Egalitarismus
- 2.2 LIBERALE PERSPEKTIVE
- 2.2.1 Liberale Konzeptionen der Gerechtigkeit
- 2.2.2 Liberale Konzeptionen des Sozialstaates
- 2.2.3 Kritik am Liberalismus
- 2.3 MONISTISCHE PERSPEKTIVE
- 2.3.1 Monistische Konzeptionen der Gerechtigkeit
- 2.3.2 Monistische Konzeptionen des Sozialstaates
- 2.3.3 Kritik an monistischen Konzeptionen
- 2.1 EGALITÄRE PERSPEKTIVE
- 3 Probleme, Ursachen und Auswege der Arbeitslosigkeit
- 3.1 PROBLEME DER ARBEITSLOSIGKEIT
- 3.2 URSACHEN DER ARBEITSLOSIGKEIT
- 3.3 ERWERBSARBEITSZENTRIERTE WEGE AUS DER ARBEITSLOSIGKEIT
- 3.4 IMPLIKATIONEN FÜR EINE PRAKTISCHE ARBEITSMARKT- UND SOZIALPOLITIK
- 4 Wege aus der Arbeitslosigkeit aus der Sicht von Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen
- 4.1 WEGE AUS DER ARBEITSLOSIGKEIT AUS EGALITÄRER PERSPEKTIVE
- 4.2 WEGE AUS DER ARBEITSLOSIGKEIT AUS LIBERALER PERSPEKTIVE
- 4.3 WEGE AUS DER ARBEITSLOSIGKEIT AUS MONISTISCHER PERSPEKTIVE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aussage „Sozial ist, was Arbeit schafft“ im Kontext von Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen. Ziel ist es, die Vereinbarkeit dieser Maxime mit verschiedenen Gerechtigkeitstheorien zu analysieren und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Lichte dieser Theorien zu bewerten. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, ob und wie sich die Maxime in bestehende Konzepte integrieren lässt.
- Analyse verschiedener Gerechtigkeitskonzeptionen (egalitär, liberal, monistisch)
- Beurteilung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen anhand von Gerechtigkeitskriterien
- Untersuchung der sozialen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit
- Bewertung des Konzepts "Sozial ist, was Arbeit schafft"
- Entwicklung eines umfassenderen Verständnisses der Beziehung zwischen sozialer Gerechtigkeit und Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Arbeit untersucht die Aussage „Sozial ist, was Arbeit schafft“ vor dem Hintergrund der Krise des deutschen Sozialstaates und der hohen Arbeitslosigkeit. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage auf und gliedert sie in drei Unterfragen: Was ist sozial? Was schafft Arbeit? Inwiefern ist beides deckungsgleich? Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse von Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen mit der Bewertung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen verbindet. Der Fokus liegt auf der Identifizierung einer geeigneten Ebene der Gerechtigkeitsdiskurse (Prinzip, Programm, Projekt), um die Forschungsfrage zu bearbeiten.
2 Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen, um einen theoretischen Rahmen für die Bewertung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu schaffen. Es werden egalitäre, liberale und monistische Perspektiven unterschieden und jeweils deren Konzeptionen der Gerechtigkeit und des Sozialstaates sowie deren Kritikpunkte beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf den Aspekten, die später die Beurteilung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ermöglichen, insbesondere die zu verteilenden Güter, die angestrebte Form der Gerechtigkeit und die Berücksichtigung des Problems der Arbeitslosigkeit.
3 Probleme, Ursachen und Auswege der Arbeitslosigkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Problemen, Ursachen und möglichen Lösungsansätzen der Arbeitslosigkeit. Es werden die Herausforderungen der Arbeitslosigkeit detailliert beschrieben, ihre Ursachen analysiert und verschiedene erwerbsarbeitszentrierte Wege aus der Arbeitslosigkeit dargestellt. Das Kapitel legt den Fokus auf die Implikationen für eine praxisorientierte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und bildet die empirische Grundlage für die spätere Bewertung der verschiedenen Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen.
4 Wege aus der Arbeitslosigkeit aus der Sicht von Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen: Dieses Kapitel bewertet verschiedene Wege aus der Arbeitslosigkeit vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 vorgestellten Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen. Es werden die Perspektiven des Egalitarismus, des Liberalismus und des Monismus auf die Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit untersucht und deren jeweilige Stärken und Schwächen diskutiert. Die Analysen zeigen auf, wie die unterschiedlichen Konzepte zu verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Empfehlungen führen.
Schlüsselwörter
Soziale Gerechtigkeit, Sozialstaat, Arbeitslosigkeit, Egalitarismus, Liberalismus, Monismus, Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungsförderung, Gerechtigkeitskonzeptionen, „Sozial ist, was Arbeit schafft“, Wertdualismus, Solidarität, Eigenverantwortung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von "Sozial ist, was Arbeit schafft" im Kontext von Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Aussage „Sozial ist, was Arbeit schafft“ im Kontext verschiedener Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen. Sie untersucht die Vereinbarkeit dieser Maxime mit egalitären, liberalen und monistischen Gerechtigkeitstheorien und bewertet arbeitsmarktpolitische Maßnahmen anhand dieser Theorien. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich die Maxime in bestehende Konzepte integrieren lässt.
Welche Gerechtigkeitskonzeptionen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht egalitäre, liberale und monistische Gerechtigkeitskonzeptionen. Für jede Perspektive werden deren Konzeptionen von Gerechtigkeit und Sozialstaat sowie deren jeweilige Kritikpunkte beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf den Aspekten, die für die Beurteilung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen relevant sind (z.B. zu verteilende Güter, angestrebte Form der Gerechtigkeit, Berücksichtigung von Arbeitslosigkeit).
Wie wird die Arbeitslosigkeit in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Probleme und Ursachen der Arbeitslosigkeit detailliert. Sie untersucht verschiedene erwerbsarbeitszentrierte Wege aus der Arbeitslosigkeit und deren Implikationen für eine praxisorientierte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Diese Analyse dient als empirische Grundlage für die Bewertung der verschiedenen Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen.
Welche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen werden betrachtet?
Die Arbeit bewertet verschiedene Wege aus der Arbeitslosigkeit aus egalitärer, liberaler und monistischer Perspektive. Es werden die jeweiligen Stärken und Schwächen der daraus resultierenden arbeitsmarktpolitischen Empfehlungen diskutiert.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verbindet die Analyse von Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen mit der Bewertung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Sie sucht nach einer geeigneten Ebene der Gerechtigkeitsdiskurse (Prinzip, Programm, Projekt), um die Forschungsfrage zu bearbeiten.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Begriffe sind soziale Gerechtigkeit, Sozialstaat, Arbeitslosigkeit, Egalitarismus, Liberalismus, Monismus, Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungsförderung, Gerechtigkeitskonzeptionen, „Sozial ist, was Arbeit schafft“, Wertdualismus, Solidarität und Eigenverantwortung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen, Probleme, Ursachen und Auswege der Arbeitslosigkeit, und Wege aus der Arbeitslosigkeit aus der Sicht von Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie lässt sich die Aussage „Sozial ist, was Arbeit schafft“ im Kontext verschiedener Gerechtigkeits- und Sozialstaatskonzeptionen analysieren und bewerten?
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Analyse der Vereinbarkeit der Maxime „Sozial ist, was Arbeit schafft“ mit verschiedenen Gerechtigkeitstheorien und die Bewertung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen im Lichte dieser Theorien. Die Arbeit strebt ein umfassenderes Verständnis der Beziehung zwischen sozialer Gerechtigkeit und Arbeitsmarktpolitik an.
- Quote paper
- Dipl. Vw.; M.A. Nils Christian Hesse (Author), 2006, Sozial ist, was Arbeit schafft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89846