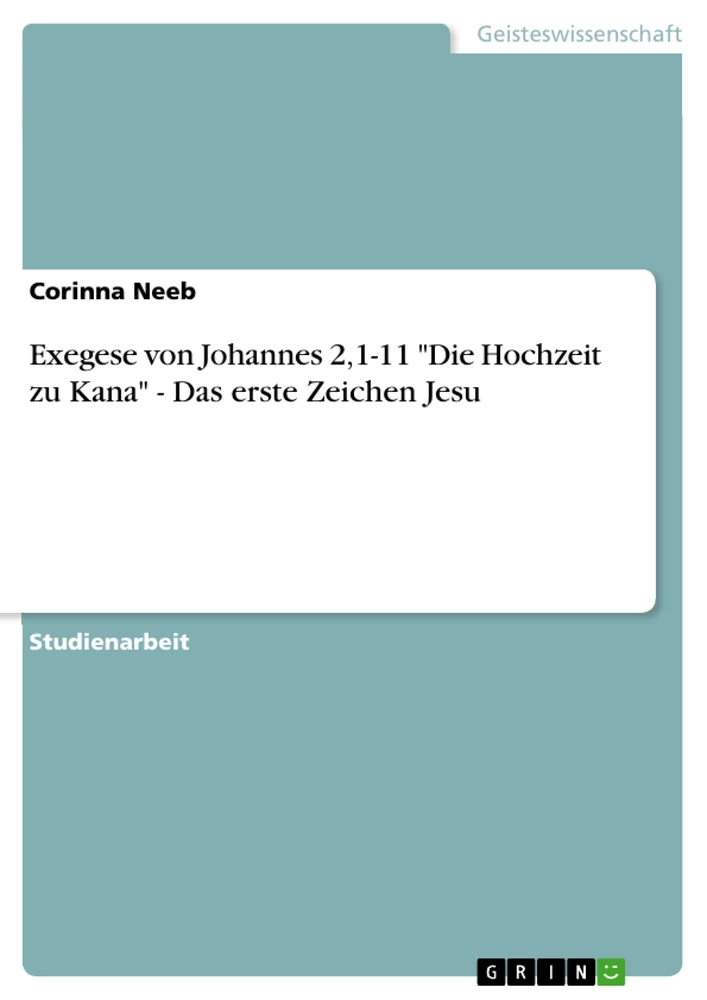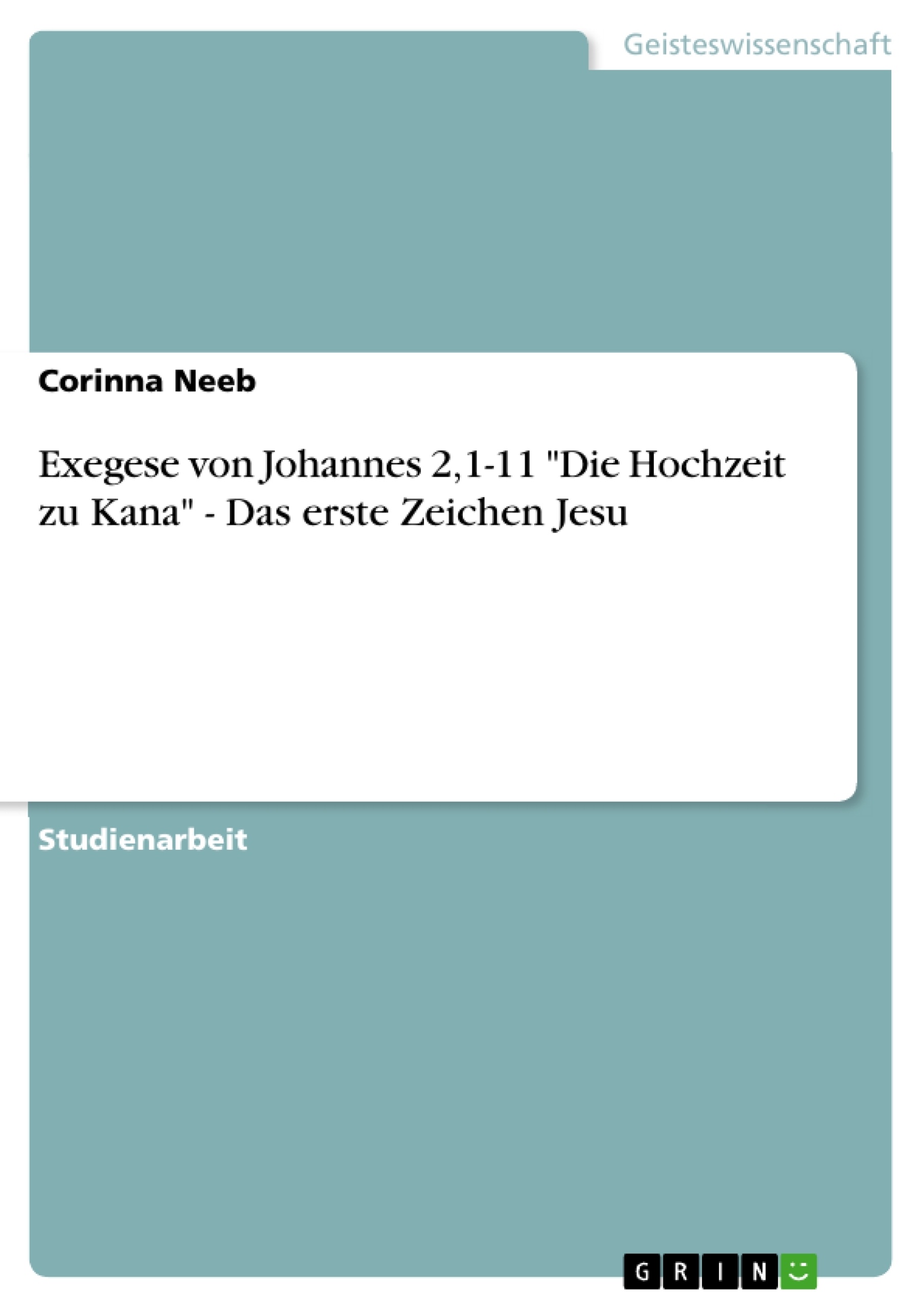Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem ersten öffentlichen <Zeichen> Jesu nach johanneischer Tradition: „Die Hochzeit zu Kana“ (Joh. 2,1-11).
Für die Exegese johanneischer Texte ist grundlegend zu beachten, dass der Evangelist die synoptische Tradition als bekannt voraussetzt. Im Unterschied zu den synoptischen Evangelien handelt es sich bei Johannes in erster Linie nicht um erzählende Texte, sondern um darauf basierende theologische Reflexion. So ist bei johanneischen Texten stets mit mehrschichtigen Bedeutungsebenen zu rechnen. Es sind besonders die <Zeichen>, die über sich hinausweisen und auf die Offenbarung des Wesens Jesu Christi zielen; sie haben somit eine stark christologische Relevanz. So geht es beim vorliegenden Weinwunder Jesu zwar auf den ersten Blick um die wundersame Verköstigung einer Hochzeitsgesellschaft, auf einer tieferen Ebene allerdings um die programmatische Eröffnung des Wirkens Gottes in Jesus zum Heil der Menschen.
Der „Hochzeit zu Kana“ als dem Schauplatz des ersten von insgesamt sieben Wundern kommt im Ganzen des Joh.-Evangeliums offensichtlich eine besonders betonte und exponierte Stellung zu. Zu untersuchen ist, wie es sich in den nahen wie auch weiteren Kontext des Evangeliums einfügt.
Die Untersuchung der Begriffe „Hochzeit“ und „Wein“ wird zeigen, dass Jesus mit diesem Zeichen den Anbruch der eschatologisch-messianischen Heilszeit in seiner Person proklamiert: Das 4. Evangelium zeigt die Person Jesu Christi „mit einer ausstrahlenden Offenbarungskraft wie in keinem der anderen Evangelien“ (Wilckens, U.: Theologie des NT, Bd. I/4, 2005, 153.).
Im Rahmen dieser Arbeit wird es aufgrund der Bezeichnung des „Weinwunders zu Kana“ als erstem der Zeichen von Nöten sein, auf die Problematik der sogenannten „Semeia“-Quelle einzugehen. Daneben ist zur in der Literatur sehr ausführlich diskutierten religionsgeschichtlichen Parallele des Dionysus-Kultes Stellung zu beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Exegese von Johannes 2,1-11
- Übersetzung: Joh. 2,1-11(12) nach Hartwig Thyen
- Literarkritik: Kontextanalyse
- Abgrenzung
- Gliederung des Textes
- Mikrokontext
- Makrokontext
- Formkritik: Gattungsbestimmung
- Exkurs: Charakteristika der johanneischen Wundererzählungen
- Exkurs: Zeichenquelle bei Johannes
- Traditionskritik
- Begriffsanalyse „Hochzeit“
- Begriffsanalyse „Wein“
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Einzelversauslegung
- Schluss-Gesamtinterpretation
- Literatur
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das erste öffentliche
- Die Besonderheit des johanneischen Evangeliums und seine Abgrenzung zur synoptischen Tradition
- Die Bedeutung der
Jesu und ihre christologische Relevanz - Die eschatologisch-messianische Bedeutung des Weinwunders im Kontext der johanneischen Tradition
- Die Rolle der sogenannten „Semeia“-Quelle und ihre Verbindung zur Zeichenquelle bei Johannes
- Der religionsgeschichtliche Vergleich zum Dionysus-Kult und seine Relevanz für die Interpretation des Weinwunders
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Arbeit im Rahmen des Seminars „Neutestamentliche Wundergeschichten“ vor und gibt einen Überblick über die grundlegende Forschungsfrage. Sie verdeutlicht die Besonderheiten des johanneischen Evangeliums und die Bedeutung der
Jesu im Kontext seiner Theologie. - Kapitel 2 beleuchtet die Exegese von Johannes 2,1-11. Es werden die Übersetzung des Textes nach Hartwig Thyen, die literarische Kontextanalyse sowie die Form- und Traditionskritik behandelt. Besonderer Fokus liegt auf der Deutung des „Weinwunders“ im Rahmen der johanneischen Zeichenwunder und seiner eschatologischen Relevanz.
- Kapitel 3 bietet die Schluss-Gesamtinterpretation des Textes und fasst die wichtigsten Ergebnisse der Exegese zusammen.
Schlüsselwörter
Johannesevangelium, Wundererzählungen,
- Citation du texte
- Corinna Neeb (Auteur), 2007, Exegese von Johannes 2,1-11 "Die Hochzeit zu Kana" - Das erste Zeichen Jesu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89855