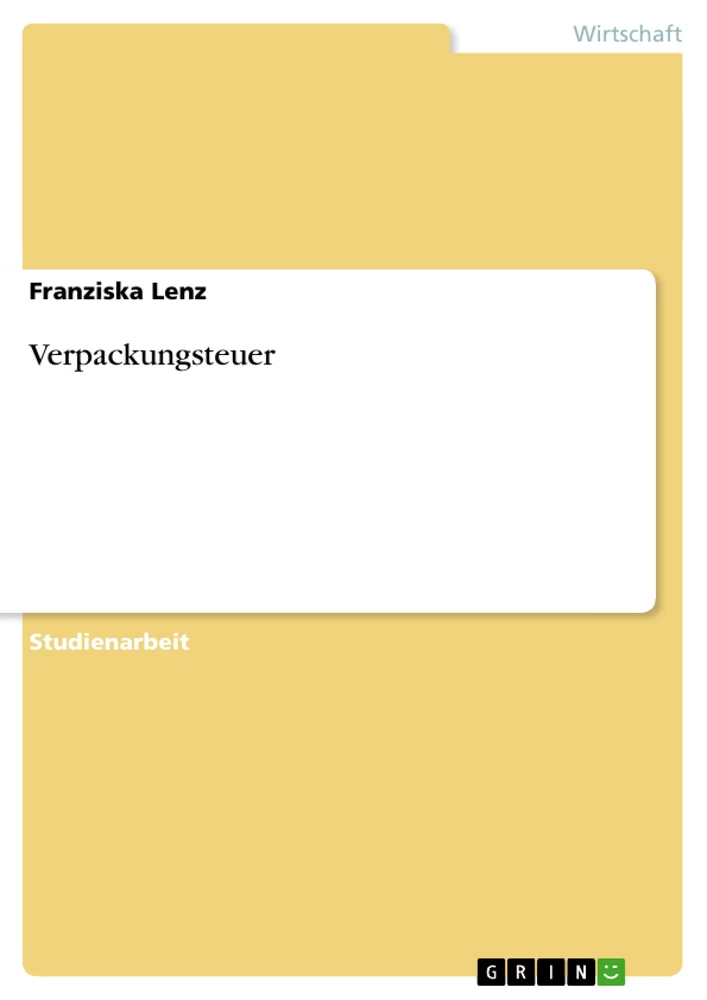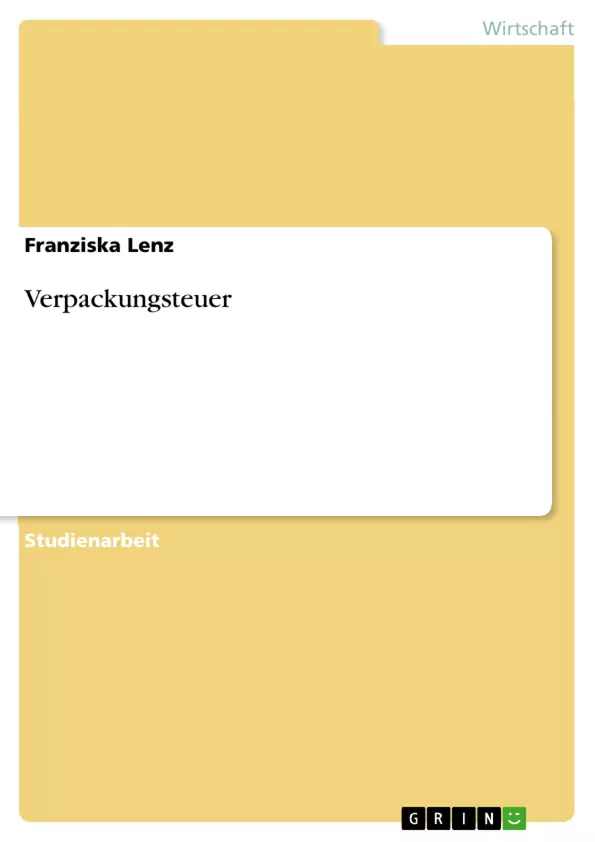Nach der für kommunale Steuern heranzuziehenden Definition des § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung (AO) vom 16. März 1976 sind Steuern "Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine be-sondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. ..."
Bei den kommunalen Steuern handelt es sich im engeren Sinne um Steuern, deren Aufkommen allein den Gemeinden, aufgrund ihrer Steuerertragshoheit, zufließt. Kommunalsteuern sind an einen örtli-chen Tatbestand oder Vorgang geknüpft und in ihrer unmittelbaren Wirkung örtlich begrenzt. Zu die-sen Steuern gehören insbesondere die Gewerbesteuer, bei der die Gemeinden Ertragshoheit haben, aber einen Teil als Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder abführen müssen, die Grundsteuer, die Vergnügungsteuer, der Grunderwerbsteuerzuschlag, die Jagd- und Fischereisteuer, die Hundesteuer und die in einigen Bundesländern erhobene Schankerlaubnis- und Zweitwohnsteuer. Diese Steuern stehen den Gemeinden gemäß Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 Grundgesetz (GG) zu.
Im weiteren Sinne umfassen die kommunalen Steuern die Gesamtheit der den Gemeinden zur Verfü-gung stehenden Steuereinnahmen, die aus den Gemeindesteuern im engeren Sinne sowie dem Ge-meindeanteil an den Gemeinschaftssteuern besteht.
Ihrem Charakter nach sind kommunale Steuern - mit Ausnahme der Schankerlaubnissteuer - Verbrauchsteuern und Aufwandsteuern.
Die Höhe des Aufkommens kann von den Gemeinden oder Gemeindeverbänden weitgehend nach eigenem Ermessen bestimmt werden. Trotz unterschiedlicher Anspannung in den einzelnen Gemein-den führen die kommunalen Steuern nicht zu Störungen im überörtlichen Wirtschaftsverkehr.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Kommunale Steuern
- 1.1.1. Definition
- 1.1.2. Zweck
- 1.1.3. Rechtsgrundlagen
- 1.1.3.1. Allgemeines (prinzipielles) Steuerfindungsrecht
- 1.1.3.2. Besonderes Steuerfindungsrecht
- 1.1.3.3. Allgemeiner Subsidiaritätsgrundsatz kommunaler Steuern
- 2. Kommunale Verpackungsteuer
- 2.1. Ziele
- 2.2. Ökonomische Wirkungen
- 2.2.1. Steuerwirkungen
- 2.2.2. Substitutions- und Einsparmöglichkeiten der Einwegverpackungen
- 2.2.3. Verteilungswirkungen
- 2.2.4. Arbeitsplatzwirkungen
- 2.2.5. Wettbewerbswirkungen
- 2.3. Die praktische Ausgestaltung der Verpackungsteuer am Beispiel Kassel
- 3. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer kommunalen Verpackungsteuer
- 4. Befürworter und Gegner der kommunalen Verpackungsteuer
- 5. Weitere Instrumente zur Vermeidung von Einwegverpackungen
- 5.1. Kommunalpolitische Maßnahmen
- 5.1.1. Appelle
- 5.1.2. Subventionen
- 5.1.3. Staatliche Eigenproduktion
- 5.1.4. Verbot
- 5.2. Maßnahmen übergeordneter Gebietskörperschaften
- 5.2.1. Die Verpackungsverordnung
- 5.2.1.1. Rechtliche Grundlagen
- 5.2.1.2. Anwendungsbereich
- 5.2.1.3. Abfallwirtschaftliche Ziele
- 5.2.1.4. Verpackungsarten
- 5.2.1.5. Rücknahme-, Pfanderhebungs- und Verwertungspflichten
- 5.2.1.6. Pro und Kontra der Pfanderhebungspflicht für Einweggetränkeverpackungen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die kommunale Verpackungsteuer, ihre ökonomischen Auswirkungen und verfassungsrechtliche Zulässigkeit. Sie analysiert verschiedene Instrumente zur Vermeidung von Einwegverpackungen auf kommunaler und übergeordneter Ebene.
- Ökonomische Folgen einer kommunalen Verpackungsteuer
- Verfassungsrechtliche Aspekte der Verpackungsteuer
- Alternativen zur Verpackungsteuer zur Reduktion von Einwegverpackungen
- Analyse der Verpackungsverordnung
- Bewertung der verschiedenen Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem es den Begriff der kommunalen Steuern definiert und deren Zweck sowie die relevanten Rechtsgrundlagen erläutert. Es werden die verschiedenen Ebenen des Steuerfindungsrechts – das allgemeine und das besondere – sowie der Subsidiaritätsgrundsatz im kommunalen Kontext detailliert dargestellt. Dies bildet die notwendige Basis für das Verständnis der kommunalen Verpackungsteuer, die in den folgenden Kapiteln im Detail untersucht wird.
2. Kommunale Verpackungsteuer: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Konzept einer kommunalen Verpackungsteuer. Es definiert die Ziele einer solchen Steuer und analysiert deren umfassende ökonomische Auswirkungen. Die Analyse umfasst Steuerwirkungen, Substitutions- und Einsparmöglichkeiten bei Einwegverpackungen, Verteilungswirkungen, Arbeitsplatzwirkungen und Wettbewerbswirkungen. Am Beispiel der Stadt Kassel wird die praktische Ausgestaltung einer solchen Steuer beleuchtet, was die theoretischen Überlegungen mit der Realität konfrontiert.
3. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer kommunalen Verpackungsteuer: In diesem Kapitel wird die rechtliche Grundlage einer kommunalen Verpackungsteuer umfassend geprüft. Es werden die verfassungsrechtlichen Aspekte beleuchtet und diskutiert, ob eine solche Steuer mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen vereinbar ist. Dieser Abschnitt stellt sicher, dass die vorangehenden ökonomischen Analysen innerhalb eines soliden rechtlichen Rahmens bewertet werden.
4. Befürworter und Gegner der kommunalen Verpackungsteuer: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Perspektiven auf das Thema der kommunalen Verpackungsteuer. Es untersucht die Argumente der Befürworter und Gegner und zeigt die verschiedenen Interessen und Standpunkte auf. Diese Gegenüberstellung ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der komplexen Problematik und ihrer gesellschaftlichen Relevanz.
5. Weitere Instrumente zur Vermeidung von Einwegverpackungen: Dieses Kapitel erweitert den Blickwinkel und geht über die Betrachtung der Verpackungsteuer hinaus. Es beleuchtet kommunalpolitische Maßnahmen wie Appelle, Subventionen, staatliche Eigenproduktion und Verbote. Darüber hinaus werden Maßnahmen übergeordneter Gebietskörperschaften, insbesondere die Verpackungsverordnung, detailliert analysiert. Der Fokus liegt auf den rechtlichen Grundlagen, dem Anwendungsbereich, den abfallwirtschaftlichen Zielen, den Verpackungsarten und den Rücknahme-, Pfanderhebungs- und Verwertungspflichten. Die Vor- und Nachteile der Pfanderhebungspflicht für Einweggetränkeverpackungen werden kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Kommunale Verpackungsteuer, Ökonomische Wirkungen, Verfassungsrecht, Einwegverpackungen, Abfallwirtschaft, Verpackungsverordnung, Subsidiarität, Kommunalpolitik, Umweltpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Kommunalen Verpackungsteuer
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die kommunale Verpackungsteuer. Sie beleuchtet die ökonomischen Auswirkungen, die verfassungsrechtliche Zulässigkeit und analysiert verschiedene Instrumente zur Vermeidung von Einwegverpackungen auf kommunaler und übergeordneter Ebene.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einführung in kommunale Steuern, eine detaillierte Analyse der kommunalen Verpackungsteuer inklusive ihrer ökonomischen Folgen (Steuerwirkungen, Substitutionseffekte, Verteilung, Arbeitsplätze, Wettbewerb), eine Prüfung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit, eine Gegenüberstellung der Argumente von Befürwortern und Gegnern, sowie eine Betrachtung alternativer Maßnahmen zur Reduktion von Einwegverpackungen auf kommunaler und übergeordneter Ebene (z.B. die Verpackungsverordnung).
Welche ökonomischen Auswirkungen werden untersucht?
Die Analyse der ökonomischen Auswirkungen der kommunalen Verpackungsteuer umfasst die direkten Steuerwirkungen, die Möglichkeiten zur Substitution und Einsparung von Einwegverpackungen, die Verteilungswirkungen, die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und den Wettbewerb.
Wie wird die verfassungsrechtliche Zulässigkeit geprüft?
Die Arbeit prüft die Vereinbarkeit einer kommunalen Verpackungsteuer mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen. Die verfassungsrechtlichen Aspekte werden detailliert beleuchtet.
Welche Alternativen zur Verpackungsteuer werden betrachtet?
Neben der Verpackungsteuer werden kommunalpolitische Maßnahmen wie Appelle, Subventionen, staatliche Eigenproduktion und Verbote untersucht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Verpackungsverordnung, inklusive ihrer rechtlichen Grundlagen, ihres Anwendungsbereichs und der Pfanderhebungspflicht für Einweggetränkeverpackungen.
Welche Rolle spielt die Verpackungsverordnung?
Die Arbeit analysiert die Verpackungsverordnung detailliert, unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen, des Anwendungsbereichs, der abfallwirtschaftlichen Ziele, der Verpackungsarten und der Rücknahme-, Pfanderhebungs- und Verwertungspflichten. Die Vor- und Nachteile der Pfanderhebungspflicht werden kritisch diskutiert.
Wer sind die Befürworter und Gegner der kommunalen Verpackungsteuer?
Die Arbeit präsentiert die Argumente der Befürworter und Gegner der kommunalen Verpackungsteuer, um ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Interessen und Standpunkte zu ermöglichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kommunale Verpackungsteuer, Ökonomische Wirkungen, Verfassungsrecht, Einwegverpackungen, Abfallwirtschaft, Verpackungsverordnung, Subsidiarität, Kommunalpolitik, Umweltpolitik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur kommunalen Verpackungsteuer, ein Kapitel zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit, ein Kapitel zu Befürwortern und Gegnern und ein Kapitel zu alternativen Maßnahmen zur Vermeidung von Einwegverpackungen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, Kommunalpolitiker, und alle, die sich mit Fragen der Abfallwirtschaft, Umweltpolitik und kommunaler Steuerpolitik beschäftigen.
- Arbeit zitieren
- Franziska Lenz (Autor:in), 2002, Verpackungsteuer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8985