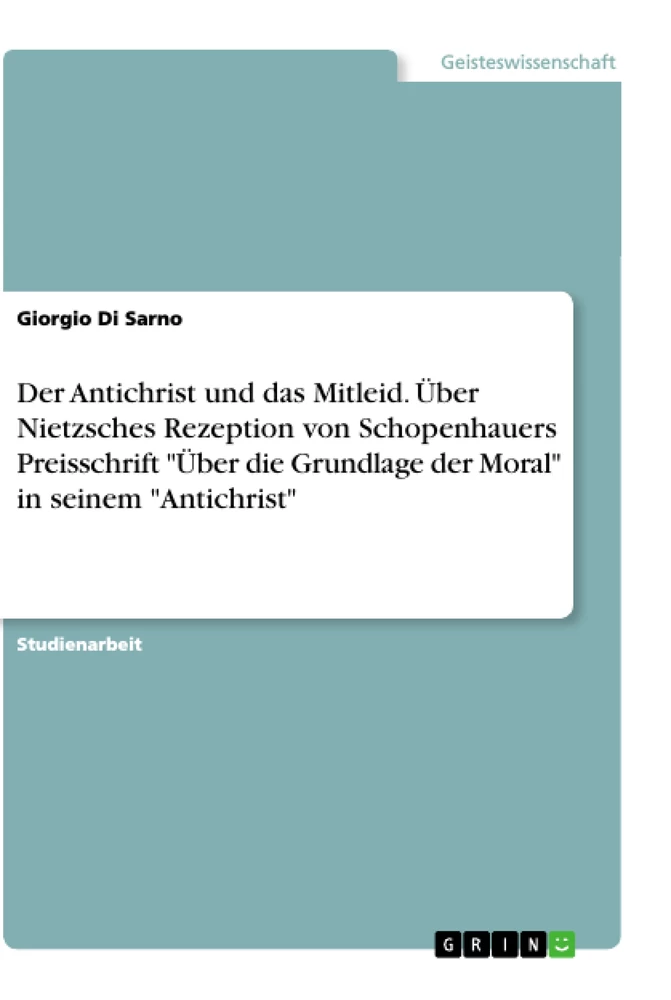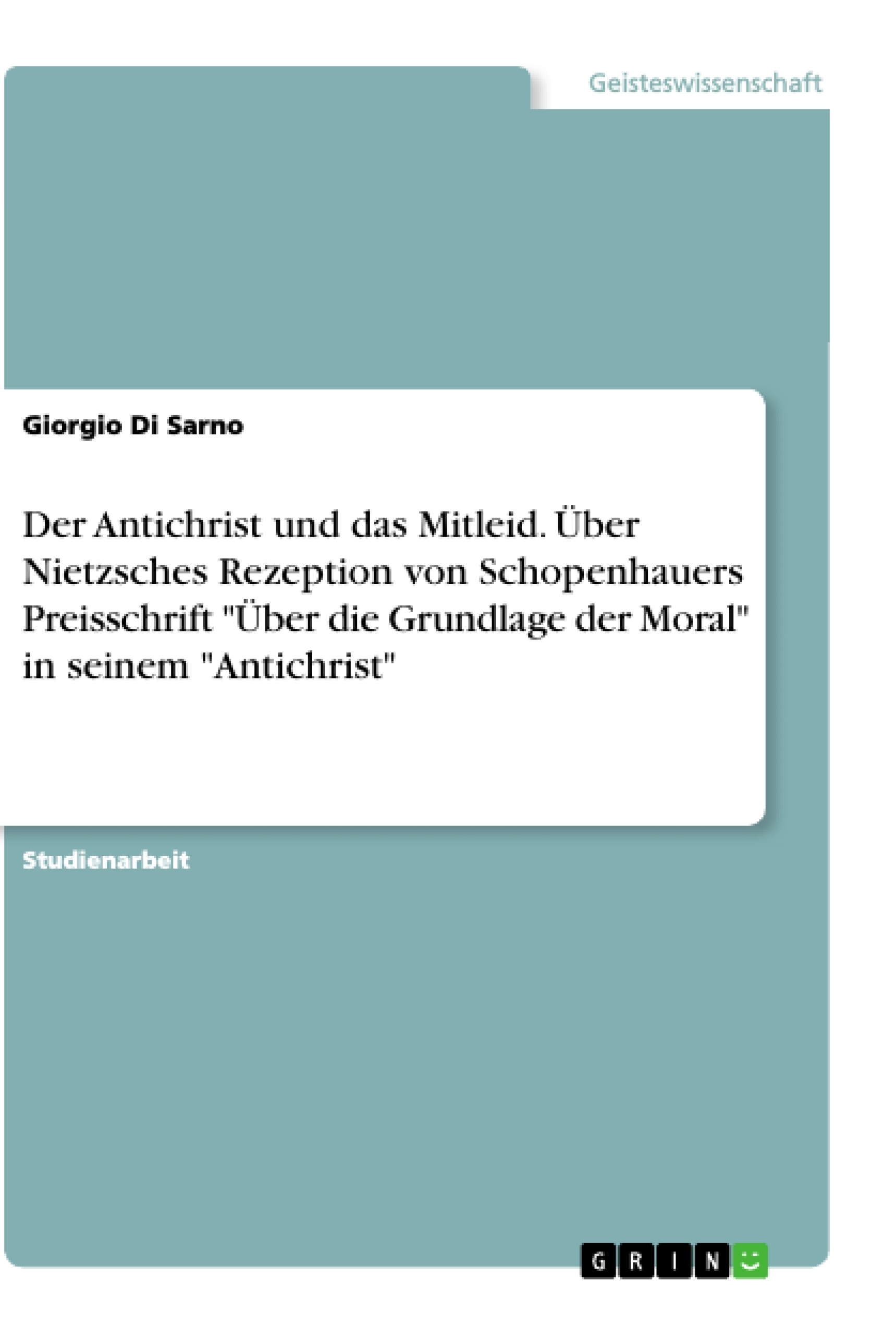Diese Arbeit untersucht Nietzsches Rezeption von Schopenhauers Preisschrift "Über die Grundlage der Moral" (1840) in seinen späteren Schriften im Allgemeinen und in seinem Werk "Der Antichrist. Fluch auf das Christentum" (1894) im Besonderen. Dabei wird vor allem Nietzsches Ambivalenz zu dieser Schrift herausgestellt. Mit Blick auf das Gesamtwerk Nietzsches wird gezeigt, wie er trotz aller Abgrenzung zentrale Aspekte von Schopenhauers Preisschrift produktiv weiterdenkt und dabei in eigene Kontexte stellt.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird eine Skizze der argumentativen Strategie, die Schopenhauer in seiner Kritik der kantischen Ethik verfolgt, sowie eine Rekonstruktion seiner Bestimmung des Mitleids als ethisches Urphänomen dargelegt. Im zweiten Teil werden diese Ausführungen zu derjenigen Position Nietzsches, die er in seinem 1888 verfassten Werk "Der Antichrist. Fluch auf das Christentum" (1894) vertritt, in ein deutliches Rezeptionsverhältnis gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schopenhauer Über die Grundlage der Moral
- Das Werk
- Kants Ethik als theologische Explikation und Petitiio Principii
- Das Mitleid als ethisches Urphänomen
- Friedrich Nietzsches Der Antichrist
- Das Werk
- Die kantische Philosophie als »Schleichweg zum alten Ideal«
- Das Mitleiden als Konservator und Multiplikator des Leidens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rezeption von Schopenhauers Über die Grundlage der Moral (1840) in Nietzsches späten Schriften, insbesondere in seinem Werk Der Antichrist. Fluch auf das Christentum (1894). Ziel ist es, die Ambivalenz Nietzsches gegenüber Schopenhauers Schrift aufzuzeigen: die positive Übernahme der Kritik an der moralphilosophischen Tradition einerseits und die kategorische Ablehnung der von Schopenhauer selbst vorgeschlagenen Begründung der Moral durch das Mitleid andererseits.
- Kritik an der kantischen Ethik
- Das Mitleid als ethisches Urphänomen
- Nietzsches Rezeption von Schopenhauers Ethik
- Der Antichrist und das Mitleid
- Ambivalenz gegenüber Schopenhauers Mitleidsethik
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit skizziert die argumentative Strategie, die Schopenhauer in seiner Kritik der kantischen Ethik verfolgt, sowie eine Rekonstruktion seiner Bestimmung des Mitleids als ethisches Urphänomen. Der zweite Teil stellt diese Ausführungen in ein deutliches Rezeptionsverhältnis zu der Position, die Nietzsche in seinem 1888 verfassten Werk Der Antichrist. Fluch auf das Christentum (1894) vertritt.
Schlüsselwörter
Schopenhauer, Nietzsche, Ethik, Moral, Mitleid, Kritik der kantischen Ethik, Über die Grundlage der Moral, Der Antichrist, Rezeption, Ambivalenz.
- Quote paper
- Giorgio Di Sarno (Author), 2020, Der Antichrist und das Mitleid. Über Nietzsches Rezeption von Schopenhauers Preisschrift "Über die Grundlage der Moral" in seinem "Antichrist", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899523