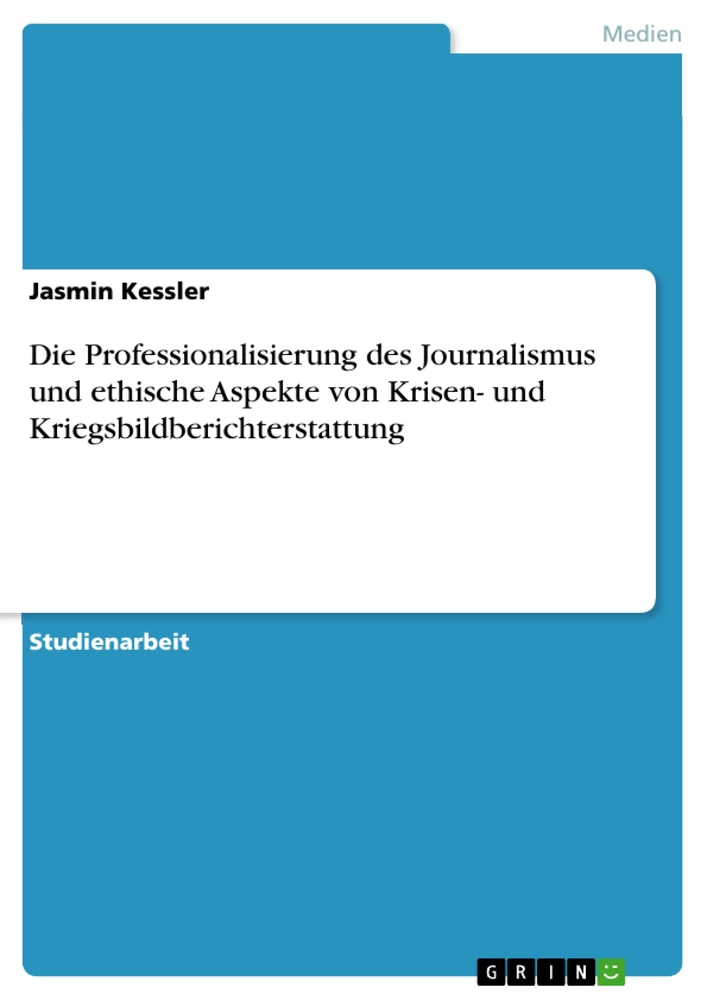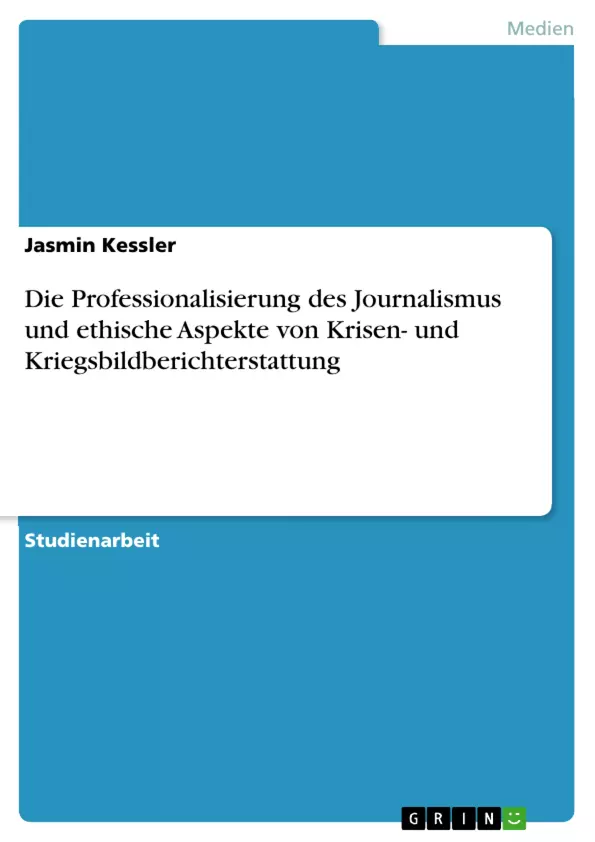Die Arbeit stellt die Professionalisierung des Journalismus von seinen Anfängen bis heute-, und ethnische Aspekte von Krisen beziehungsweise Kriegsbildberichten, anhand eines aktuellen Beispiels dar.
Zu Beginn wird daher die Begriffe Journalismus und Professionalisierung definiert. Anschließend wird die Professionalisierung in Phasen von seinen Anfängen bis heute unterteilt. Der dritte Teil setzt sich dann mit den ethischen Aspekten der Krisen- und Kriegsberichterstattung auseinander, welche beispielhaft an Christoph Bangert Kriegsfotographie dargestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Definition der Begriffe: „Journalismus“ und „Professionalisierung“
- Definition: Journalismus
- Definition: Professionalisierung
- Die Professionalisierung des Journalismus von seinen Anfängen bis heute in seinen wichtigsten Stationen
- Die Präjournalistische Phase
- Phase des Korrespondierenden Journalismus
- Phase des schriftstellerischen Journalismus
- Phase des redaktionellen & redaktionstechnischer Journalismus
- Ethische Aspekte von Krisen- bzw. Kriegsbildberichterstattung anhand eines aktuellen Beispiels.
- Literatur - und Quellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit von Frau Jasmin Kessler (TH Köln Fak. 03: Informations- und Kommunikationswissenschaften) beleuchtet die Professionalisierung des Journalismus von seinen Anfängen bis heute sowie ethische Aspekte von Krisen- bzw. Kriegsbildberichten, anhand eines aktuellen Beispiels. Die Arbeit stützt sich auf die Vorlesungen von Prof. Dr. Ingrid Scheffler und verschiedene Fachliteratur.
- Die Entwicklung des Journalismus von seinen Anfängen bis zur heutigen Zeit.
- Die Professionalisierung des Journalismus in seinen verschiedenen Phasen.
- Ethische Herausforderungen in der Berichterstattung über Krisen und Kriege.
- Analyse eines aktuellen Beispiels für die ethische Problematik der Kriegsbildberichterstattung.
- Zusammenfassende Betrachtung der ethischen Aspekte der Kriegsberichterstattung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der Hausarbeit und die verwendete Literatur einführt.
Im zweiten Kapitel werden die Begriffe „Journalismus“ und „Professionalisierung“ definiert. Die Definition des Journalismus bezieht sich auf die Verbreitung von Informationen, Meinungen und Unterhaltung.
Kapitel drei widmet sich der Professionalisierung des Journalismus. Es werden vier Phasen der Entwicklung des Journalismus aufgezeigt, beginnend mit der präjournalistischen Phase im 16. Jahrhundert.
Kapitel vier untersucht ethische Aspekte der Kriegsbildberichterstattung und analysiert ein aktuelles Beispiel. Es geht um die Frage, wie Kriegsfotografien in der Berichterstattung eingesetzt werden können, ohne die ethischen Grenzen des Journalismus zu überschreiten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind Journalismus, Professionalisierung, Kriegsberichterstattung, Ethik, Kriegsfotografie, Bildjournalismus, Aktuelles Beispiel, Christoph Bangert.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Journalismus professionalisiert?
Die Professionalisierung verlief in Phasen: vom korrespondierenden über den schriftstellerischen bis zum modernen redaktionellen Journalismus.
Welche ethischen Herausforderungen gibt es in der Kriegsberichterstattung?
Es geht um die Frage, wie grauenvolle Bilder gezeigt werden können, ohne die Würde der Opfer zu verletzen oder Sensationslust zu bedienen.
Wer ist Christoph Bangert?
Christoph Bangert ist ein Kriegsfotograf, dessen Werk in der Arbeit als aktuelles Beispiel für die ethische Problematik der Bildberichterstattung dient.
Was war die „präjournalistische Phase“?
Diese Phase im 16. Jahrhundert markiert die Anfänge der Informationsverbreitung vor der Entstehung fester Zeitungsredaktionen.
Welche Rolle spielt die Bildethik heute?
In Zeiten von Krisen- und Kriegsbildern ist die Bildethik zentral, um die Grenzen zwischen notwendiger Aufklärung und ethischer Grenzüberschreitung zu definieren.
- Quote paper
- Jasmin Kessler (Author), 2018, Die Professionalisierung des Journalismus und ethische Aspekte von Krisen- und Kriegsbildberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899583