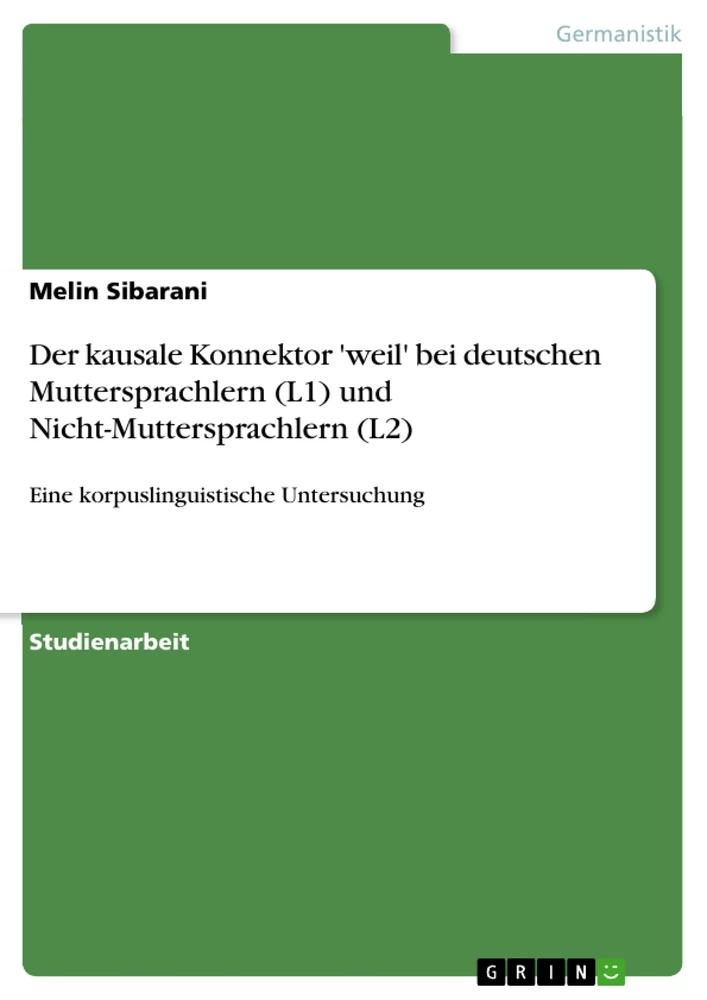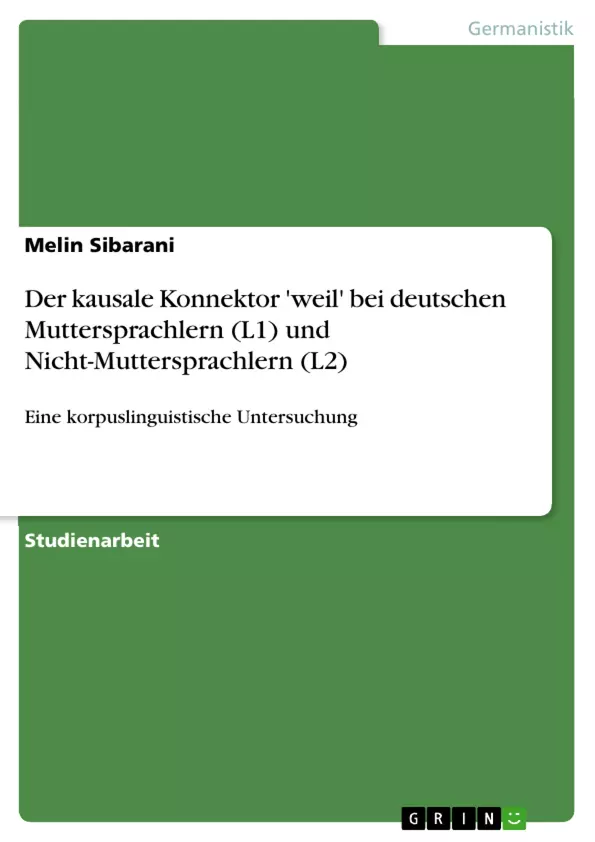Diese Hausarbeit beschäftigt sich damit, wie das Verhältnis des kausalen Konnektors 'weil' in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprachen dargestellt und wie er von Nicht-Muttersprachlern im Vergleich zu deutschen Muttersprachlern gebraucht wird. Daher konzentriert sich diese Untersuchung auf den Gebrauch von 'weil' mit Verbzweitstellung (WV2) und 'weil' mit Verbletztstellung (WVL) bei deutschen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern.
Um auf eine Analyse auszuführen, werden zunächst die Stellungsvarianten von 'weil' vorgestellt. Anschließend werden die syntaktischen und prosodischen Möglichkeiten des WV2s und WVLs erläutert. Diese Arbeit befasst sich ebenfalls mit den Interprerationsmöglichkeiten von 'weil'. Danach werden die Untersuchungs,- sowie Analysemethode der Korpora erläutert, die für die erste Zielgruppe, Muttersprachler Deutsch, aus dem Korpus DGD (Datenbank für Gesprochene Deutsch) IDS und für die zweite Zielgruppe der Nicht-Muttersprachler aus GeWiss (Gesprochene Wissenschaftssprache)-Korpus entnommen werden.
Darauffolgend wird die Analyse der Daten durchgeführt, wobei der Fokus auf der Häufigkeit des Vorkommens von WVL und WV2 und deren Lesarten in beiden Zielgruppen liegt. Schließlich werden die Ergebnisse dieser Arbeit in einem Fazit zusammenfassend veranschaulicht und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlage
- 2.1 Die Eigenschaften von weil mit Verbletzstellung (WVL) und Verbzweitstellung (WV2)
- 2.1.1 Stellungsvarianten von weil
- 2.1.2 Syntaktische Möglichkeiten von WVL und WV2 und dessen Verhältnis in DAF-Lehrwerken
- 2.1.3 Prosodische Möglichkeit von weil
- 2.1.4 Semantische Interpretation von weil
- 2.2 Weil als Diskursmarker
- 3 Methodisches Verfahren
- 3.1 Untersuchungsmethode
- 3.2 Analysemethode
- 4 Forschungsergebnisse
- 4.1 WVL und WV2 aus dem DGD Korpus: Prüfungsgespräch in der Hochschule und Feedbackgespräch unter Lehrkräften
- 4.1.1 WVL und WV2 bei L1 Sprecher im Prüfungsgespräch in der Hochschule
- 4.1.2 WVL und WV2 bei L1-Sprechern im Feedbackgespräch unter Lehrkräften
- 4.2 WVL und WV2 aus dem Ge-Wiss Korpus: Studentische Vortrag: Konstruktion am-Progressiv und Expertenvortrag: GermanC- Korpus
- 4.2.1 WVL und WV2 bei L2-Sprechern im Studentischer Vortrag: Konstruktion am-Progressiv
- 4.2.2 WVL und WV2 bei L2 Sprecher in Expertenvortrag: GermanC- Korpus
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Gebrauch des Konnektors „weil“ mit Verbzweitstellung (WV2) und Verbletztstellung (WVL) bei deutschen Muttersprachlern (L1) und Nicht-Muttersprachlern (L2). Die Zielsetzung besteht darin, das Verhältnis von WV2 und WVL in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache zu beleuchten und den Gebrauch dieser Konstruktionen in beiden Sprachgruppen zu vergleichen. Die Analyse basiert auf Korpusdaten.
- Verwendung von „weil“ mit WV2 und WVL in gesprochenem Deutsch
- Vergleich des Gebrauchs von „weil“ bei L1 und L2 Sprechern
- Syntaktische und prosodische Eigenschaften von WV2 und WVL
- „Weil“ als Diskursmarker
- Analyse von Korpusdaten (DGD und GeWiss)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Verhältnis des kausalen Konnektors „weil“ in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache und dessen Gebrauch bei L1- und L2-Sprechern vor. Sie skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit, der die Vorstellung von Stellungsvarianten, syntaktischen und prosodischen Möglichkeiten von WV2 und WVL sowie deren Interpretation umfasst. Die gewählten Korpora (DGD und GeWiss) werden vorgestellt, und der Fokus auf die Häufigkeit des Vorkommens von WVL und WV2 und deren Lesarten in beiden Zielgruppen wird angekündigt.
2 Theoretische Grundlage: Dieses Kapitel erläutert die syntaktische Variation von „weil“ mit WV2 und WVL, geht auf die prosodischen Möglichkeiten ein und erklärt die Interpretationsmöglichkeiten von „weil“ und dessen Funktion als Diskursmarker. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, ob es sich bei WV2 und WVL um zwei verschiedene Konnektoren oder um Varianten desselben Konnektors handelt, wobei die unterschiedlichen Perspektiven von Keller, Wegener und Pasch beleuchtet werden. Der Einfluss der gesprochenen Sprache auf die Verwendung von WV2 wird ebenfalls behandelt. Der Abschnitt über DaF-Lehrwerke wird angesprochen, aber die detaillierte Analyse findet im folgenden Kapitel statt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Verwendung von "weil" mit Verbzweitstellung (WV2) und Verbletzstellung (WVL)
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Gebrauch des Konnektors „weil“ mit Verbzweitstellung (WV2) und Verbletzstellung (WVL) in gesprochenem Deutsch bei deutschen Muttersprachlern (L1) und Nicht-Muttersprachlern (L2). Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Gebrauchs dieser Konstruktionen in beiden Sprachgruppen und der Analyse des Verhältnisses von WV2 und WVL in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache (DaF).
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie verhält sich der Gebrauch von „weil“ mit WV2 und WVL in DaF-Lehrwerken zum tatsächlichen Sprachgebrauch von L1- und L2-Sprechern? Nebenfragen betreffen die syntaktischen, prosodischen und semantischen Eigenschaften von WV2 und WVL sowie die Funktion von „weil“ als Diskursmarker.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von Korpusdaten aus den Korpora DGD (Deutsche Gegenwartssprache) und GeWiss. Es werden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden angewendet, um die Häufigkeit und die jeweiligen Lesarten von WVL und WV2 in den verschiedenen Sprachgruppen zu untersuchen. Die Analysemethoden werden im Kapitel 3 detailliert beschrieben.
Welche Korpora wurden verwendet?
Die Analyse basiert auf Daten aus zwei Korpora: dem DGD-Korpus (Prüfungsgespräche in der Hochschule und Feedbackgespräche unter Lehrkräften) und dem GeWiss-Korpus (Studentische Vorträge und Expertenvorträge aus dem GermanC-Korpus). Diese Korpora bieten Daten von L1- und L2-Sprechern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlage, Methodisches Verfahren, Forschungsergebnisse und Fazit. Die Einleitung stellt das Thema und die Forschungsfrage vor. Die theoretische Grundlage behandelt die syntaktischen, prosodischen und semantischen Aspekte von „weil“ mit WV2 und WVL. Das methodische Verfahren beschreibt die Vorgehensweise der Korpusanalyse. Die Forschungsergebnisse präsentieren die Ergebnisse der Korpusanalyse, und das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Das Kapitel „Theoretische Grundlage“ behandelt die syntaktische Variation von „weil“ mit WV2 und WVL, die prosodischen Möglichkeiten, die semantische Interpretation von „weil“ und dessen Funktion als Diskursmarker. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, die unterschiedlichen Perspektiven von Keller, Wegener und Pasch beleuchtet und der Einfluss der gesprochenen Sprache auf die Verwendung von WV2 behandelt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Forschungsergebnisse (Kapitel 4) präsentieren einen Vergleich des Gebrauchs von WVL und WV2 bei L1- und L2-Sprechern in den untersuchten Korpora. Die detaillierten Ergebnisse werden im Kapitel 4.1 (DGD-Korpus) und 4.2 (GeWiss-Korpus) aufgeschlüsselt, wobei jeweils zwischen L1 und L2 Sprechern unterschieden wird.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit (Kapitel 5) zieht Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Forschungsergebnissen und diskutiert die Relevanz der Ergebnisse für den DaF-Unterricht. Es wird ein Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse gegeben und der Beitrag der Arbeit zur Forschung zum Thema "weil" mit WV2 und WVL zusammengefasst.
- Quote paper
- Melin Sibarani (Author), 2019, Der kausale Konnektor 'weil' bei deutschen Muttersprachlern (L1) und Nicht-Muttersprachlern (L2), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899992