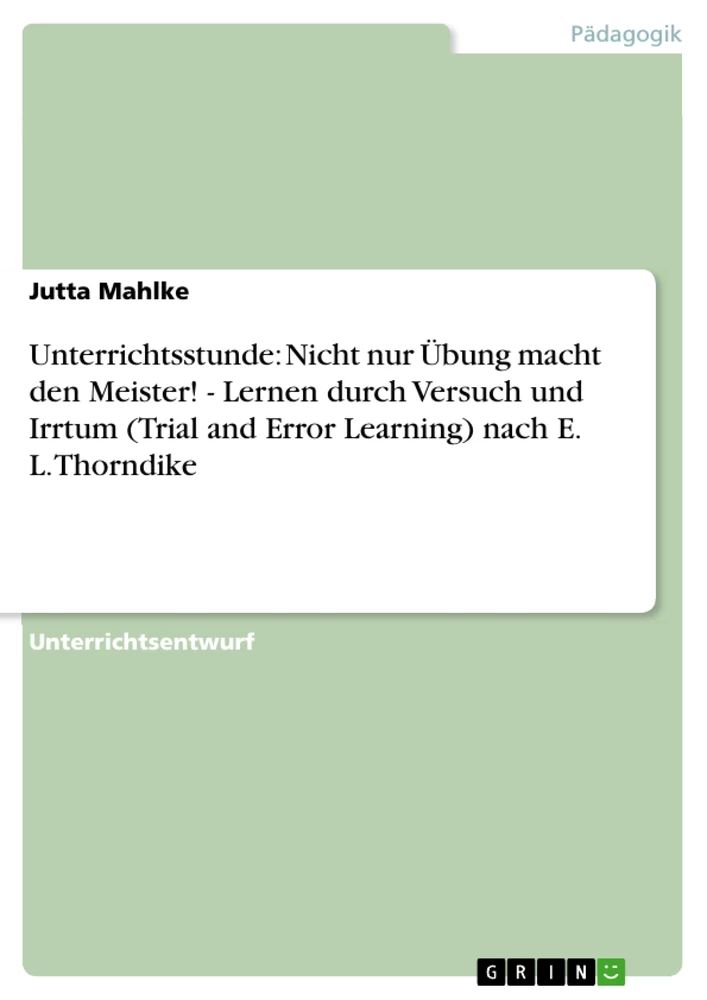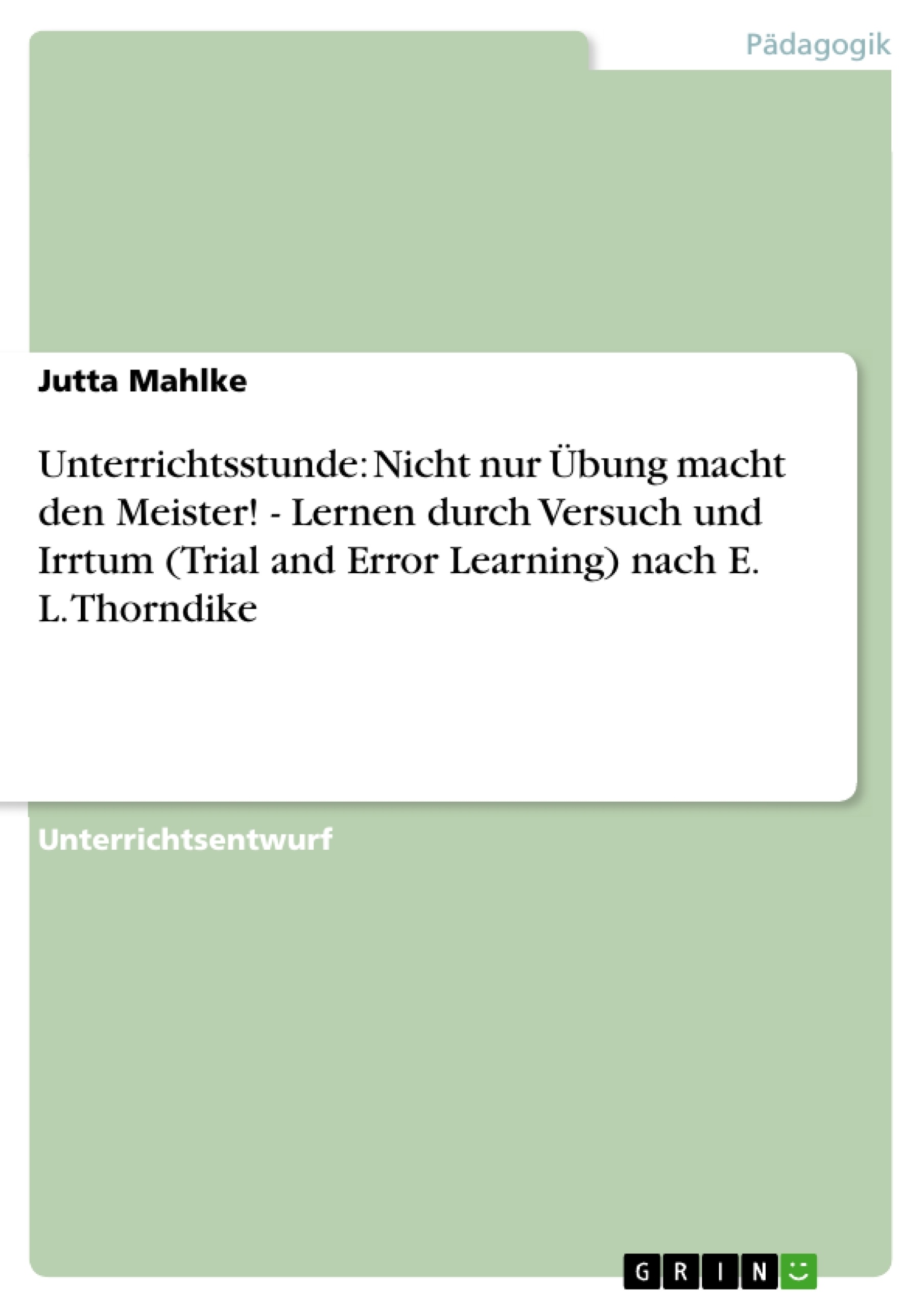Die SuS sollen das Lernen durch Versuch und Irrtum samt seiner wesentlichen Gesetzmäßigkeiten kennenlernen und seine Bedeutung für die heutige Pädagogik einschätzen können, indem sie durch das Katzenexperiment über die Gesetzmäßigkeiten des Bereitschaftsgesetzes, des Effektgesetzes und des Frequenzgesetzes auf eine angemessene Definition der neuen Lerntheorie schließen und diese ansatzweise in Erziehungssituationen erkennen.
Die SuS sollen * das Lernen durch Versuch und Irrtum (trial and error learning) kennenlernen, indem sie das Katzenexperiment anhand einer Grafik mit kurzem Begleittext entdecken und daraus deduktiv die Definition der Lerntheorie entwickeln. * die Gesetzmäßigkeiten Bereitschafts- (Law of readiness), Effekt- (law of effect) und Frequenzgesetz (law of exercise - Übung) erkennen, indem sie diese in Experiment mit Begleittext und gemeinsamer Erarbeitung anhand eines Impulsreferates erschließen, erläutern und unterscheiden können (Arbeitsblatt 1). * die Situationen „Mit Gebäck gegen Lernprobleme im alten Rom“ und „Taschengeld“ der Erziehungspraxis bezüglich der angewandten Form operanten Konditionierens interpretieren und darstellen können (Arbeitsblatt 2).* eine Erziehungssituation konstruieren und darstellen können, die der Lerntheorie nach Thorndike entspricht. Die SuS sollen ... * ... ein Bewusstsein für operantes Konditionieren entwickeln, indem sie es auch in ihrem (Schul-) Leben erkennen und mit Kindheits- und Erziehungserfahrungen zuhause, der Schule (und in der Gesellschaft) in Verbindung bringen. * bereit sein, in der kooperativen Methode THINK-PAIR SHARE als Gruppenpuzzle (jigsaw) die Erkenntnisse gemeinsam zu erarbeiten, indem jeder einzelne sie erarbeitet, partnerweise arbeitsteilig austauscht und im Plenum vorstellt oder ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
- Geplanter Verlauf der Unterrichtsreihe
- Sequenz: Entwicklung und Lernen
- Sequenz: Pädagogische Bedeutung Klassischer Konditionierung (Lernen als Reiz-Reaktionstheorie [S-R Typ (Stimulus - Response)])
- Sequenz: Pädagogische Bedeutung Operanter Konditionierung (Lernen komplexer Verhaltensweisen [R-Typ: Reinforcement])
- Ziele der Unterrichtsstunde
- Übergeordnetes Lernziel
- Wesentliche Teillernziele
- Kognitive Lernziele
- Sozial- affektive Lernziele
- Hausaufgaben
- Hausaufgaben zur Stunde:
- Hausaufgaben der Stunde:
- Geplanter Verlauf der Unterrichtsstunde
- Didaktisch – methodischer Kommentar
- Literaturliste
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, den Lernenden das Lernen durch Versuch und Irrtum (Trial and Error Learning) nach E. L. Thorndike näherzubringen. Die Schüler sollen die zentralen Prinzipien dieser Lerntheorie verstehen und deren Relevanz für die heutige Pädagogik einschätzen können.
- Lernen durch Versuch und Irrtum als Lerntheorie
- Die Gesetzmäßigkeiten des Bereitschaftsgesetzes, des Effektgesetzes und des Frequenzgesetzes
- Anwendung von operantem Konditionieren in Erziehungssituationen
- Bedeutung von Verstärkung und Belohnung im Lernprozess
- Vergleich von Trial and Error Learning mit anderen Lerntheorien
Zusammenfassung der Kapitel
Sequenz: Pädagogische Bedeutung Operanter Konditionierung (Lernen komplexer Verhaltensweisen [R-Typ: Reinforcement])
Diese Sequenz beschäftigt sich mit dem Lernen durch Versuch und Irrtum, einer Lerntheorie, die von Edward L. Thorndike entwickelt wurde. Die Schüler lernen die zentralen Prinzipien dieser Theorie kennen, darunter das Bereitschaftsgesetz, das Effektgesetz und das Frequenzgesetz. Diese Prinzipien werden anhand von Beispielen aus der Praxis erklärt und auf die Anwendung in Erziehungssituationen übertragen.
Ziele der Unterrichtsstunde
Die Stunde verfolgt das übergeordnete Lernziel, dass die Schüler das Lernen durch Versuch und Irrtum samt seiner wesentlichen Gesetzmäßigkeiten kennenlernen und dessen Bedeutung für die heutige Pädagogik einschätzen können. Dazu sollen sie durch das Katzenexperiment die Prinzipien der Bereitschafts-, Effekt- und Frequenzgesetze entdecken und diese auf eine angemessene Definition der Lerntheorie übertragen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Unterrichtsstunde sind: Lernen durch Versuch und Irrtum, Trial and Error Learning, E. L. Thorndike, Bereitschaftsgesetz, Effektgesetz, Frequenzgesetz, operantes Konditionieren, Verstärkungslernen, Erziehungssituationen, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Lernen durch Versuch und Irrtum"?
Dieses von E. L. Thorndike entwickelte Konzept besagt, dass Verhaltensweisen, die zu einem Erfolg führen, gefestigt werden, während erfolglose Versuche abnehmen.
Was besagt das Effektgesetz (Law of Effect)?
Das Effektgesetz besagt, dass Reaktionen, auf die eine angenehme Konsequenz folgt, mit höherer Wahrscheinlichkeit wiederholt werden.
Was ist das Bereitschaftsgesetz in der Lerntheorie?
Es besagt, dass Lernen nur dann effektiv stattfindet, wenn das Individuum einen inneren Antrieb oder ein Bedürfnis hat, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Was war das berühmte "Katzenexperiment" von Thorndike?
Thorndike sperrte hungrige Katzen in eine Box, aus der sie sich durch einen Mechanismus befreien mussten. Mit jedem Versuch lernten die Katzen schneller, den Mechanismus zu betätigen.
Wie lässt sich operantes Konditionieren in der Erziehung anwenden?
In der Pädagogik wird es durch gezielte Verstärkung (Belohnung) genutzt, um erwünschtes Verhalten bei Schülern oder Kindern zu fördern.
- Citar trabajo
- Jutta Mahlke (Autor), 2008, Unterrichtsstunde: Nicht nur Übung macht den Meister! - Lernen durch Versuch und Irrtum (Trial and Error Learning) nach E. L. Thorndike , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90028