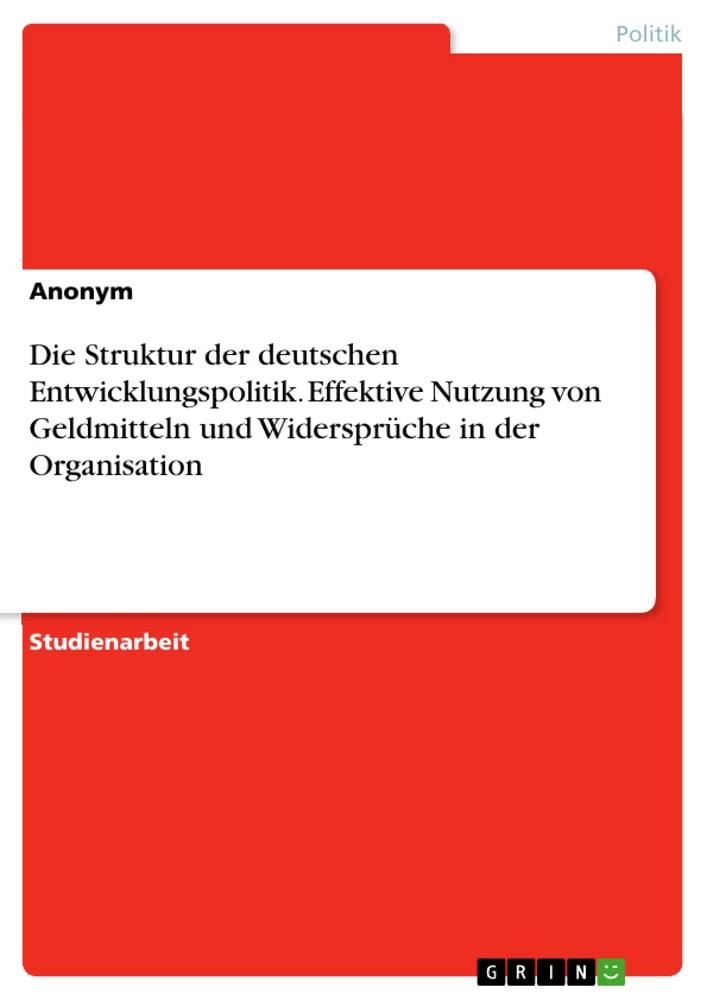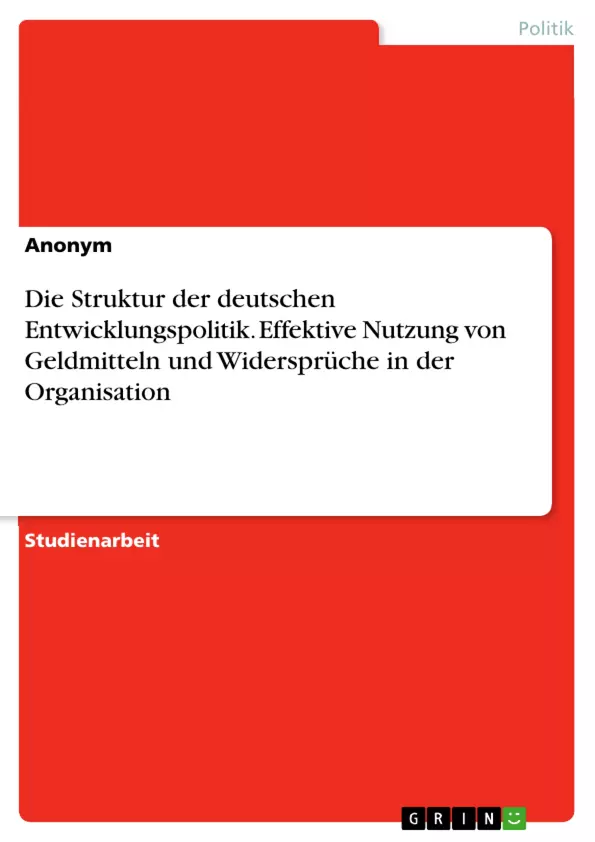In dieser Arbeit wird ein kritischer Blick auf die Struktur der deutschen Entwicklungspolitik geworfen. Dabei sollen die Fragen im Vordergrund stehen, ob die Geldmittel in der Entwicklungszusammenarbeit wirklich effektiv genutzt werden und ob es Widersprüche in der Organisation gibt.
Näher betrachtet wird dabei die politische Struktur und Organisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit von der staatlichen Behörde bis hin zum Empfänger am Beispiel Afrika, das sich hierfür gut anbietet, da dieser Kontinent immer noch als Musterbeispiel für Entwicklungsregionen gilt und vor allem, je nach Region, auch heute noch genauso wie im 20. Jahrhundert mit diversen Krisen zu kämpfen hat. Aspekte der kurzfristigen humanitären und Katastrophenhilfe werden bei der Bearbeitung nicht mitberücksichtigt, denn das Hauptaugenmerk soll auf der Bewertung der Organisation und Arbeitsweise des BMZ und seiner Partner liegen.
Zur Unterstützung wird die Betrachtung der längerfristigen Wirkungen von praktischer Entwicklungszusammenarbeit herangezogen. Um einen ersten Einblick in die Entwicklungspolitik zu bekommen, wichtige Begriffe zu klären und später richtig argumentieren zu können, wird zunächst eine Einführung in die entwicklungspolitische Theorie gegeben und dabei zwei verschiedene klassische Entwicklungstheorien vorgestellt, da die meisten Entwicklungskritiker vom Standpunkt einer solchen aus argumentieren.
Dann wird ein ausführlicher Überblick über die Instrumente der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gegeben und in deren konzeptionellen Rahmen werden ausgewählte Akteure bilateraler und multilateraler Kooperation aufgelistet. Zuletzt werden ausgehend von der erarbeiteten Struktur Kritikpunkte der deutschen Entwicklungspolitik anhand von Fallbeispielen und logischen Argumenten festgehalten.
Da es in der Forschung sehr viele verschiedene Meinungen zum Thema Entwicklung und der damit verbundenen Politik gibt, wird sich in dieser Arbeit literarisch an politikwissenschaftlichen Einführungswerken zur Entwicklungspolitik orientiert und ein eigener Begriff erarbeitet. Um einen besseren Einblick in die komplexe Struktur der Entwicklungszusammenarbeit zu erlangen, werden außerdem Statistiken und Papiere des BMZ benutzt und aktuelle Nachrichten zur Erleichterung des Sachverhaltes herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklungstheorien
- Modernisierungstheorien
- Dependenztheorien
- Instrumente deutscher Entwicklungspolitik
- Finanzielle Zusammenarbeit
- Technische Zusammenarbeit
- Zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit
- Multilaterale Zusammenarbeit
- Kritikpunkte der deutschen Entwicklungspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich kritisch mit der Struktur der deutschen Entwicklungspolitik. Sie analysiert, ob die finanziellen Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit effektiv eingesetzt werden und ob Widersprüche in der Organisation bestehen. Der Fokus liegt dabei auf der politischen Struktur und Organisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, exemplarisch dargestellt anhand des Kontinents Afrika, der als Musterbeispiel für Entwicklungsregionen gilt. Die Arbeit untersucht die längerfristigen Wirkungen der Entwicklungszusammenarbeit und bezieht dabei klassische Entwicklungstheorien ein. Zudem werden Kritikpunkte an der deutschen Entwicklungspolitik anhand von Fallbeispielen und logischen Argumenten aufgezeigt.
- Effektivität der finanziellen Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit
- Widersprüche in der Organisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
- Analyse der politischen Struktur und Organisation der Entwicklungszusammenarbeit
- Längerfristige Wirkungen der Entwicklungszusammenarbeit
- Kritikpunkte an der deutschen Entwicklungspolitik anhand von Fallbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und führt in das Thema der deutschen Entwicklungspolitik ein. Sie beleuchtet die aktuelle finanzielle Situation des BMZ und zeigt die Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit in Zeiten von Fluchtbewegungen auf. Die Einleitung hinterfragt die Effektivität der Mittelverwendung und stellt den Zusammenhang zwischen Entwicklungspolitik und wirtschaftlicher Entwicklung in den Vordergrund.
- Entwicklungstheorien: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den klassischen Entwicklungstheorien, die den Diskurs der Entwicklungspolitik seit dem Aufkommen des Merkantilismus prägen. Es werden die Modernisierungstheorien und die Dependenztheorien vorgestellt und deren Entstehung im Kontext der Kolonialgeschichte und der Dekolonisation erläutert. Die Kritik an den Modernisierungstheorien wird aufgezeigt und der Fokus auf den Zusammenhang zwischen Entwicklung und den Auswirkungen der Kolonialzeit gelegt.
- Instrumente deutscher Entwicklungspolitik: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Instrumente der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Es beschreibt die verschiedenen Formen der finanziellen, technischen, zivilgesellschaftlichen und multilateralen Zusammenarbeit. Zudem werden relevante Akteure in der bilateralen und multilateralen Kooperation aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der deutschen Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungstheorien, Modernisierungstheorien, Dependenztheorien, BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit), Afrika, Kritikpunkte der deutschen Entwicklungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was wird an der Struktur der deutschen Entwicklungspolitik kritisiert?
Die Arbeit hinterfragt die effektive Nutzung der Geldmittel und weist auf organisatorische Widersprüche zwischen staatlichen Behörden (wie dem BMZ) und den Empfängerländern hin.
Welche Rolle spielen Modernisierungs- und Dependenztheorien?
Diese klassischen Theorien bilden den Rahmen für die Argumentation von Entwicklungskritikern hinsichtlich des Einflusses der Kolonialgeschichte auf heutige Strukturen.
Warum dient Afrika als Musterbeispiel in dieser Arbeit?
Afrika gilt als klassische Entwicklungsregion, in der die langfristigen Wirkungen praktischer Entwicklungszusammenarbeit und die dortigen Krisen besonders gut analysiert werden können.
Was ist der Unterschied zwischen finanzieller und technischer Zusammenarbeit?
Finanzielle Zusammenarbeit bezieht sich auf Geldmittel für Projekte, während technische Zusammenarbeit den Transfer von Know-how und Fachkräften zur Selbsthilfe umfasst.
Berücksichtigt die Arbeit auch kurzfristige Katastrophenhilfe?
Nein, Aspekte der humanitären Soforthilfe werden bewusst ausgeklammert, da das Hauptaugenmerk auf der langfristigen Organisation und Arbeitsweise des BMZ liegt.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Die Struktur der deutschen Entwicklungspolitik. Effektive Nutzung von Geldmitteln und Widersprüche in der Organisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/900348