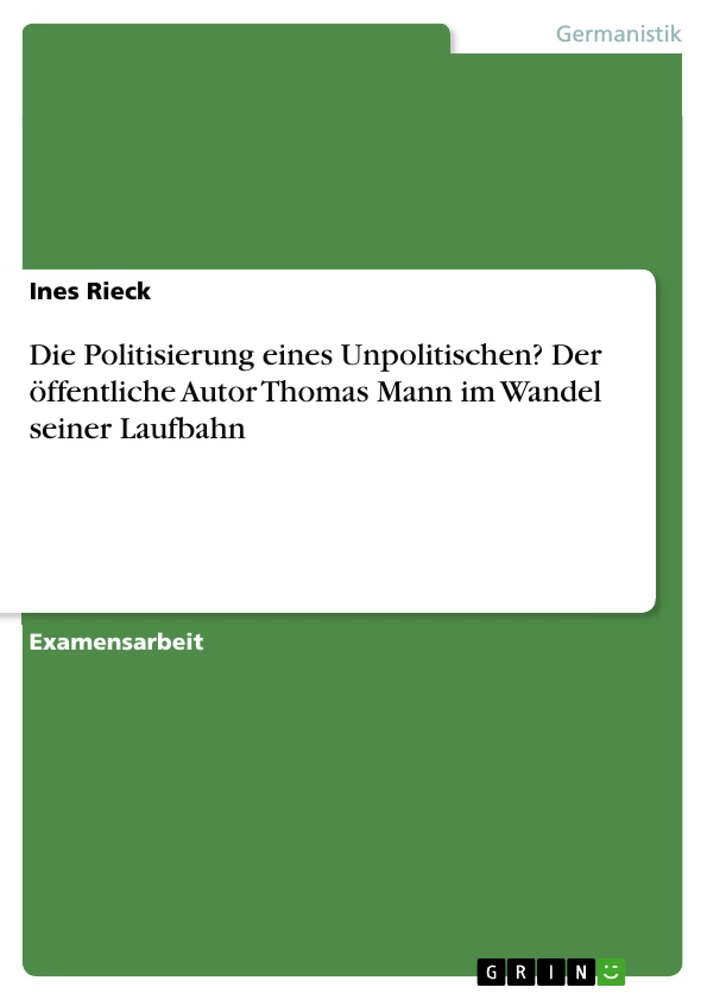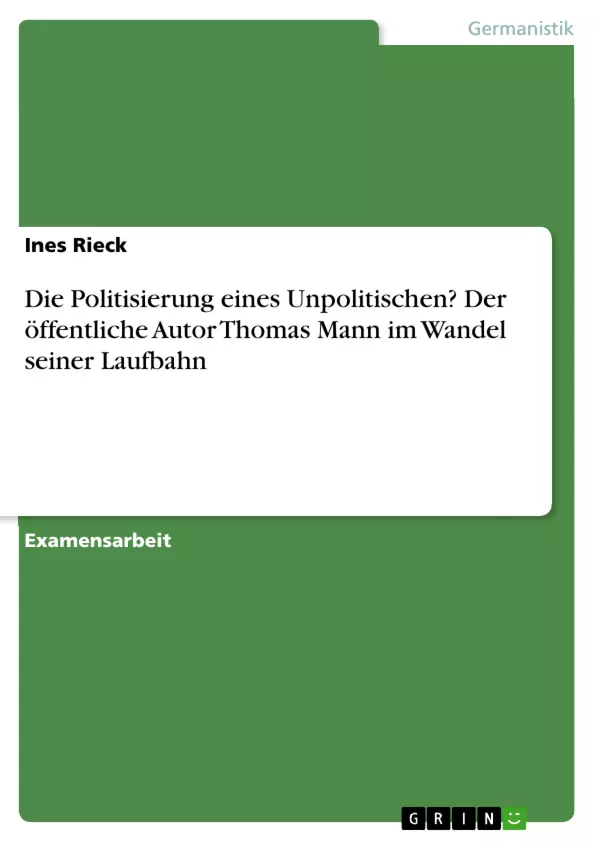Thomas Mann ist wohl einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller unserer Zeit. Jedoch sind es meist nur seine Romane oder Novellen, die bei Literaten und Laien Anklang finden und hauptsächlich in der Wissenschaft diskutiert und interpretiert werden. Dabei stellen diese im Vergleich zu seinen politischen Aufsätze, Reden und Ansprachen nur einen geringen Teil seines gesamten Lebenswerks dar.
Einen Klassiker wie Thomas Mann als politischen Denker einzuordnen, fällt vielen heutzutage noch schwer. Viel lieber sieht man den Verfasser der „Buddenbrooks“ als Sohn des 19. Jahrhunderts und damit als einen Repräsentanten des unpolitischen Bürgertums. Diese Ansicht ist auch nicht ganz von der Hand zuweisen, nennt er sich doch selbst immer wieder gerne einen „Unpolitischen“ und das nicht nur in seinen „Betrachtungen“, sondern auch in seinen Tagebüchern und Briefen.
Kann man, nachdem man den Lebensweg Thomas Manns verfolgt, ihn für einen „Unpolitischen“ halten? Hat nicht die Geschichte aus ihm einen „Politischen“ geformt? Auch wenn er sich gerne der politischen Welt entziehen wollte, wurde er nicht von den geschichtlichen Ereignissen so stark bedrängt, dass er als bedeutender Schriftsteller Stellung beziehen musste? Haben sein politisches Engagement, seine zeitkritische Wachheit und seine Präsenz in der Öffentlichkeit ihn nicht erst zum Repräsentanten Deutschlands gemacht?
Diese Fragen soll die nun folgende Arbeit klären. Dafür wird zunächst einmal kurz auf Pierre Bourdieus Feldbegriff als theoretische Grundlage eingegangen. Anschließend folgt die chronologische Untersuchung ausgewählter Reden und Essays Thomas Manns, in denen er sich in politischen Krisen positioniert. Beginnend beim Ersten Weltkrieg, über die Weimarer Republik, den Zweiten Weltkrieg bis hin zur Nachkriegszeit soll damit sein Verhalten beleuchtet werden. Dabei steht neben der eigenen Sichtweise Thomas Manns auch das Bild, welches die Öffentlichkeit von ihm hatte, im Mittelpunkt. Abschließend wird zusammenfassend das Ergebnis der Fragestellung erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Theoretische Grundlagen: Pierre Bourdieu – Einige Allgemeine Eigenschaften der Felder kultureller Produktion
- 2. Thomas Manns Positionierung in politischen Krisen
- 2.1. Die Zeit des Ersten Weltkrieges
- 2.1.1. Vor dem Ersten Weltkrieg - Der Eintritt ins literarische Feld
- 2.1.2. Der Kriegsausbruch
- 2.1.3. Die Betrachtungen eines Unpolitischen
- 2.1.4. Thomas Manns Bild in der Öffentlichkeit zur Zeit des Ersten Weltkrieges
- 2.1.5. Zusammenfassende Betrachtung
- 2.2. Die Weimarer Republik
- 2.2.1. Zeit der Umorientierung
- 2.2.2. Der Vernunftrepublikaner
- 2.2.3. Kampf dem Faschismus
- 2.2.4. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf Thomas Manns Wandel
- 2.2.5. Zusammenfassende Betrachtung
- 2.3. Die Zeit des Zweiten Weltkrieges
- 2.3.1. Das ungewollte Exil
- 2.3.2. Der bekennende Emigrant
- 2.3.3. Die ruhmreiche Phase als „Repräsentant des anderen Deutschlands“
- 2.3.4. Thomas Manns Engagement aus Sicht der Fremdperspektive
- 2.3.5. Zusammenfassende Betrachtung
- 2.4. Die Nachkriegszeit
- 2.4.1. Rückzug aus der Politik
- 2.4.2. Der Deuter des deutschen Sonderwegs
- 2.4.3. Die Auseinandersetzung mit der „inneren Emigration“
- 2.4.4. Schritte der Annäherung
- 2.4.5. Zusammenfassende Betrachtung
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Der Wandel von Thomas Manns politischem Selbstbild
- Die Einordnung von Thomas Manns Schriften und Reden im Kontext seiner Zeit
- Das Spannungsverhältnis zwischen Manns Werk und seinen politischen Positionierungen
- Die Rezeption Thomas Manns in der Öffentlichkeit
- Die Bedeutung des „Unpolitischen“ im Werk von Thomas Mann
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung des öffentlichen Bildes Thomas Manns im Kontext seiner politischen Positionierungen. Sie analysiert, wie sich Manns Rolle als Autor und Intellektueller in verschiedenen politischen Krisen – vom Ersten Weltkrieg über die Weimarer Republik bis hin zur Nachkriegszeit – gewandelt hat. Die Arbeit untersucht dabei, inwiefern Manns Selbstverständnis als „Unpolitischer“ mit seinen tatsächlichen politischen Engagements in Einklang steht.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es auf den Feldbegriff von Pierre Bourdieu eingeht und dessen Relevanz für die Analyse von kultureller Produktion und des literarischen Feldes aufzeigt. Die folgenden Kapitel befassen sich chronologisch mit Thomas Manns politischem Engagement in verschiedenen Epochen. So werden in Kapitel 2.1. seine Positionierung im Ersten Weltkrieg, insbesondere die Entstehung seiner kontroversen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ sowie dessen Rezeption in der Öffentlichkeit, analysiert. In Kapitel 2.2. wird die Entwicklung Thomas Manns zum „Vernunftrepublikaner“ in der Weimarer Republik thematisiert, während Kapitel 2.3. die Zeit des Zweiten Weltkriegs und Manns Engagement im Exil beleuchtet. Kapitel 2.4. schließlich untersucht die Nachkriegszeit und Manns schwierige Beziehung zum wiedervereinten Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf den öffentlichen Autor Thomas Mann, dessen politisches Engagement, die Felder kultureller Produktion, den Feldbegriff von Pierre Bourdieu, den Wandel von Thomas Manns Selbstverständnis, die politische Rezeption seiner Werke und die Bedeutung des „Unpolitischen“ im Kontext der deutschen Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
War Thomas Mann wirklich ein "unpolitischer" Autor?
Obwohl sich Mann oft selbst als "Unpolitischen" bezeichnete, zeigt die Arbeit, dass er durch geschichtliche Ereignisse zunehmend zur politischen Stellungnahme gezwungen wurde und sich zum Repräsentanten des "anderen Deutschlands" entwickelte.
Welche Rolle spielen die "Betrachtungen eines Unpolitischen" in seinem Werk?
Dieses Werk aus der Zeit des Ersten Weltkriegs markiert seinen Standpunkt als Verteidiger des deutschen Bürgertums gegen westliche Demokratievorstellungen, bevor sein späterer Wandel einsetzte.
Wie wandelte sich Thomas Manns politische Haltung in der Weimarer Republik?
Er entwickelte sich zum "Vernunftrepublikaner", der aktiv gegen den aufkommenden Faschismus kämpfte und die demokratische Ordnung verteidigte.
Welche theoretische Grundlage nutzt die Arbeit zur Analyse?
Die Arbeit basiert auf Pierre Bourdieus Feldbegriff, um Thomas Manns Positionierung im literarischen und politischen Feld kultureller Produktion zu untersuchen.
Wie wurde Thomas Manns Exil während des Zweiten Weltkriegs wahrgenommen?
Er wurde in dieser Phase weltweit als der maßgebliche Repräsentant des deutschen Geistes im Widerstand gegen den Nationalsozialismus anerkannt.
Wie verhielt sich Thomas Mann zur deutschen Politik nach 1945?
In der Nachkriegszeit zog er sich teilweise aus der direkten Politik zurück, blieb aber ein kritischer Beobachter des "deutschen Sonderwegs" und setzte sich mit der "inneren Emigration" auseinander.
- Arbeit zitieren
- Ines Rieck (Autor:in), 2006, Die Politisierung eines Unpolitischen? Der öffentliche Autor Thomas Mann im Wandel seiner Laufbahn, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90067