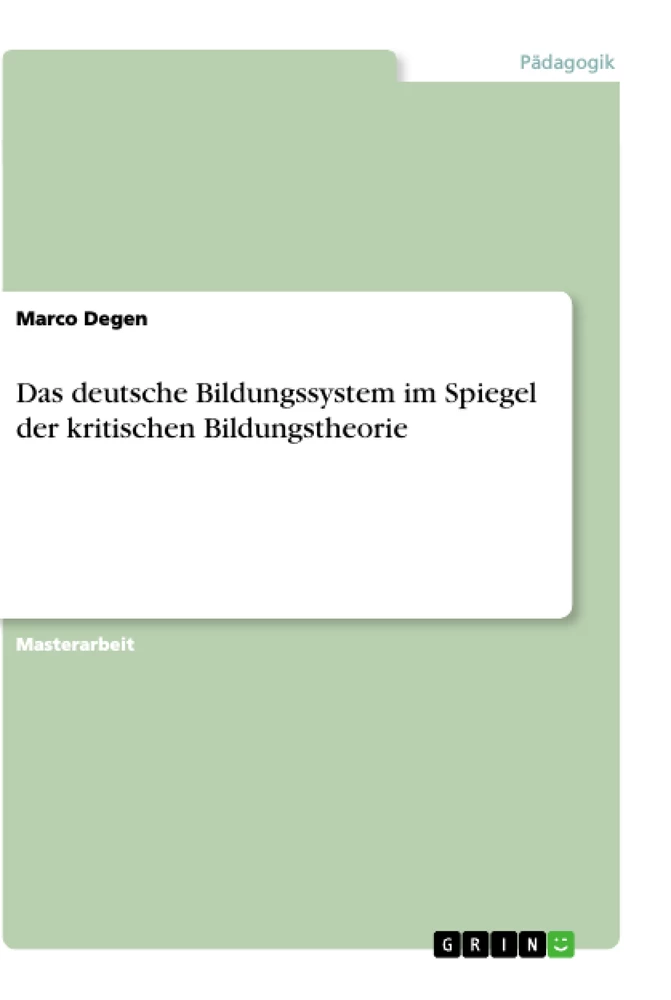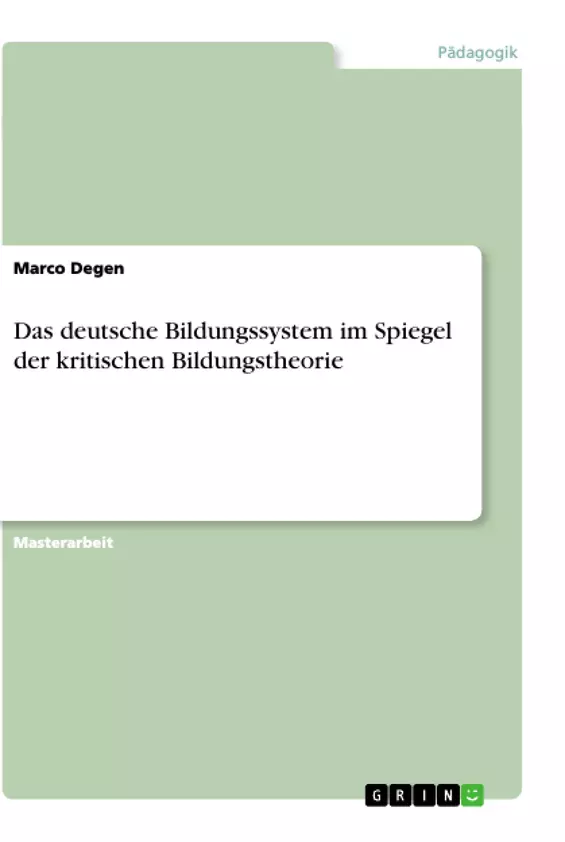In dieser Arbeit soll betrachtet werden, inwieweit die Bildungsinstitutionen, und die in diesen vermittelten Inhalte, zum einen die Mündigkeit der Schüler*innen (SuS) in den Blick nimmt, und zum anderen, ob das institutionelle Bildungssystem den Ansprüchen an Bildung gerecht werden kann. Hierbei handelt es sich um eine Betrachtungsweise, die sich an der kritischen Bildungstheorie Heinz Joachim Heydorns (1916-1974) ausrichten wird. Diese wurde für die Betrachtung bewusst ausgewählt, da die Theorie Heydorns sowohl die Bildungsinstitutionen und -inhalte aufnimmt und betrachtet, als auch innerhalb ihrer Form immer wieder auf die jeweils aktuelle gesellschaftliche Situation angewandt werden kann. Ebenso wesentlich ist das Denken in Widersprüchen, welches die Theorie von Heydorn durchzieht, und das innerhalb seiner Werke ausführlich und logisch aufgebaut wird.
Bildungsreformen, Kompetenzerwerb, Ökonomisierung der Bildung. All das sind Schlagworte, die im Rahmen der Diskussion um Bildung und Schule fallen. Ausgehend vom sog. PISA-Schock im Jahr 2000 und der damit verbundenen Erkenntnis, dass andere Länder im Vergleich offensichtlich eher ihre Schülerinnen und Schüler dazu befähigen konnten, die Tests innerhalb der PISA Studien erfolgreich zu bewältigen, wurde in Deutschland eine erneute Debatte um den Aufbau des Schulsystems, sowie die Inhalte und die Vermittlung dieser in den Schulen angestoßen. Nach Einführung einiger Veränderungen sind die kritischen Stimmen gegenüber dem Bildungssystem allerdings nicht leiser geworden oder gar verstummt. Im Gegenteil dazu wurden kritische Stimmen laut, die von einer Ökonomisierung der Bildung sprechen. Der Kern der Kritik besteht darin, dass die Intention von Bildung, im Resultat die Mündigkeit der Schüler*innen, nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern nur die Verwertung dieser im gesellschaftlichen Kontext, gemessen anhand der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entwicklung der widersprüchlichen Tendenzen
- 2.1 Die Antike als Ausgangspunkt
- 2.2 Die Dialektik bei Immanuel Kant
- 2.3 Die Dialektik bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- 2.4 Die materialistisch-dialektische Gesellschafts-Theorie von Karl-Marx
- 2.5 Exkurs: Wilhelm von Humboldt
- 3. Die kritische Bildungstheorie Heydorns
- 3.1 Der Widerspruch bei Heinz Joachim Heydorn
- 3.2 Kategoriale Bestimmungen des Widerspruchs
- 3.2.1 Die Kohärenz zwischen materialer und formaler Bildung
- 3.2.2 Das Bewusstsein des Menschen
- 3.2.3 Mündigkeit durch Rationalität
- 3.3 Die Fusion der Begriffe
- 3.4 Zusammenfassung zur kritischen Bildungstheorie
- 4. Das Bildungssystem in Deutschland
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Geschichte des Bildungswesens in Deutschland
- 4.3 Strukturierungen des Schulwesens
- 4.4 Steuerung des Bildungswesens
- 4.4.1 Von der Input- zur Outputsteuerung
- 4.4.2 Bildungsstandards und Kompetenzen
- 5. Politische Bildung in der Schule
- 5.1 politdidaktische Entwicklungen
- 5.2 Der bildungspolitische Rahmen der Politischen Bildung
- 5.2.1 bildungspolitische Rahmenbedingungen
- 5.2.2 Standards und Kompetenzen der Politischen Bildung
- 5.3 kritische Politische Bildung
- 5.3.1 allgemeine Anmerkungen zur kritischen Politischen Bildung
- 5.3.2 Positionierung
- 6. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Übereinstimmung des deutschen Bildungssystems mit den Prinzipien der kritischen Bildungstheorie Heinz Joachim Heydorns, insbesondere im Kontext des Unterrichtsfachs Politik. Sie analysiert, inwieweit die Bildungsinstitutionen und -inhalte die Mündigkeit von Schülerinnen und Schülern fördern und ob das bestehende System den Anforderungen an Bildung gerecht wird.
- Die Entwicklung des Bildungssystems in Deutschland im Kontext gesellschaftlicher und bildungspolitischer Veränderungen.
- Die kritische Bildungstheorie von Heinz Joachim Heydorn und ihre zentralen Elemente, wie der Widerspruch und die Mündigkeit.
- Die Rolle des Unterrichtsfachs Politik im Rahmen der kritischen Bildungstheorie und die Analyse seiner Relevanz für die Förderung von Mündigkeit.
- Die Herausforderungen und Chancen der aktuellen Bildungspolitik im Hinblick auf die Umsetzung kritischer Bildungsprinzipien.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und der Herausstellung der aktuellen Debatte um Bildung und Schule. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs des Widerspruchs von der Antike bis zu Karl Marx und diskutiert die Rolle von Wilhelm von Humboldt im Hinblick auf Bildung. Kapitel 3 konzentriert sich auf die kritische Bildungstheorie von Heinz Joachim Heydorn, insbesondere auf seine Definition des Widerspruchs und die damit verbundenen kategorialen Bestimmungen. Kapitel 4 befasst sich mit dem deutschen Bildungssystem, seiner Geschichte, Struktur und Steuerung, einschließlich der Entwicklung von Bildungsstandards und Kompetenzen. Kapitel 5 analysiert die Entwicklungen der politischen Bildung in der Schule, die bildungspolitischen Rahmenbedingungen und die Bedeutung kritischer politischer Bildung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen kritische Bildungstheorie, Mündigkeit, Widersprüche, Bildungssystem in Deutschland, politische Bildung, Bildungsstandards, Kompetenzen, Outputsteuerung, Heinz Joachim Heydorn.
- Quote paper
- Marco Degen (Author), 2019, Das deutsche Bildungssystem im Spiegel der kritischen Bildungstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/900979