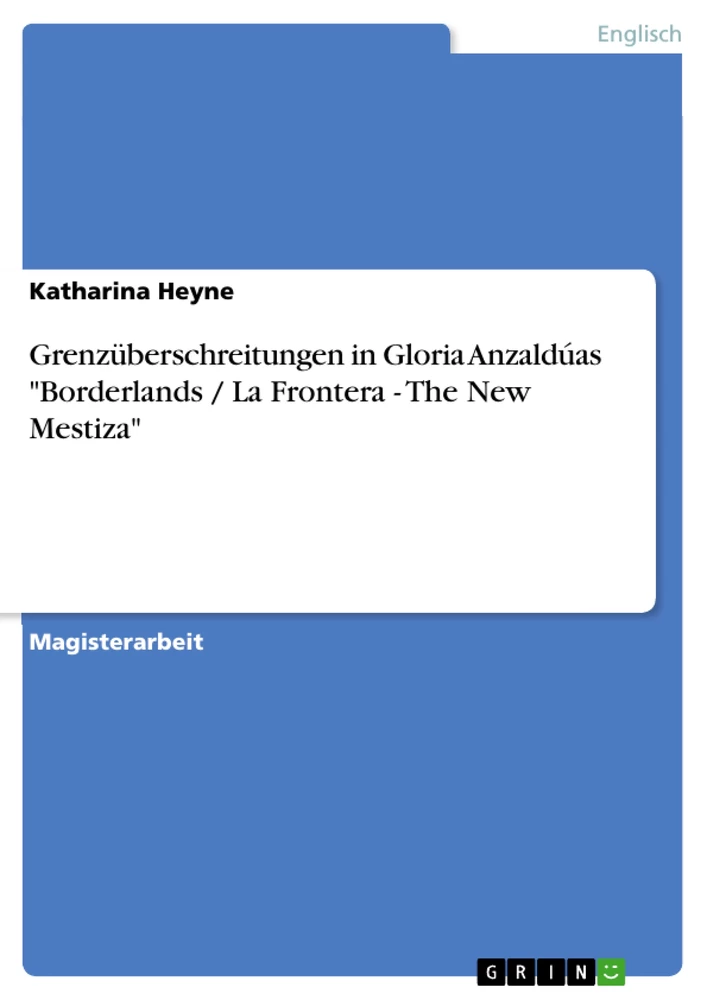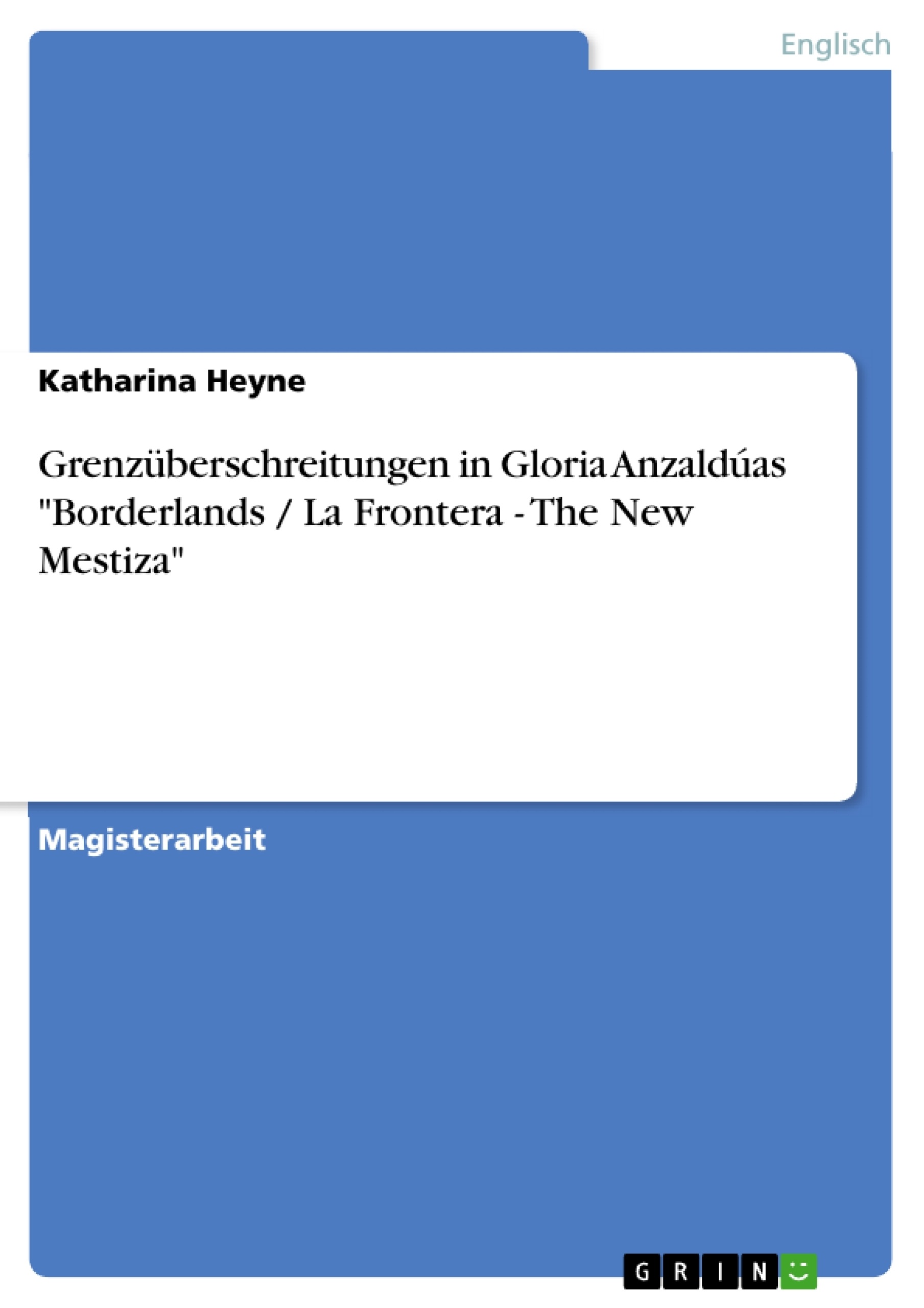Warum schreibt jemand seine Autobiographie? Welche Ziele verfolgt er wohl dabei? Im Vordergrund steht sicherlich der Wunsch, sich seiner Umwelt aus seiner eigenen Sicht zu präsentieren, um ein möglichst authentisches Bild von sich zu liefern. [...]
Gloria Anzaldúa hebt sich mit ihrem Buch „Borderlands / La Frontera – The New Mestiza“1 von vielen anderen Autobiographen ab. So beschreibt sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Familie und ihrer ethnischen Gruppe. Hierbei geht sie historisch sehr weit zurück bis zu den Ursprüngen ihrer ethnischen Gruppe, den Azteken. Zudem wählt sie eine neue Literaturform, indem sie nicht einfach ihr Leben niederschreibt, sondern zunächst eine Darstellung in Form von Prosa vornimmt, dem sich ein zweiter Teil in Form von Gedichten anschließt. Der erste Teil dieser Arbeit wird sich also mit der Gattung der Autobiographie befassen, wobei ich die verschiedenen Ausprägungen darstellen möchte, um später erörtern zu können, in welcher literarischen Tradition Anzaldúa letztlich steht. Dazu werde ich auch auf die Chicana-Literatur eingehen, welche eine eigene Gattung im Kanon der US-amerikanischen Literatur darstellt. Dem schließt sich dann eine eingehende Analyse von Borderlands an, in der ich auf die diversen Grenzen (literarische, spirituelle, sexuelle, sprachliche Grenzen), die Anzaldúa in ihrem Werk überschreitet eingehen werde. Um Anzaldúas Vorgehen anschaulicher nachvollziehen zu können, werde ich bei meiner Analyse noch auf andere Chicana- bzw. Latina-Autorinnen eingehen, die die entsprechenden Themen in ihren Werken verarbeitet haben und versuchen Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- II. Autobiographie
- 1. Definition und Abgrenzung zu verwandten Gattungen
- 2. Historische Entwicklung der Autobiographie
- 2.1. Religiöse Autobiographien
- 2.1.1. Frühe christliche Autobiographien
- 2.1.2. Jeremiade
- 2.1.3. Spiritual Autobiography
- 2.2. Weltliche Autobiographien
- 2.2.1. Persona: Charakter und Personalität
- 2.2.2. Persona als Form der Selbstpräsentation
- 2.3. Autobiographien ethnischer Minoritäten
- 2.3.1. Slave narrative
- 2.3.2. Testimonio-Literatur
- 1. Indianische Literatur
- III. Chicano / Chicana-Literatur in den USA
- 2. Interkulturalität als Aspekt zum Umgang mit Chicana-Literatur
- 3. Chicana-Literatur und Postkolonialismus
- 4. Women-of-Color-Feminismus
- 5. Mestizaje und Hybridität
- IV. Anzaldúas Borderlands / La Frontera - The New Mestiza
- 1. Literarische Grenzüberschreitungen in Borderlands
- 1.1. Borderlands in der Tradition der amerikanischen Autobiographie
- 1.2. Borderlands als Geschichtsrekonstruktion
- 1.2.1. Kulturelles Gedächtnis
- 1.2.2. Mythos und Geschichte: die Heimat Aztlán
- 1.2.3. Literarische Grenzgänge: Literatur und Geschichtsschreibung
- 2. Spirituelle Grenzüberschreitungen
- 2.1. Der religiöse Mythos der präkolumbischen Gottheit Coatlicue
- 2.2. Der indigene Mythos: La Malinche (La Chingada)
- 2.2.1. Die Darstellung von La Malinche in Borderlands
- 2.2.2. Die Darstellung von La Malinche bei Carmen Tafolla
- 2.3. Der religiöse Mythos: La Virgen de Guadalupe - Die Jungfrau von Guadalupe
- 2.3.1. La Virgen de Guadalupe in Sandra Cisneros” “Guadalupe the Sex Goddess”
- 2.3.2. La Virgen de Guadalupe als 'Coatlalopeuh' in Borderlands
- 1.3. Der indigene Mythos von La Llorona
- 3. Sexuelle Grenzüberschreitungen
- 3.1. Sexualität in Borderlands
- 3.2. Die Darstellung der Schlange als Metapher für weibliche Sexualität
- 3.3. Sexuelle Unterdrückung und Erniedrigung in „Immaculate, Inviolate: Como Ella“
- 4. Sprachliche Grenzüberschreitungen
- 4.1. Die Verarbeitung der sprachlichen Grenzen in Sandra Cisneros „, The House on Mango Street\".
- 4.2. Die Verarbeitung der sprachlichen Grenzen in Borderlands
- 4.3. Spanisch als die Sprache der Intimität
- 4.3.1. Cristina Garcías,,Soñar en Cubano\".
- 4.3.2. Anzaldúas „Compañera, cuando amábamos“
- 4.4. Code-Switching
- Die literarische Grenzüberschreitung in der Tradition der amerikanischen Autobiographie.
- Die Konstruktion von Geschichte und Identität durch den Mythos.
- Die Auseinandersetzung mit den spirituellen und religiösen Mythen der Chicana-Kultur.
- Die Darstellung von sexueller Unterdrückung und Erniedrigung.
- Die Verarbeitung der sprachlichen Grenzen und die Rolle der Mehrsprachigkeit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Gloria Anzaldúas „Borderlands/La Frontera - The New Mestiza“ als eine literarische Auseinandersetzung mit der Grenzüberschreitung in unterschiedlichen Lebensbereichen. Die Autorin fokussiert hierbei auf die Erfahrungen der Chicana-Kultur und ihre Suche nach einer neuen Identität an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko.
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel der Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Autobiographie und ihrer historischen Entwicklung. Es werden verschiedene Gattungen wie die religiöse und weltliche Autobiographie sowie die Autobiographien ethnischer Minderheiten beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der Chicano / Chicana-Literatur in den USA und analysiert Aspekte wie Interkulturalität, Postkolonialismus, Women-of-Color-Feminismus und Mestizaje. Im vierten Kapitel wird Anzaldúas „Borderlands/La Frontera - The New Mestiza“ als literarische Grenzüberschreitung untersucht. Es werden verschiedene Facetten der Grenzüberschreitung beleuchtet, darunter die literarische und historische Grenzüberschreitung, die spirituellen und religiösen Grenzüberschreitungen sowie die sexuellen und sprachlichen Grenzüberschreitungen.
Schlüsselwörter
Autobiographie, Chicana-Literatur, Borderlands, Grenzüberschreitung, Identität, Mythos, Geschichte, Spiritualität, Sexualität, Sprache, Mehrsprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Gloria Anzaldúas "Borderlands"?
Es verbindet Autobiographie mit Geschichte und Mythen der Azteken und nutzt eine innovative Form aus Prosa und Gedichten, um die Chicana-Erfahrung darzustellen.
Welche Grenzen werden in dem Werk überschritten?
Anzaldúa thematisiert literarische, spirituelle, sexuelle und sprachliche Grenzüberschreitungen (z. B. durch Code-Switching zwischen Englisch und Spanisch).
Was bedeutet der Begriff "Mestizaje"?
Er beschreibt die kulturelle und ethnische Vermischung und die daraus resultierende hybride Identität, die sich an der Grenze zwischen den USA und Mexiko entwickelt.
Welche Rolle spielen Mythen wie "La Malinche"?
Anzaldúa nutzt indigene Mythen, um die Geschichte der Chicanas zu rekonstruieren und weibliche Identität jenseits kolonialer oder patriarchaler Deutungen zu definieren.
Was ist Women-of-Color-Feminismus?
Ein feministischer Ansatz, der die spezifischen Erfahrungen von Frauen ethnischer Minderheiten einbezieht, die gleichzeitig von Sexismus und Rassismus betroffen sind.
- Quote paper
- Katharina Heyne (Author), 2007, Grenzüberschreitungen in Gloria Anzaldúas "Borderlands / La Frontera - The New Mestiza", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90137