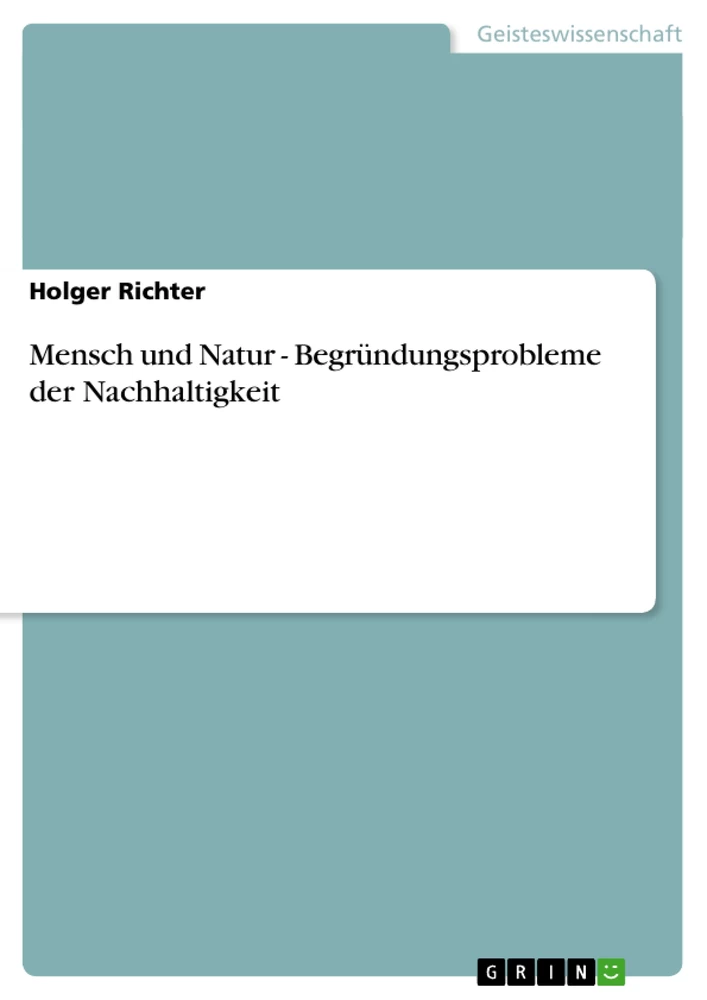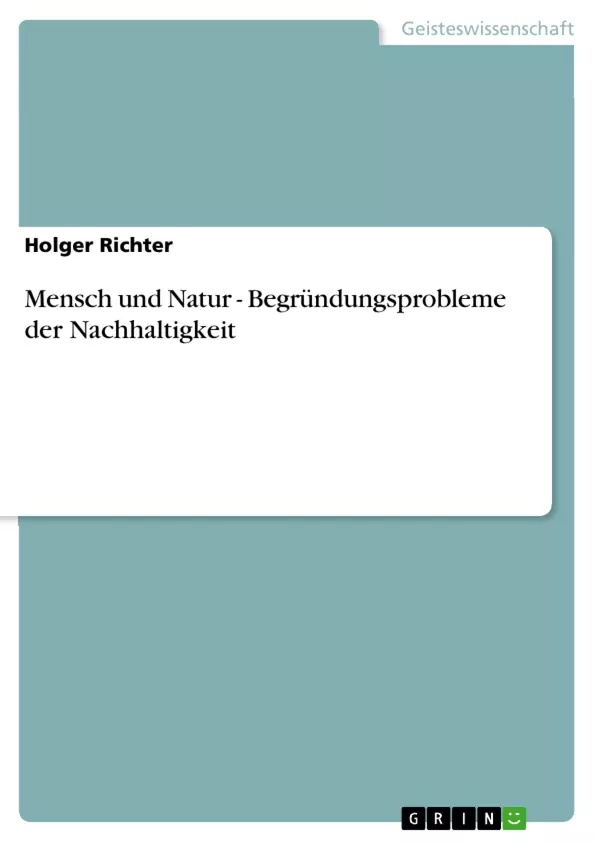Der normativ richtige oder moralisch verantwortbare Umgang mit der äußeren, nichtmenschlichen Natur ist Gegenstand der relativ neuen Disziplin der Umweltethik ( oder ökologische Ethik ) als ethische Teildisziplin der Bioethik.
Kommt es auf die Natur selbst oder auf ihre Funktionen für den Menschen an? Was ist der Mensch im Ganzen der Natur, was zeichnet ihn aus, was steht ihm zu, was hat er mit dem Anderem und Anderen gemeinsam? Menschliches Handeln ist immer Ausdruck eines impliziten oder expliziten Selbstverständnisses des Handelnden, jede Ethik hat anthropologische Voraussetzungen, die auf diesen Annahmen beruhen. Die zentrale Frage ist die des Eigenwertes der nichtmenschlichen Natur. Hat die außermenschliche Natur einen intrinsischen Wert, ist sie um ihrer selbst willen moralisch zu berücksichtigen, umfasst dies die gesamte Natur oder nur Teile davon und wie weit geht jeweils das Ausmaß dieser moralischen Berücksichtigung?
Oder ist die Natur nur um des Menschen und seiner Interessen willens von moralischer Bedeutung, relevant nur für das rationale Klugheitsgebot, die Nutzung der verfügbaren Ressourcen ( einschließlich der „ökologischen Belastungsspielräume“) so weit zu zügeln, dass unsere eigenen Lebensgrundlagen unbeeinträchtigt bleiben bis hin zu der langfristigen (altruistischen) Dimension, die Interessen zukünftiger Generationen, vorbehaltlich unseres eigenen begrenzten prognostischen Wissens, in gleicher Weise zu berücksichtigen wie unsere Interessen in der Gegenwart?
Wie weit können natürliche Ressourcen als durch produzierte Ressourcen ersetzbar gelten oder sind sie prinzipiell unersetzbar? Die Kontroversen zwischen schwacher und starker Nachhaltigkeit bzw. deren Kompromisslinien beruhen auf einem Dissens über die normativen Grundlagen des Naturerhalts, ausgehend von der Frage, ob alles Seiende einen intrinsischen Wert und wenn ja, einen gleichen oder abgestuft ungleichen Wert besitzt. Wir brauchen, mit H. Jonas gesprochen „etwas Neues in der Ethik“ - und zwar etwas, das sie von der Ökologie lernt. Es genügt nicht mehr, eine Ethik der Intersubjektivität, eine Ethik des zwischenmenschlichen Handelns zu haben, wir müssen die Natur in die Ethik einbeziehen, weil wir aus der Ökologie etwas über die Verletzlichkeit der Natur gelernt haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Begründungsprobleme der Nachhaltigkeit
- 3. Kriterien für den Umgang mit Unwissenheit und Unsicherheit
- 4. Grenzen der Forschung, wissenschaftlichen Machbarkeit und technischen Umsetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Begründungsprobleme der Nachhaltigkeit im Kontext globaler ökologischer Herausforderungen. Sie analysiert die ethischen Implikationen des menschlichen Handelns auf die Natur und die Notwendigkeit einer neuen ethischen Fundierung im Umgang mit Technik und Natur. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten der Zukunftsprognose und deren Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung im Bereich des Umweltschutzes.
- Ethische Herausforderungen der Nachhaltigkeit
- Generationengerechtigkeit und Diskontierung zukünftiger Kosten
- Umgang mit Unsicherheit und Unwissenheit in der Zukunftsprognose
- Grenzensetzung in Forschung, Wissenschaft und Technik
- Eigenwert der nichtmenschlichen Natur und anthropologische Voraussetzungen der Ethik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Das Kapitel führt in die Thematik der globalen ökologischen Gefahren ein, die durch zivilisatorisch-technische Aktivitäten des Menschen entstehen. Es betont die zunehmende Bedeutung der „ökologischen Krise“ im öffentlichen Diskurs, insbesondere im Licht des 4. UN-Klimaberichts, der den Menschen als Verursacher der Klimaveränderung identifiziert. Die Notwendigkeit, sowohl den Menschen vor der Natur als auch die Natur vor dem Menschen zu schützen, wird als völlig neuer Sachverhalt hervorgehoben, der eine neue ethische Fundierung des menschlichen Selbstverständnisses erfordert. Der Bericht des IPCC und seine Bedeutung für die Klimapolitik werden kurz erläutert, ebenso die globalen Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschheit und die Biodiversität.
2. Begründungsprobleme der Nachhaltigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die ethischen Herausforderungen, die sich aus den langfristigen Gefahrenpotenzialen des menschlichen Handelns ergeben. Die Problematik der Generationengerechtigkeit und der Diskontierung zukünftiger Kosten wird ausführlich diskutiert. Die Unsicherheiten bei Zukunftsprognosen aufgrund der Komplexität der betrachteten Systeme werden als gravierendes moralisch-pragmatisches Problem dargestellt, welches die Motivation zu präventivem Handeln schwächt. Die Kapitel analysiert die Notwendigkeit, angesichts des heutigen Wissens und der technischen Möglichkeiten, Grenzen in Forschung, Wissenschaft und Technik zu setzen und diskutiert die Frage, wem diese Grenzsetzung obliegt.
3. Kriterien für den Umgang mit Unwissenheit und Unsicherheit: Das Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Problem, welche Kriterien für den Umgang mit Unwissenheit und Unsicherheit in der Praxis gelten sollen. Es thematisiert die ethische Frage nach dem angemessenen Maß an Sicherheit und die Herausforderung, angesichts von Unsicherheiten in der Zukunftsprognose, handlungsfähige moralische Prinzipien zu entwickeln. Das Kapitel beleuchtet die Schwächung der Motivation zu präventivem Handeln aufgrund fehlender Sicherheit, dass gegenwärtige Verzichte zu spürbaren zukünftigen Verbesserungen führen.
4. Grenzen der Forschung, wissenschaftlichen Machbarkeit und technischen Umsetzung: Das Kapitel erörtert die Notwendigkeit, angesichts des heutigen Wissens und seiner technischen Umsetzbarkeit Grenzen in der Forschung, der wissenschaftlichen Machbarkeit und der technischen Umsetzung zu setzen. Die Frage nach der Verantwortlichkeit für diese Grenzsetzung – Wissenschaft und Technik selbst, Politik oder Ethik – wird diskutiert, wobei die Rolle der Technikethik hervorgehoben wird. Es wird die Notwendigkeit eines Konsenses über fundamentale Überzeugungen im Umgang mit ökologischen Problemen betont, welche globale Lösungsansätze erfordern, die eine Mehrheit der Menschen an bestimmte Verhaltensweisen binden.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Umweltethik, Generationengerechtigkeit, Klimawandel, Zukunftsprognose, Unsicherheit, Technikethik, anthropologische Voraussetzungen der Ethik, Eigenwert der Natur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Begründungsprobleme der Nachhaltigkeit
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit den Begründungsproblemen der Nachhaltigkeit im Kontext globaler ökologischer Herausforderungen. Sie analysiert ethische Implikationen menschlichen Handelns, die Notwendigkeit einer neuen ethischen Fundierung im Umgang mit Technik und Natur, sowie die Schwierigkeiten der Zukunftsprognose und deren Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung im Umweltschutz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt ethische Herausforderungen der Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit und Diskontierung zukünftiger Kosten, den Umgang mit Unsicherheit und Unwissenheit in der Zukunftsprognose, Grenzensetzung in Forschung, Wissenschaft und Technik sowie den Eigenwert der nichtmenschlichen Natur und anthropologische Voraussetzungen der Ethik.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) behandelt die globalen ökologischen Gefahren und die Notwendigkeit einer neuen ethischen Fundierung. Kapitel 2 (Begründungsprobleme der Nachhaltigkeit) beleuchtet ethische Herausforderungen, Generationengerechtigkeit und die Problematik von Zukunftsprognosen. Kapitel 3 (Kriterien für den Umgang mit Unwissenheit und Unsicherheit) befasst sich mit Kriterien für den Umgang mit Unsicherheit und der Entwicklung handlungsfähiger moralischer Prinzipien. Kapitel 4 (Grenzen der Forschung, wissenschaftlichen Machbarkeit und technischen Umsetzung) erörtert die Notwendigkeit von Grenzen in Forschung und Technik und die Frage der Verantwortlichkeit für deren Setzung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Nachhaltigkeit, Umweltethik, Generationengerechtigkeit, Klimawandel, Zukunftsprognose, Unsicherheit, Technikethik, anthropologische Voraussetzungen der Ethik, Eigenwert der Natur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Begründungsprobleme der Nachhaltigkeit und analysiert die ethischen Implikationen menschlichen Handelns auf die Natur. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten der Zukunftsprognose und deren Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung im Umweltschutz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, politische Entscheidungsträger und alle, die sich mit Fragen der Nachhaltigkeit, Umweltethik und der ethischen Verantwortung im Umgang mit Technik und Natur auseinandersetzen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist in der Originalpublikation zu finden (Hinweis: Hier sollte der Bezug zur Originalpublikation eingefügt werden).
- Quote paper
- Holger Richter (Author), 2007, Mensch und Natur - Begründungsprobleme der Nachhaltigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90141