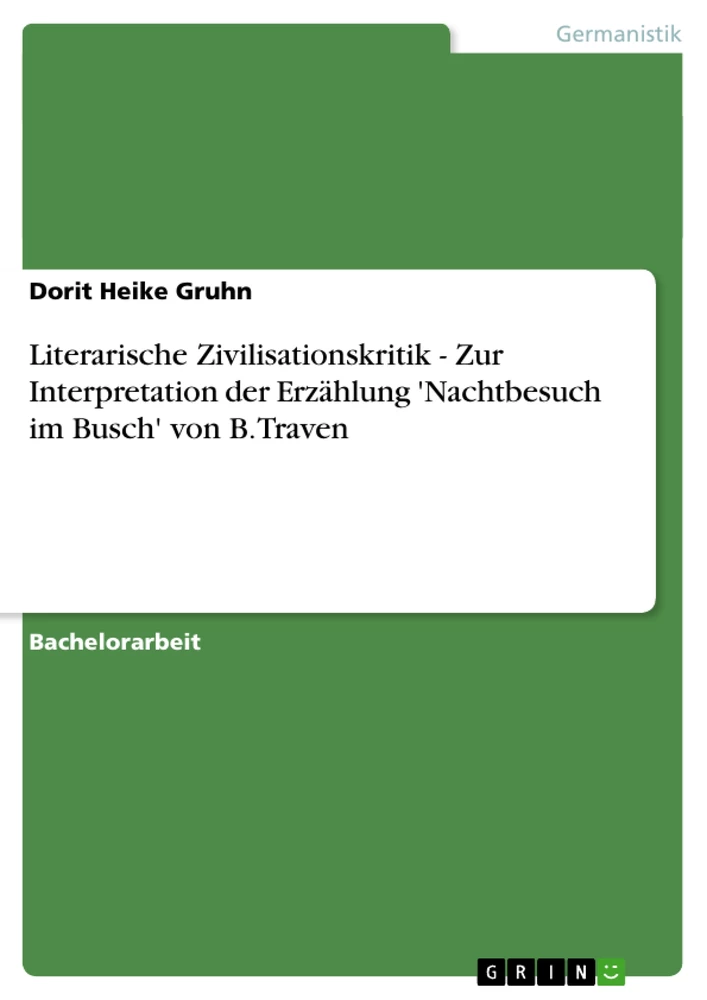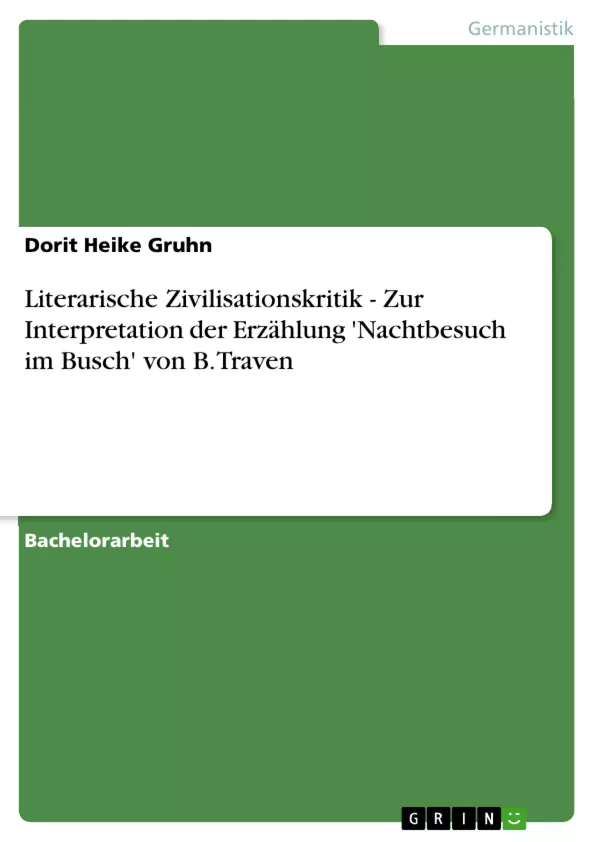Nicht jedem Autor gelingt es, so wie B. Traven, eine Millionenauflage zu erzielen und in mehrere Dutzend Sprachen übersetzt zu werden. Zwar konnte keine der unzähligen Hypothesen über Travens Identität endgültig bewiesen werden, angesichts der hohen Auflagenzahlen seiner Werke ist es aber doch verwunderlich, dass weder die mexikanische noch die deutsche Nationalliteratur den Autoren so recht für sich beanspruchen möchte.
Hängt die weitgehende Auslassung des Autors in der deutschen Literaturgeschichtsschreibung möglicherweise damit zusammen, dass seine Werke nicht der "hohen Literatur" zugerechnet werden? "Gewiss, literarisch oder künstlerisch im engeren, ästhetischen Sinne sind die Meriten dieser Romane nicht, oder nicht in erster Linie", stellt Karl S. Guthke fest und nennt dabei unter anderem folgende Kritikpunkte an Travens literarischem Können: "Überdeutlichkeit in der Handhabung der erzählerischen Mittel, wenig Sinn für die ästhetisch sinnvolle Komposition des epischen Materials, lehrhafte Cicerone-Manier und aufdringliche Pedanterie, unbekümmert flüchtige Sprachgebung bis zur Schlampigkeit, allzu burschikos und antibürgerlich, Mangel an psychologischer Raffinesse".
Ganz vergessen wurde Traven von der Literaturwissenschaft allerdings nicht. In der 1989 von Angelika Machinek veröffentlichten B. Traven Bibliographie sind immerhin 366 Veröffentlichungen (Bücher u. Artikel) aufgeführt, wobei sofort auffällt, dass sich die meisten Titel mit der Biographie des Autors beschäftigen - ganz gegen den Sinn Travens, der immer wieder behauptete, dass die Biographie eines schöpferischen Menschen ganz und gar unwichtig sei.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich dann auch nur am Rande biographische Daten des Autors ansprechen. Vielmehr geht es darum, in der Erzählung Nachtbesuch im Busch zu untersuchen, wie er die europäische bzw. US-amerikanische Zivilisation der indianisch-mexikanischen Kultur gegenüberstellt, wobei der Antagonismus beider herausgearbeitet wird. Dabei soll der oben genannte ästhetische Sündenkatalog nicht aus den Augen verloren werden, die Analyse wird also auch von der Frage geleitet, ob Erzähltechnik und sprachliche Eigenheiten der Erzählung diesen bestätigen. Ausgangspunkt der Interpretation bildet die hermeneutische Annäherung an den Primärtext, der zusätzliche Einbezug werktranszendenter Aspekte, wie anthropologischer Daten, Parellelstellen in anderen Werken Travens usw. wird aber für eine umfassende Beleuchtung unerlässlich sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ist B. Traven der Literaturwissenschaft unwürdig?
- 2. Notwendige Vorbemerkungen
- 2.1. Die verschiedenen Textversionen
- 2.2. Begriffserläuterungen
- 3. Der Ich-Erzähler Gales. Überlegungen zu Erzähltechnik, Sprache und Bauform
- 4. Wirklichkeit und Fiktion: Geographische Angaben in der Erzählung
- 5. Der Busch und die Zeit
- 6. Antagonismen: Individuum versus Kollektiv
- 6.1
- 6.2 Die Bedeutung der irdischen Reichtümer
- 6.3 Lektüre versus orale Tradition
- 7. Gales' wechselnde Identität: die vier Träume
- 8. Doktor Wilshead: Von "hogs" und "dogs"
- 9. Die Botschaft des Panukesen: Lebendige Kultur und tote Zivilisation
- 10. Nachtbesuch im Busch in Travens Gesamtwerk
- 11. Zivilisationskritische Thesen als Literatur?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht B. Travens Erzählung "Nachtbesuch im Busch" im Hinblick auf dessen Darstellung der europäischen/US-amerikanischen Zivilisation im Kontrast zur indianisch-mexikanischen Kultur. Es wird analysiert, wie Traven diese Gegenüberstellung durch erzählerische, sprachliche und inhaltliche Mittel gestaltet. Die Arbeit bezieht dabei auch werktranszendente Aspekte wie anthropologische Daten und Parallelstellen in anderen Werken Travens mit ein.
- Der Vergleich europäischer/US-amerikanischer und indianisch-mexikanischer Kulturen
- Die Erzähltechnik und Sprache in "Nachtbesuch im Busch"
- Die Rolle von Wirklichkeit und Fiktion in der Erzählung
- Die Darstellung von Antagonismen (Individuum vs. Kollektiv, materielle Güter vs. spirituelle Werte)
- Die Bedeutung der Identität und des kulturellen Erbes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ist B. Traven der Literaturwissenschaft unwürdig?: Dieses Kapitel untersucht die überraschend geringe Berücksichtigung B. Travens in der deutschsprachigen und auch lateinamerikanischen Literaturwissenschaft, trotz seiner Millionenauflagen und Übersetzungen in zahlreiche Sprachen. Es hinterfragt die Gründe für diese Marginalisierung, indem es Travens Werke im Kontext etablierter Literaturkanons und Anthologien untersucht und verschiedene Hypothesen zu dessen Status innerhalb der Literaturlandschaft diskutiert. Die Arbeit beleuchtet den Widerspruch zwischen der Popularität von Travens Werken und deren Abwesenheit in wichtigen Nachschlagewerken und Literaturgeschichten, wobei Faktoren wie der Status als "Pseudonym-Virtuose", die Einstufung seiner Werke als "Unterhaltungsliteratur" und die Schwierigkeit, ihn national zu verorten, diskutiert werden.
2. Notwendige Vorbemerkungen: Dieses einleitende Kapitel bereitet den Leser auf die folgende Analyse von "Nachtbesuch im Busch" vor. Es thematisiert verschiedene Textversionen der Erzählung und liefert wichtige Begriffserklärungen, die für das Verständnis der Arbeit unerlässlich sind. Diese vorbereitenden Ausführungen schaffen eine solide Grundlage für die detaillierte Auseinandersetzung mit dem literarischen Werk, indem sie unterschiedliche Lesarten und Interpretationen antizipieren und den Rahmen für die folgende Analyse abstecken. Durch Klärung von terminologischen Unklarheiten und der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Textfassungen wird die Grundlage für eine präzise und fundierte Analyse gelegt.
3. Der Ich-Erzähler Gales. Überlegungen zu Erzähltechnik, Sprache und Bauform: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des Ich-Erzählers Gales und seiner Funktion innerhalb der Erzählung. Es untersucht die Erzähltechnik, die sprachlichen Mittel und die Struktur des Textes, um ein umfassendes Verständnis der Erzählperspektive und der damit verbundenen Wirkung auf den Leser zu vermitteln. Die Analyse geht detailliert auf die sprachlichen Besonderheiten ein und beleuchtet den Einfluss der Erzählperspektive auf die Darstellung der Handlung und der Charaktere.
4. Wirklichkeit und Fiktion: Geographische Angaben in der Erzählung: Dieser Abschnitt analysiert die geographischen Angaben in Travens Erzählung und untersucht die Beziehung zwischen der fiktiven Darstellung und der realen Geographie. Die Arbeit untersucht, inwieweit die geographischen Details die Handlung beeinflussen und welche Rolle sie in der Gesamtdeutung des Werkes spielen. Es wird der Grad der Fiktionalisierung und der Bezug zur Realität analysiert, um die Funktion der geographischen Elemente innerhalb der Erzählung zu verstehen.
5. Der Busch und die Zeit: Dieses Kapitel untersucht die symbolische Bedeutung des Busches und die Darstellung der Zeit in der Erzählung. Es analysiert, wie der Busch als Metapher für bestimmte kulturelle oder gesellschaftliche Aspekte eingesetzt wird und wie die Zeitgestaltung die Erzählung strukturiert und beeinflusst. Die Kapitel befasst sich mit der komplexen Interaktion zwischen dem Raum (der Busch) und der Zeit, um den tieferen Sinn hinter Travens literarischen Entscheidungen zu enthüllen.
6. Antagonismen: Individuum versus Kollektiv: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Darstellung von Antagonismen in der Erzählung, insbesondere den Gegensatz zwischen Individuum und Kollektiv. Es analysiert verschiedene Aspekte dieses Konflikts, wie die Bedeutung der irdischen Reichtümer und den Gegensatz zwischen schriftlicher Lektüre und oraler Tradition. Die Bedeutung dieser Antagonismen für das Verständnis der zentralen Konflikte und des Gesamtkontexts der Erzählung wird ausführlich beleuchtet.
7. Gales' wechselnde Identität: die vier Träume: Dieses Kapitel fokussiert auf die sich wandelnde Identität des Protagonisten Gales und die Bedeutung seiner vier Träume. Die Analyse der Träume soll Aufschluss über die innere Entwicklung Gales' und dessen Auseinandersetzung mit der ihn umgebenden Welt geben. Die Symbole und Bilder in den Träumen werden interpretiert und in Bezug zu den anderen Kapiteln gesetzt.
8. Doktor Wilshead: Von "hogs" und "dogs": Dieses Kapitel analysiert die Figur des Doktor Wilshead und seine Rolle im Kontext der zivilisationskritischen Auseinandersetzung. Die Untersuchung von Wilsheads Charakter und dessen Verhalten beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Konflikts zwischen der europäischen/amerikanischen Zivilisation und der indianischen Kultur. Die Bezeichnungen "hogs" und "dogs" werden im Detail interpretiert und in den Gesamtkontext der Erzählung eingeordnet.
9. Die Botschaft des Panukesen: Lebendige Kultur und tote Zivilisation: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Botschaft des Panukesen und dessen Darstellung lebendiger Kultur im Gegensatz zur als "tot" wahrgenommenen Zivilisation. Es wird analysiert, wie diese Gegenüberstellung die zivilisationskritische Perspektive Travens verstärkt und welche Bedeutung diese für das Verständnis des Werkes hat. Die Analyse beleuchtet die Symbolik und die tieferen Bedeutungen hinter den Aussagen und Handlungen des Panukesen.
10. Nachtbesuch im Busch in Travens Gesamtwerk: Dieser Abschnitt betrachtet "Nachtbesuch im Busch" im Kontext von Travens Gesamtwerk und untersucht dessen Stellung innerhalb seiner anderen Erzählungen und Romane. Es werden Parallelen und Unterschiede zu anderen Werken Travens aufgezeigt, um ein umfassenderes Bild seines literarischen Schaffens und seiner zentralen Themen zu gewinnen. Die Analyse untersucht, wie die vorliegende Erzählung typische Motive und Thematiken Travens repräsentiert oder sich von diesen abgrenzt.
Schlüsselwörter
B. Traven, Nachtbesuch im Busch, Zivilisationskritik, indianisch-mexikanische Kultur, europäische Zivilisation, US-amerikanische Zivilisation, Erzähltechnik, Sprache, Identität, Antagonismen, Individuum, Kollektiv, orale Tradition, Lektüre, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen zu B. Travens "Nachtbesuch im Busch"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert B. Travens Erzählung "Nachtbesuch im Busch" und untersucht die Gegenüberstellung europäischer/US-amerikanischer und indianisch-mexikanischer Kulturen. Im Mittelpunkt steht die Analyse der erzählerischen, sprachlichen und inhaltlichen Mittel, die Traven zur Gestaltung dieses Kontrasts verwendet. Die Studie bezieht auch anthropologische Daten und Parallelen zu anderen Werken Travens ein.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Vergleich europäischer/US-amerikanischer und indianisch-mexikanischer Kulturen, Erzähltechnik und Sprache in "Nachtbesuch im Busch", die Rolle von Wirklichkeit und Fiktion, die Darstellung von Antagonismen (Individuum vs. Kollektiv, materielle Güter vs. spirituelle Werte) und die Bedeutung von Identität und kulturellem Erbe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem einzelnen?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel: Kapitel 1 untersucht die überraschend geringe Berücksichtigung Travens in der Literaturwissenschaft. Kapitel 2 liefert einleitende Vorbemerkungen zu verschiedenen Textversionen und Begriffserklärungen. Kapitel 3 analysiert den Ich-Erzähler Gales und die Erzähltechnik. Kapitel 4 untersucht die geographischen Angaben und die Beziehung zwischen Fiktion und Realität. Kapitel 5 behandelt die symbolische Bedeutung des Busches und die Darstellung der Zeit. Kapitel 6 konzentriert sich auf Antagonismen wie Individuum vs. Kollektiv. Kapitel 7 analysiert Gales' wechselnde Identität anhand seiner Träume. Kapitel 8 untersucht die Figur des Doktor Wilshead. Kapitel 9 analysiert die Botschaft des Panukesen. Kapitel 10 betrachtet "Nachtbesuch im Busch" im Kontext von Travens Gesamtwerk.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: B. Traven, Nachtbesuch im Busch, Zivilisationskritik, indianisch-mexikanische Kultur, europäische Zivilisation, US-amerikanische Zivilisation, Erzähltechnik, Sprache, Identität, Antagonismen, Individuum, Kollektiv, orale Tradition, Lektüre, Kulturvergleich.
Warum wird B. Traven in der Literaturwissenschaft vergleichsweise wenig beachtet?
Kapitel 1 der Arbeit untersucht die Gründe für die geringe Berücksichtigung Travens in der deutschsprachigen und lateinamerikanischen Literaturwissenschaft, trotz seiner großen Popularität. Es werden Hypothesen diskutiert, die seinen Status als "Pseudonym-Virtuose", die Einstufung seiner Werke als "Unterhaltungsliteratur" und die Schwierigkeit, ihn national zu verorten, einbeziehen.
Welche Bedeutung haben die geographischen Angaben in der Erzählung?
Kapitel 4 analysiert die geographischen Angaben in "Nachtbesuch im Busch" und untersucht, wie sie die Handlung beeinflussen und zur Gesamtdeutung beitragen. Es wird der Grad der Fiktionalisierung und der Bezug zur Realität analysiert.
Welche Rolle spielt der "Busch" in der Erzählung?
Kapitel 5 untersucht den "Busch" als Symbol für kulturelle und gesellschaftliche Aspekte und analysiert die Bedeutung der Zeitgestaltung in der Erzählung und deren Interaktion mit dem Raum (dem Busch).
Wie wird der Antagonismus zwischen Individuum und Kollektiv dargestellt?
Kapitel 6 analysiert den Gegensatz zwischen Individuum und Kollektiv, die Bedeutung materieller Güter und den Gegensatz zwischen schriftlicher Lektüre und oraler Tradition.
Welche Bedeutung haben Gales' Träume?
Kapitel 7 fokussiert auf die wechselnde Identität Gales' und interpretiert seine vier Träume, um Aufschluss über seine innere Entwicklung zu erhalten.
Wie wird die Figur des Doktor Wilshead charakterisiert?
Kapitel 8 analysiert die Figur des Doktor Wilshead und seine Rolle im Kontext der zivilisationskritischen Auseinandersetzung. Die Bedeutung der Bezeichnungen "hogs" und "dogs" wird im Detail interpretiert.
- Citar trabajo
- Magister Artium Dorit Heike Gruhn (Autor), 2000, Literarische Zivilisationskritik - Zur Interpretation der Erzählung 'Nachtbesuch im Busch' von B. Traven, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9019