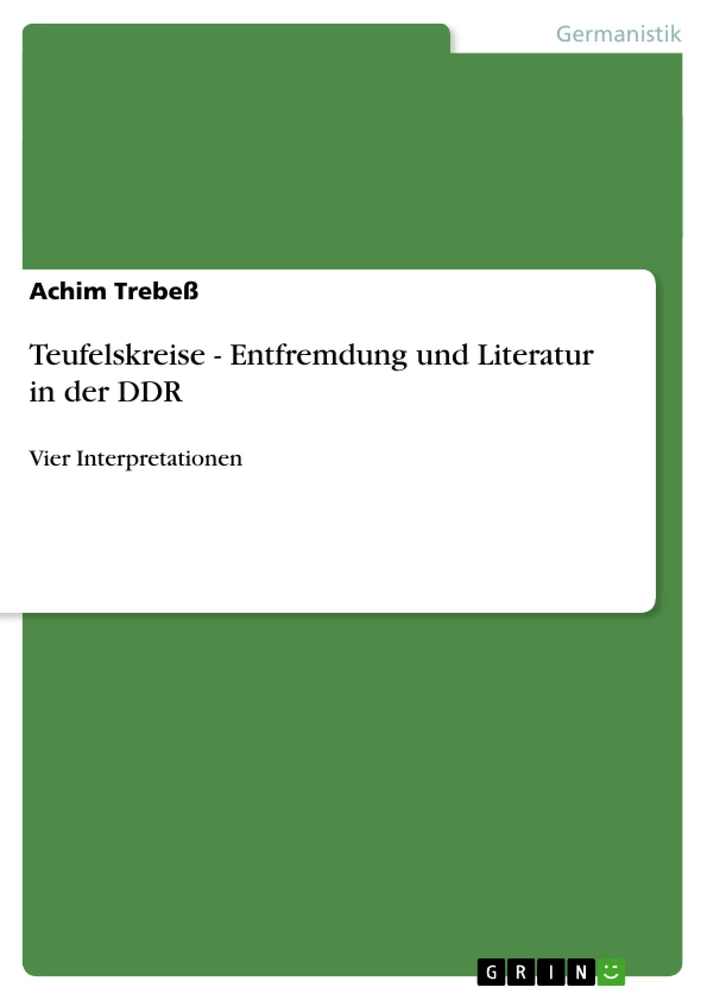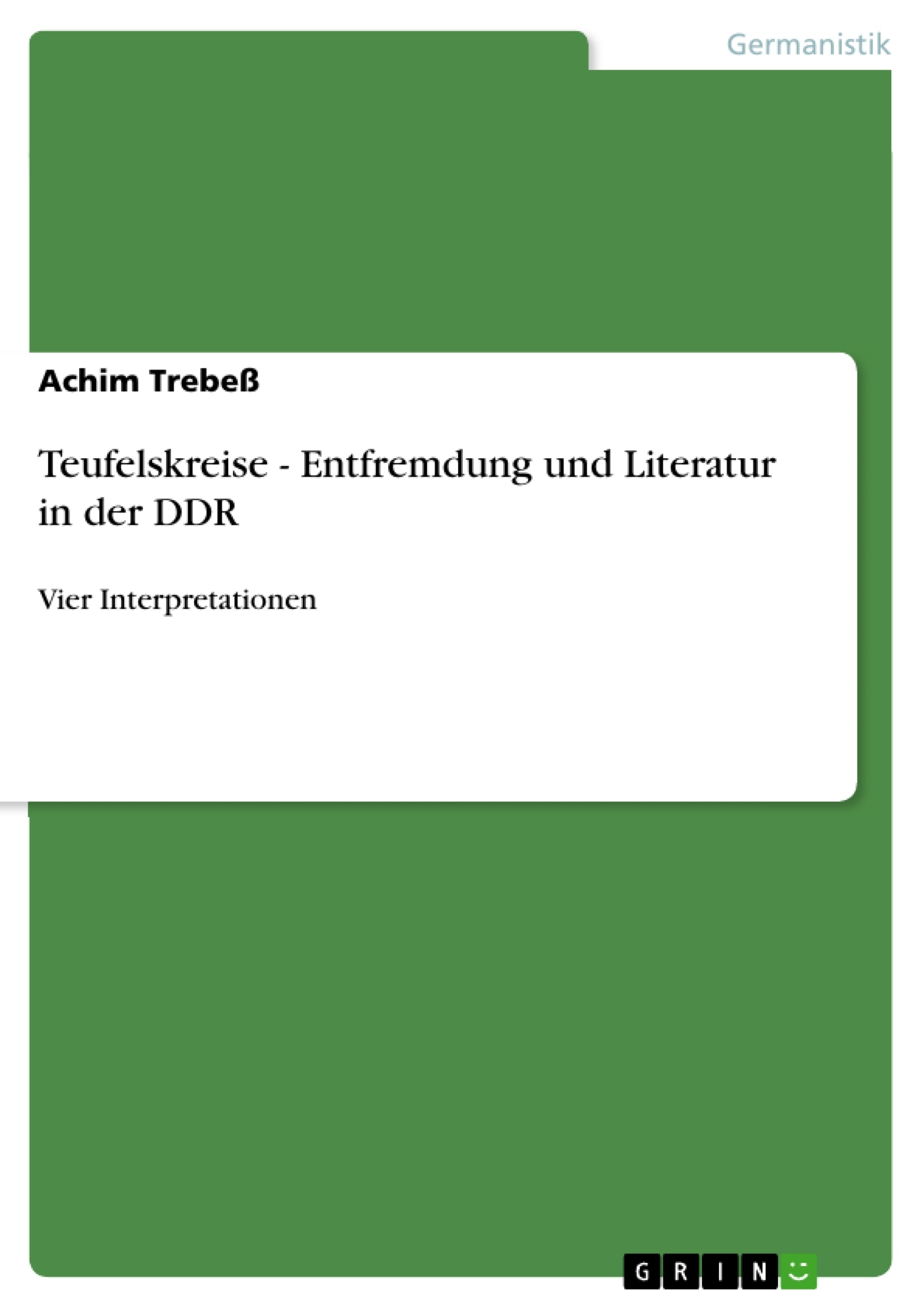In diesem Buch werden unter dem Aspekt der Entfremdung vier literarische Texte aus der DDR interpretiert. Damit verbindet sich der Anspruch, die literarische Entwicklung und ihren Bezug zur Wirklichkeit der DDR an entscheidenden Wendepunkten der DDR-Geschichte mit Hilfe von Beispielen darzustellen. Ausführlich interpretiert werden:
Bertolt Brechts "Buckower Elegien" (1953)
Christa Wolf: "Nachdenken über Christa T." (1968)
Heiner Müller: "Zement" (1972)
Volker Braun: "Hinze-Kunze-Roman" (1985).
Die Interpretationen wollen die Widersprüchlichkeit der Entwicklung der DDR verdeutlichen helfen und sind gleichzeitig Angebote, neu über Entfremdung in der Gegenwart nachzudenken.
Der Autor des Buches, Achim Trebeß, Jahrgang 1953, hat bereits 2001 eine Publikation zum Thema „Entfremdung und Ästhetik“ vorgelegt (Metzler Verlag Stuttgart und Weimar) und 2006 ein „Lexikon Ästhetik. Kunst, Alltag, Design und Medien“ herausgegeben (Metzler Verlag Stuttgart und Weimar).
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Das unheimlich schweigende Land
- Bertolt Brecht: Buckower Elegien (1953)
- Einige Besonderheiten der späten Lyrik Brechts
- Entfremdung und Verfremdung
- Mühen der Ebenen?
- Der einsame Segler
- Überall zu Hause - überall fremd
- Christa Wolf: Nachdenken über Christa T. (1968)
- Das Motiv der Entfremdung bei Christa Wolf
- Der Bruch mit der Kulturpolitik - Voraussetzungen des Textes
- Sozialistischer Realismus und modernes Erzählen
- Die Schwierigkeit, "wir" zu sagen
- Heiner Müller: Zement (1972)
- Das Weiße im Auge der Geschichte
- Stücke im Stück
- Befreiung der Lebenden und Toten
- Die Intermedien
- Erstes Intermedium: Das Ende des blindwütigen Schlachtens
- Zweites Intermedium: Die Befreiung des Prometheus als Rettung der Götter
- Drittes Intermedium: Der Bauplan Herakles'
- Volker Braun: Hinze-Kunze-Roman (1985)
- Vom Teufelspakt zum Teufelskreis
- Abweichungen von der Linie des Erzählens
- Das ungleiche Paar: Verhältnisse von Hinze und Kunze
- Eine utopische Körperschaft
- Die leichteste Weise der Existenz: Kunst
- Der Schluss: das Ende
- Anmerkungen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aktualität der DDR-Literatur anhand detaillierter Interpretationen. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion des Entstehungskontextes der Texte und der Auseinandersetzung mit dem Problem der Entfremdung. Ausgewählt wurden exemplarische Texte, die verschiedene Perioden der DDR-Geschichte repräsentieren und unterschiedliche Facetten der Entfremdung beleuchten.
- Entfremdung und ihre Darstellung in der DDR-Literatur
- Der Kontext der Entstehung der Texte und seine Bedeutung für die Interpretation
- Die Auseinandersetzung mit dem Sozialistischen Realismus
- Die Entwicklung des Konzepts der Entfremdung im Laufe der DDR-Geschichte
- Die Aktualität der behandelten Themen für die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Das unheimlich schweigende Land: Dieser einführende Abschnitt legt die Grundlage für die folgenden Interpretationen. Der Autor beschreibt den kontroversen Umgang mit DDR-Literatur in der Gegenwart und kritisiert die Tendenz, diese Literatur ausschließlich im Rückblick und ohne Berücksichtigung ihrer Aktualität zu betrachten. Er kündigt seinen Ansatz an, die Texte im Kontext ihrer Entstehung zu interpretieren, um deren zeitgenössische Relevanz aufzuzeigen. Der Fokus auf das Thema Entfremdung wird als verbindendes Element der Analyse herausgestellt und die Auswahl der analysierten Texte (Brecht, Wolf, Müller, Braun) wird in Bezug auf ihre Repräsentativität für verschiedene Phasen der DDR-Geschichte begründet.
Bertolt Brecht: Buckower Elegien (1953): Die Analyse der Buckower Elegien Brechts konzentriert sich auf die Darstellung der Entfremdung im Kontext der ersten Krise der DDR (17. Juni 1953). Die Interpretation beleuchtet, wie Brecht die gesellschaftlichen Spannungen und die Entfremdung der Menschen von der politischen Realität in seinen Gedichten verarbeitet. Es wird untersucht, wie Brechts spezifische dichterische Mittel – wie Verfremdungseffekte – zur Darstellung dieser Entfremdung beitragen und welche Bedeutung die Elegien für das Verständnis der frühen DDR-Gesellschaft haben.
Christa Wolf: Nachdenken über Christa T. (1968): Die Zusammenfassung dieses Kapitels befasst sich mit Christa Wolfs Roman "Nachdenken über Christa T." im Kontext der frühen 1960er Jahre in der DDR. Die Analyse beleuchtet, wie Wolf das Motiv der Entfremdung einsetzt, um den Bruch von Intellektuellen mit der sozialistischen Kulturpolitik darzustellen. Es wird die Auseinandersetzung zwischen sozialistischem Realismus und modernem Erzählen untersucht und gezeigt, wie die Protagonistin mit der Schwierigkeit ringt, sich mit dem Kollektiv ("wir") zu identifizieren. Die Bedeutung des Romans für das Verständnis der intellektuellen Selbstfindung und der Kritik an der ideologischen Enge der DDR wird herausgearbeitet.
Heiner Müller: Zement (1972): Dieses Kapitel analysiert Heiner Müllers "Zement" als exemplarischen Text für die Stagnationsphase des "realen Sozialismus" in der DDR. Die Interpretation konzentriert sich auf die Darstellung der Entfremdung in ihren extremen Formen während der Restaurationsphase. Die Analyse der "Stücke im Stück" und der "Intermedien" wird beleuchten, wie Müller die Widersprüche der Gesellschaft und die Verstrickung der Individuen in diese Widersprüche darstellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Darstellung von Befreiung und Unterdrückung, Leben und Tod und der komplexen Beziehung zwischen Geschichte und Gegenwart.
Volker Braun: Hinze-Kunze-Roman (1985): Die Analyse von Volker Brauns "Hinze-Kunze-Roman" fokussiert auf die Darstellung des Zerbrechens der DDR und die damit verbundenen Entfremdungsprozesse am Ende des sozialistischen Systems. Es wird untersucht, wie Braun die Abweichungen von der offiziellen Erzählungslinie darstellt und die ungleichen Verhältnisse zwischen Hinze und Kunze als Metapher für die gesellschaftlichen Widersprüche interpretiert. Die Bedeutung von Kunst als "leichteste Weise der Existenz" wird im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung diskutiert und der Roman als ein Spiegelbild des Zusammenbruchs der DDR betrachtet.
Schlüsselwörter
DDR-Literatur, Entfremdung, Sozialistischer Realismus, Brecht, Wolf, Müller, Braun, 17. Juni 1953, Identität, Ideologiekritik, Geschichte der DDR, Utopie, Realität, Widersprüche, politische Systeme, Kunst, Erfahrung.
Häufig gestellte Fragen zu: DDR-Literatur: Entfremdung und ihre Darstellung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die DDR-Literatur und untersucht die Aktualität ihrer Themen anhand detaillierter Interpretationen exemplarischer Texte von Bertolt Brecht, Christa Wolf, Heiner Müller und Volker Braun. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Entfremdung im Kontext der jeweiligen Entstehungsphase der Texte und der Auseinandersetzung mit dem Sozialistischen Realismus.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert folgende Texte: Bertolt Brechts "Buckower Elegien" (1953), Christa Wolfs "Nachdenken über Christa T." (1968), Heiner Müllers "Zement" (1972) und Volker Brauns "Hinze-Kunze-Roman" (1985). Diese Texte repräsentieren verschiedene Phasen der DDR-Geschichte und beleuchten unterschiedliche Facetten des Themas Entfremdung.
Welches zentrale Thema wird behandelt?
Das zentrale Thema ist die Entfremdung in der DDR-Literatur. Die Arbeit untersucht, wie diese Entfremdung in den ausgewählten Texten dargestellt wird, welche Ursachen ihr zugrunde liegen und welche Bedeutung sie für das Verständnis der DDR-Gesellschaft hat. Der Kontext der Entstehung der Texte spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Wie wird die Entfremdung dargestellt?
Die Darstellung der Entfremdung variiert je nach Autor und Text. Bei Brecht wird die Verfremdungstechnik eingesetzt, um die gesellschaftlichen Spannungen und die Entfremdung der Menschen von der politischen Realität zu zeigen. Wolf thematisiert die Entfremdung von Intellektuellen von der sozialistischen Kulturpolitik. Müller zeigt extreme Formen der Entfremdung in der Stagnationsphase des "realen Sozialismus". Braun beschreibt die Entfremdungsprozesse im Zerfall der DDR.
Welche Rolle spielt der Sozialistische Realismus?
Der Sozialistische Realismus und seine Auswirkungen auf die Literatur und die Schriftsteller werden als wichtiger Kontextfaktor für das Verständnis der dargestellten Entfremdung untersucht. Die Auseinandersetzung der Autoren mit den Vorgaben und Einschränkungen des Sozialistischen Realismus wird analysiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Aktualität der DDR-Literatur aufzuzeigen und zu zeigen, dass die behandelten Themen auch heute noch relevant sind. Sie rekonstruiert den Entstehungskontext der Texte und analysiert die verschiedenen Facetten der Entfremdung, um ein umfassendes Bild der DDR-Gesellschaft zu zeichnen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu den einzelnen analysierten Texten, wobei jedes Kapitel eine detaillierte Interpretation des jeweiligen Werkes bietet. Zusätzlich gibt es ein Vorwort, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der Kapitel und ein Literaturverzeichnis.
Welche Bedeutung haben die Intermedien in Heiner Müllers "Zement"?
Die Intermedien in Heiner Müllers "Zement" sind integraler Bestandteil der Dramaturgie und werden als eigenständige analytische Einheiten betrachtet. Sie beleuchten die zentralen Konflikte und Widersprüche des Werkes und tragen zum Verständnis der komplexen Darstellung von Befreiung und Unterdrückung bei.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die vielfältigen Facetten der Entfremdung in der DDR-Literatur auf und betont die Aktualität der behandelten Themen. Sie demonstriert, wie die ausgewählten Autoren die Widersprüche und Probleme ihrer Zeit literarisch verarbeitet und kritisiert haben.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die Arbeit enthält ein Literaturverzeichnis mit den relevanten Quellen, die für weitere Recherchen konsultiert werden können.
- Quote paper
- Prof. Dr. Achim Trebeß (Author), 1999, Teufelskreise - Entfremdung und Literatur in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90193